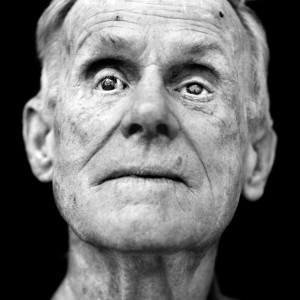Wohl kein Datum in der jüngeren Geschichte Europas zeitigte gravierendere Auswirkungen auf das Schicksal des Kontinents als der 28. Juni 1914. Das Attentat von Sarajevo, die Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares durch einen serbischen Nationalisten, sollte die politischen, die militärischen, die sozialen und die kulturellen Koordinaten der „Alten Welt“ für immer verschieben.
Nur anderthalb Monate nach den Schüssen in der bosnischen Hauptstadt gingen, wie der damalige britische Außenminister Grey bereits am 3. August 1914 prophezeit hatte, in Europa die Lichter aus: Ein Kontinent, in dem mit Ausnahme einiger Balkankriege im Gefolge des Niedergangs des Osmanischen Reiches mehr als vierzig Jahren Frieden geherrscht hatte, versank in einem vierjährigen Völkermorden, das sich bis heute ins kollektive Gedächtnis der daran beteiligten Nationen eingebrannt hat: Die grauenhaften Materialschlachten in Flandern; das einjährige Blutvergießen bei Verdun mit knapp einer Million Toten; die Zustände an der Front in Russland; die völlig sinnlosen Waffengänge in den Hochalpen; Gallipoli an den Dardanellen; schließlich die Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Armeniern – für viele, nicht nur europäische Völker bilden die Geschehnisse zwischen 1914 und 1918 einen zentralen Bestandteil ihrer nationalen Narrative.[1]
Doch der Erste Weltkrieg stellte nicht nur aus der Perspektive der Humanität einen Epocheneinschnitt, einen Zivilisationsbruch dar. Im Gefolge all der Grausamkeiten, die an den Fronten begangen wurden, gerieten vielmehr ganze gesellschaftliche Ordnungen ins Wanken. Das Jahr 1914 markiert auch den Beginn eines Zeitalters der Revolutionen und der soziokulturellen Umwälzungen. Eine Dekade nach dem Anschlag auf das österreichische Thronfolgerpaar war in Deutschland und Europa nichts mehr wie zuvor: Monarchien waren gestürzt, die traditionelle Gesellschaft befand sich in Auflösung, die industrielle Moderne hielt endgültig, die kulturelle Moderne hielt auf breiter Front Einzug in die Lebenswelten.[2]
Dabei finden sich erste Anzeichen für das Herannahen einer neuen Zeit bereits vor 1914. In Deutschland wies die Art und Weise der politischen Auseinandersetzung zunehmend in Richtung Demokratie; die Gesellschaft wurde mobiler und durchlässiger; die künstlerische Avantgarde setzte, zögerlich noch, mit expressionistischen Ausdrucksformen erste Akzente; Technikbegeisterung griff im Zuge der Hochindustrialisierung und einer ganzen Welle an neuen, wegweisenden Erfindungen um sich; moderne Formen der Freizeitgestaltung schließlich begannen sich durchzusetzen: das Kino, das sich bereits vor 1914 mit Lichtspielhäusern selbst in Kleinstädten zu einem Volksvergnügen entwickelte; die Tanzveranstaltungen, die Varietés, die auf die Sensationsgier der Zeitgenossen abzielten; und auch der Sport – Schwimmen, Radfahren, Fußball – avancierte noch vor jener „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) zu einer bevorzugten Freizeitbeschäftigung.[3]
Anderseits freilich hatten die Entwicklungen, die der modernen Massengesellschaft den Weg wiesen, noch nicht jenen Schwung, den ihnen der Epochenbruch des Weltkrieges verleihen sollte. Noch dominierte das Traditionelle, noch dominierte die herkömmliche gesellschaftliche Schichtung, wurden öffentliches Leben sowie öffentliche Diskurse von Bildungsbürgern, meist konservativer Provenienz, bestimmt[4] – und dies in umso stärkerem Maße, je weiter man sich von den urbanen Zentren entfernte. Noch wiesen das Theater, wiesen klassische Konzerte nicht jenen elitären Charakter auf, der diesen beiden Kunstformen nach dem endgültigen Siegeszug der populären Unterhaltungsindustrie zugeschrieben wurde. Noch wurde das Bild der Leibesübung von Turnvereinen geprägt und nicht von modernen, aus England stammenden Sportarten.[5] Noch hatten neueste Techniken der Fortbewegung nicht den Alltag der Menschen erobert. Noch diente die Presse mehrheitlich der Aufrechterhaltung der überkommenen Ordnung. Noch stand die Revolution nicht einmal als „Drohung“ im Raum.
Anhand einer Kleinstadt, anhand des Beispiels Neuburg an der Donau, sei im Folgenden die Lebenswelt der Menschen kurz vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben – eine Lebenswelt, die noch bestimmt war von Tradition und die dennoch bereits vom Anbruch einer neuen Zeit kündet.
Politisches – Ökonomisches - Demographisches
Bevor das Alltagsleben Neuburgs kurz vor Ausbruch Ersten Weltkrieges ins Zentrum rückt, ist es angebracht, einige allgemeine Anmerkungen voranzustellen. Wie stellte sich die Stadt vor 1914 auf der politischen und demographischen Landkarte Bayerns dar, wie nehmen sich deren struktur- und kommunalgeschichtlichen Daten aus?
Im Jahr 1505 entstand das Herzogtum Pfalz-Neuburg mit Neuburg als Residenzstadt. Knapp vier Dekaden später wurde Neuburg unter Pfalzgraf Ottheinrich protestantisch. Wiederum gut sieben Jahrzehnte nach der Hinwendung des Landesherrn zum Protestantismus erfolgte 1616/17 die Gegenreformation. 1742 starb die Hauptlinie der Neuburger Pfalzgrafen aus, wodurch der Zweig Sulzbach in der Nachfolge zum Zuge kam. 1777 wurden auch die bayerischen Wittelsbacher beerbt, so dass nun die Länder Pfalz und Bayern vereinigt waren. Nach dem Ende der Linie Sulzbach 1799 fielen deren Territorien an Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler-Zweibrücken. Als Folge der Mediatisierung, jener großangelegten Flurbereinigung des ehemaligen Kaiserreiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wurde 1808 das Herzogtum Pfalz-Neuburg/Sulzbach endgültig aufgehoben und dem neu geschaffenen Königreich Bayern einverleibt. Einen weiteren Einschnitt brachte das Jahr 1837, als im Zuge der Landesteilung Bayerns der Zusammenschluss der Donaustadt mit Schwaben zu einem Regierungsbezirk erfolgte.
Als Konsequenz der Reorganisation des Königreiches musste sich Neuburg mit einer geminderten politischen Bedeutung abfinden. Der Stadt kam nun lediglich noch die Funktion eines Zentrums für das ländliche Umland zu. Dass Neuburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dabei auch ökonomisch und demographisch ins Hintertreffen geriet, war freilich dem Umstand geschuldet, dass die Stadt nicht sofort an die im Zuge der industriellen Moderne neu entstehenden Verkehrswege angeschlossen wurde. Die „Königlich-Bayerischen Staatseisenbahnen“, 1844 gegründet, ließen mit ihren Hauptverbindungen zwischen den drei großen Städten des Landes, ließen mit ihren Verbindungen zwischen Nürnberg, München und Augsburg, die alte Residenzstadt außen vor. Um Franken besser an Altbayern anzubinden, führten zweigleisige Schienenstränge über Ingolstadt und Donauwörth, nicht aber über Neuburg. Die alte Donaustadt fand Anschluss an das Eisenbahnnetz nur mittels einer West-Ostverbindung, eine Linie, die überdies nur eingleisig ausgebaut war.
Der Standortnachteil, den die bayerische Verkehrspolitik eingebracht hatte, wirkte sich auf die wirtschaftliche Entwicklung Neuburgs aus. Das verarbeitende Gewerbe blieb lange Zeit schwach ausgeprägt, noch in den 1930ern war im Grunde einzig die Erschließung der am nördlichen Stadtrand lagernden Kieselerde-Vorkommen von Bedeutung. Angesichts des Defizits in puncto Industrialisierung darf es somit auch nicht verwundern, dass sich vor 1914 eine organisierte Arbeiterbewegung nur rudimentär ausgebildet hatte. Zwar hatte sich bereits 1903 ein Ortsverein der SPD konstituiert, ihr Nischendasein in Neuburg – 4,6 Prozent bei der Landtagswahl 1907 – konnte die Sozialdemokratie allerdings erst nach dem Weltkrieg überwinden.[6]
Als Folge der ausbleibenden Industrialisierung stagnierte auch die Einwohnerzahl Neuburgs. Zwischen 1840 und 1900 wuchs die städtische Bevölkerung nur um 26,5 Prozent, von 6350 auf 8030 Personen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum nahm die Einwohnerzahl Ingolstadts um 140 Prozent von gut 9.000 auf mehr als 22.000 Personen zu, stieg die Zahl der Bürger Regensburgs um 130 Prozent von 20.000 auf 46.000. Ein merklicher demographischer Schub war erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen, als 4.000 Heimatvertriebene zuwanderten.[7]
Belebend auf die lokale Ökonomie wirkte sich hingegen das Militär aus. Seit 1868 war in Neuburg das knapp anderthalb Jahrhunderte zuvor in Donauwörth aufgestellte „Königlich-Bayerische 15. Infanterie-Regiment“ stationiert. Der Umstand, dass die Einheit ihren Friedensstandort in Neuburg hatte, führte unter anderem dazu, dass sich die Stadtbevölkerung zeitweise bis zu einem Drittel aus Militärpersonen zusammensetzte. Der Verlust der Garnison im Gefolge des Versailler Friedens 1919 brachte deshalb enorme wirtschaftliche Nachteile mit sich.[8]
Was die politischen Verhältnisse anbelangt, so zeigt sich Neuburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts fest in der Hand des konservativen katholischen Bürgertums. Bei der Landtagswahl 1912 etwa erreichte Martin Loibl, der Kandidat des Zentrums 58 Prozent der Stimmen, während die Liberalen mit 28 Prozent bzw. die SPD mit 13,6 Prozent abgeschlagen auf dem 2. Und 3. Platz landeten.[9]
Seit napoleonischen Zeiten befand sich Neuburg etwas abseits der großen strukturhistorischen Entwicklungen. Die Stadt war Provinz: sehr bürgerlich, sehr konservativ, sehr traditionell. Abgesehen von der Rolle, die das Militär spielte, kann die ehemalige Residenz somit als repräsentativ für das kleinstädtische Bayern des frühen 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Für diejenigen jedoch, die die vergangene Größe und Bedeutung Neuburgs verinnerlicht hatten, konnte die urbane Realität ihrer Heimat kurz vor Ausbruch des Weltkrieges nur unbefriedigend sein.
Theater – Kino
Wie wirkten sich die beschriebenen Faktoren im Alltag der Stadt aus? Wie dominant war der katholische Konservatismus, das Bildungsbürgertum in Wirklichkeit? Standen nicht auch die Zeichen auf Fortschritt? Wer waren die Protagonisten einer kulturellen Moderne, von wem gingen entsprechende Impulse aus?
Zentrale Institution traditioneller Bildung und Gelehrsamkeit in Neuburg war das Stadttheater. Keiner anderen kulturellen Einrichtung wurde in Martin Loibls „Neuburger Anzeigeblatt“ mehr Platz eingeräumt. Sowohl Vorberichte zu neuen Inszenierungen, als auch die Kritiken nach den Premieren gestalteten sich ausführlich. Das Stadttheater war ein Ort, an dem sich das Bürgertum mit Hilfe der Klassiker der Dramenliteratur – mitunter auch mit Hilfe kulturkritisch-reaktionärer Inszenierungen – seiner selbst vergewisserte. Dementsprechend nahmen sich Teile des Spielplans aus. So finden sich im Programm für das Jahr 1912 die Komödie „Was Ihr wollt“ von William Shakespeare ebenso wie das Lustspiel „Frauerl“ des nicht unbedingt als Revolutionär verschrienen Autors Alexander Engel, über das selbst das „Anzeigeblatt“ urteilte, dass es nicht besonders „originell“ sei.[10] Weiter finden sich die Posse „Lumpazi-Vagabundus“ von Nestroy, die Lustspiele „Der Heiratsurlaub“ und „Die Hochzeitsreise“, die Operetten „Guten Morgen, Herr Fischer“ und der Walzerkönig“, die komische Oper „Der Waffenschmied“ von Lortzing, die Tragödie „Ghetto“ des jüdisch-holländischen Dichters Heijermans, deren Neuburger Inszenierung anscheinend nicht ganz frei war von Antisemitismus, sowie das Schauspiel „Die Tochter des Fabrizius“ des ehemaligen Wiener Burgtheaterdirektors Adolf von Wilbrandt, dessen Besprechung im „Anzeigeblatt“ in einen Verriss mündete: „Rührseligkeiten ohne psychologischen Untergrund gibt es (…) in Fülle. Die Taschentücher wurden in Anbetracht dieses Umstandes fleißig in Anwendung gebracht.“[11] Anscheinend war man in Neuburg mit dem herkömmlichen Programm des Stadttheaters nicht recht zufrieden, wobei nicht nur die Sprech-, sondern ebenso Musikstücke herber Kritik ausgesetzt waren. Über die Operette „Guten Morgen, Herr Fischer“ urteilte Loibls Presseorgan gar vernichtend: „(…) Handlung unterdurchschnittlich (…) Ein tolles Durcheinander von Unmöglichkeiten, über die man ernsthaft nicht lachen kann; ein großes Arbeiten mit blöden Effekten.“[12]
Nachdem offenkundig bereits längere Zeit Klage darüber geführt worden war, dass der Besuch des Stadttheaters zu wünschen übrig lasse,[13] scheint sich noch im Winter 1912 in der Programmgestaltung eine Wende angebahnt zu haben – weg vom klassischen Repertoire eines kleinstädtischen Theaters mit Operetten, antiquierten Lust- und christlichen Trauerspielen hin zu modernen, regelrecht avantgardistisch anmutenden Formen der darstellenden Kunst. Tatsächlich ist der Spielplan des Stadttheaters Neuburg für das Jahr 1912 alles andere als einseitig. Nicht nur die bereits erwähnten Inszenierungen gelangten zur Darbietung, sondern die Leitung des Hauses zeigte sich auch offen für Neues. Mit expressionistischen Ansätzen wurde experimentiert; Emmy Schneider-Hoffmann, eine zeitgenössisch sehr renommierte Balletttänzerin, war mit ihrem pantomimischen Theater zu Gast; ebenso Madame Hanako vom kaiserlichen Hoftheater in Tokio, die allerdings kurz vor ihrem Auftritt erkrankte – und mit dem „Fuhrmann Henschel“ von Gerhart Hauptmann war auch das naturalistische Drama, das aufgrund seiner freimütigen, teils sozialkritischen Darstellungsweise immer für einen Skandal gut war, auf der Neuburger Bühne vertreten.[14]
Freilich könnte die Vermutung naheliegen, dass die allmähliche Öffnung des Stadttheaters hin zur Avantgarde nicht zuletzt mit dem Aufschwung eines neuen Mediums für darstellende Kunst zusammenhing, mit dem Aufschwung des Kinos – ein Aufschwung, der mit dem „Zentral-Theater“ bereits vor dem Ersten Weltkrieg Neuburg erreicht hatte. Für Kulturpessimisten den Inbegriff einer verachtenswerten neuen Epoche symbolisierend, erwies sich das Kino in der Rosenstraße jedoch alles andere als auf der Höhe der Zeit. Vielmehr verhielt sich die Entwicklung des Zentral-Theater-Programms geradezu gegensätzlich zu jener des Stadttheater-Spielplanes. Wurden in der oberen Stadt, an einem traditionellen Ort der Kunst, zunehmend neue Formen und Inhalte ausprobiert, so wurde im sogenannten „Lichtspielhaus“ unterhalb des Schlosses mit Hilfe moderner Technik der Konservatismus propagiert.
Gewiss wurden anspruchsvolle Filme gezeigt, Melodramen mit der Schauspielerin Asta Nielsen, die während der gesamten Stummfilmzeit zur absoluten Weltspitze in ihrem Fach zählte. Und ebenso gelangten sogenannte „Kunstfilme“ zur Aufführung, die einfach nur die Möglichkeiten des neuen Mediums Kino ausloteten. Aber es wurden in der Rosenstraße eben auch Filme der Öffentlichkeit präsentiert, die eher konservativ-katholischem Kunstverständnis entsprachen – Filme, in die bedenkenlos ebenso jene Zuschauer gehen konnten, die während des Faschingsausklangs dem bunten Treiben in den Straßen und Tanzsälen fernblieben und lieber am 40-stündigen Gebet in der Hofkirche teilnahmen. Religiöse Darstellungen und Heiligenlegenden mit Titeln wie „Das Leben und Leiden Christi“ oder „St. Georg, der Drachentöter“ – es waren derartige Sujets, die für das Kinoprogramm in Neuburg vor 1914 repräsentativ waren.[15]
Musik
Gegensätze, wie sie sich auf der Bühne und auf der Leinwand abzuzeichnen begannen, manifestierten sich ebenso in anderen Bereichen der Kunst, in der Architektur etwa – erwähnt sei die 1901 im Jugendstil erbaute Warmbadeanstalt am Wolfgang-Wilhelm-Platz – oder in ganz besonderer Weise in der Musik. Allerdings kam es in der Konzertsparte nicht zu einer allmählichen Herausforderung der Tradition durch avantgardistische Richtungen, sondern elitärer und volkstümlicher Geschmack standen sich a priori gegenüber.
Einerseits wurde der urbanen Bevölkerung ein umfangreiches Angebot an ernsten musikalischen Darbietungen unterbreitet – ein Angebot, das für eine Kommune von der Größenordnung Neuburgs keineswegs als selbstverständlich zu bezeichnen ist. In diesem Punkt dürften die Vergangenheit der Stadt als Residenz und deren Gegenwart als Truppenstandort zum Tragen gekommen sein. Im ersten Halbjahr 1912 beispielsweise finden sich auf dem Veranstaltungskalender – zusätzlich zu den Standkonzerten des Militärs: Gesangsabende des Liederkranzes, das Konzert eines Pariser Orchesters mit Interpretationen US-amerikanischer Komponisten sowie ein Gastspiel der renommierten Violinistin Ernestine Boucher aus Paris, wobei unter anderem Werke von Bruch, Wolff, Saint-Saëns und Paganini zur Aufführung gelangten.[16]
Freilich war andererseits ebenso das Spektrum an volkstümlicher musikalischer Unterhaltung sehr breit. Mindestens fünf Gaststätten in Neuburg boten regelmäßig Tanzmusiken an – mit zunehmender Tendenz: Wurden 1909 lediglich zwanzig derartige Gesuche eingereicht, so waren es drei Jahre später bereits vierzig.[17] 1912 konnte die erwachsene Bevölkerung Neuburgs somit im Durchschnitt jedes Wochenende, die Advents- und die Fastenzeit ausgenommen, eine Tanzveranstaltung besuchen.
Varieté
Zweifellos war in Neuburg in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg das Bedürfnis nach Amüsement sehr groß, eine Tatsache, die sich nicht zuletzt durch eine Vielzahl von Varieté- Veranstaltungen belegen lässt. Die für die Wende vom 19. Zum 20. Jahrhundert so typische Sensationsgier nach dem Fremden und Exotischen konnte auch in einer Kleinstadt wie Neuburg gestillt werden. Dabei reichte das Angebot vom herkömmlichen Zirkus bis hin zu völlig neuartigen, recht obskur anmutenden Veranstaltungen, aus dem Bereich der Parapsychologie. So traten etwa bis zum Juli des vorletzten Friedensjahres in Neuburg unter anderem auf: Schuhplattler vom Schliersee; ein Okkultist, der angeblich über telepathische Fähigkeiten verfügte; ein Varieté, dessen Hauptattraktion ein indischer „Serpentintanz“ war; sowie ein mobiles Museum für „Anatomie, Ethologie und Naturwissenschaft“, das angeblich Folgendes zur Schau stellte: „geöffnete Körper, asiatische Beulenpest, Cholera, Lepra, Knochenresektionen, Amputationen, [Folgen von] Blitzschlag, Durchschlagskraft eines Stahlmantel-Geschosses, (…) Armbrüche, Beinbrüche“ etc.[18]
Unter all den sensationsheischenden Veranstaltungen, die 1912 beworben wurden, muss ein Spektakel gesondert erwähnt werden: die erste Luftlandung eines Motorflugzeugs bei Neuburg im Juli jenen Jahres. Die Aktion war ein Tribut an die Technikbegeisterung der Zeit – und in der Art und Weise ihrer Rezeption war sie ein Beleg dafür, dass sich Tradition und Moderne, Reaktion und Fortschritt keineswegs ausschließen mussten. Tatsächlich waren es vor allem bürgerlich-konservative Kreise, die den Fortschritt zur Luft in überschwänglichen, von Pathos geradezu strotzenden Worten feierten. Zitat aus dem „Anzeigeblatt“ Martin Loibls, auf dessen Initiative hin die Landung zustande gekommen war:[19]
„Durch die Münchener Straße, durch die Feldkirchener Durchfahrt strömte Neuburg auf den morgendlichen Plan. Fußvolk und Stahlreiter. Zur Vervollständigung der sportlichen Stimmung Wagen und Automobile. (…) Längs der Straße standen sie und harrten. Nicht sehr lange. Ein surrendes Geräusch, erst in weiter Ferne, ähnlich dem der Automobile, dann schärferes und grelles Knattern eines Flugzeugmotors. Wer’s einmal gehört hat, den durchzuckts. Hoch oben die Straße entlang, kam es sausend aus dem Nebel heran, eine elegante Biegung, ein steiler Abstieg – noch sahen die Insassen wie Puppen, das Ganze wie Spielzeug aus – mitten in der Wiese, ruhig, leicht, fast zart steht ein moderner Aeroplan (…)
Neuburg hat erlebt, wovon die Menschheit seit Jahrtausenden geträumt. Der große Atem der neuen Zeit brauste über uns[,] der Zeit, die das Gold und Silber blasser Mythen in Stahl der Wirklichkeit wandelt. Und wir können beinahe (…) in Variation eines uralten Wortes enthusiastisch ausrufen: Volare necesse est – vivere non necesse! (Fliegen müssen wir, aber Leben ist uns keine Notwendigkeit).“[20]
Vereinswesen
Ein Aspekt des Freizeitgeschehens, der insbesondere in den letzten Dekaden vor Ausbruch des Weltkrieges gesellschaftlich von Bedeutung war, wurde bisher nicht thematisiert: das Vereinswesen. Im Neuburg des frühen 20. Jahrhunderts gab es vielfältige Möglichkeiten, sich in einem Verein zu engagieren. Es gab „Urformen“, die dieser Ausprägung der Bürgerlichkeit ihre Gestalt gegeben hatten, mit anderen Worten: Gesangs- und Turnvereine.[21] Daneben aber existierten ebenso ausgesprochen reaktionäre Vereine, die katholische Jugend etwa, die regelrechte Kulturkämpfe gegen Emanzipationsbestrebungen der Frau und gegen die Sozialdemokratie führte,[22] sowie nationalistische Organisationen, die auf dem äußersten rechten Rand des politischen und kulturellen Spektrums anzusiedeln waren.
Zwei Ableger jener reichsweit agierenden Verbände – Ortsgruppen des Wehrkraftvereins (gegründet 1911) und des Deutschen Flottenvereins – entfalteten in der ehemaligen Residenzstadt rege Aktivitäten. Ihre Zielsetzung sahen beide Gruppierungen darin, konservative Kreise, auch die bürgerliche Jugend, auf einen neuen, in ihren Augen unvermeidlichen Krieg einzuschwören. Zu diesem Zweck veranstaltete der Wehrkraftverein im Gymnasium Vortragsabende, auf welchen in glorifizierender Weise über den Krieg gegen Frankreich 1870/71 oder über Kriege in den Kolonien referiert wurde, und hielt der Flottenverein Lichtbildervorträge zu dem etwas weit hergeholten Thema „Heldentaten der deutschen Marine“ ab.[23] Wohlwollend begleitet wiederum wurden derartige Veranstaltungen von der Berichterstattung des „Anzeigeblattes“, dessen Herausgeber Martin Loibl aufgrund seiner Offiziersausbildung bei den „Fünfzehnern“ wohl selbst zum Kreis der Nationalisten und Militaristen zu zählen war.
Abgesehen von den traditionellen Organisationen und vaterländischen Gruppierungen, taten sich in den letzten Jahren vor dem Krieg auch Vereine hervor, die auf neuartige Weise versuchten, Freizeit zu organisieren – Vereine, deren Existenz durch die zunehmende Mobilisierung der Bevölkerung möglich wurde, oder die in Konkurrenz zu den Turnern entstanden waren. Es gab in Neuburg auch eine Sektion des Deutschen Alpenvereins, die seit 1906 eine Hütte in den Stubaier Alpen unterhielt, einen Ring- und Stemm-Club und einen Schwimmverein.[24] Letzterer veranstaltete Ende Juni 1912 ein sogenanntes „Propaganda-Schwimmen“, das sämtliche damals in der Sportart gängigen Wettbewerbe aufwies.[25] Ob mit dieser Veranstaltung auch ein Kontrapunkt zum Gau-Fest der eher konservativ ausgerichteten Turner gesetzt werden sollte, das im Mai des gleichen Jahres aus Anlass des 50. Gründungsjubiläums des Turnvereins von 1862 in Neuburg stattfand,[26] mag dahingestellt sein.
Kriminalität
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wies Neuburg den Charakter einer beschaulichen Kleinstadt auf. Dementsprechend sicher konnten sich die Bürger in den Straßen und in der Öffentlichkeit bewegen. Dennoch sind für den Untersuchungszeitraum einige spektakuläre Kriminalfälle dokumentiert, die Fragen aufwerfen:
Noch in den Dezember 1911 fiel eine Messerstecherei mit Todesfolge, die sich in der Nähe des Schlosses ereignet hatte. Der Täter wurde wenige Monate später zu vierzehn Jahren Haft verurteilt. Gleich zu Beginn des Jahres 1912 musste ein Flickschneider wegen an einem Kind verübten Sittlichkeitsverbrechen für sieben Monate ins Gefängnis. Es handelte sich um einen Wiederholungstäter. Zu einer weiteren Messerstecherei kam es am Faschingsdienstag 1912 vor einer Gaststätte. Mitte März schoss in einem Joshofener Wirtshaus ein betrunkener Dienstknecht um sich und verletzte einen der Gäste schwer, wobei laut dem „Anzeigenblatt“ die übrigen Zecher noch an Ort und Stelle Selbstjustiz übten: „Der allgemeinen Empörung über die rohe Tat wurde dadurch Ausdruck gegeben, daß man [den Dienstknecht] weidlich durchprügelte, so daß er sich in das Krankenhaus der [Barmherzigen] Brüder begeben musste.“ Vom Juni 1912 datiert erneut eine Messerstecherei, auch diese Tat trug sich in Kreisen der Dienstknechtschaft zu. Noch im gleichen Monat wurde in der Nähe von Neuburg ein Schreinermeister von einem Jugendlichen erstochen und Anfang Juli schließlich kam es in einem Waldstück bei Neuburg zu einer versuchten Vergewaltigung einer „Tagelöhnersfrau“.[27]
Die Berufsgruppen, denen die meisten Täter, aber auch zahlreiche Opfer zuzurechnen waren, scheinen die Vermutung nahezulegen, dass in den unteren Bereichen der gesellschaftlichen Schichtung Neuburgs ein hohes Aggressionspotenzial vorhanden war. Ausgehend von dieser Annahme, könnte die Schlussfolgerung zutreffen, dass es nicht zuletzt die Zwänge der bürgerlichen Lebenswirklichkeit der Vorkriegsjahre waren, die von Zeit zu Zeit zu einem unkontrollierten Gewaltausbruch führten. Dabei war in Neuburg gewiss nicht nur gesellschaftliche Repression verantwortlich zu machen waren, sondern ebenso die Tatsache, dass weniger wohlhabenden Schichten oftmals, auch sehr unverblümt, mit Verachtung begegnet wurde. Der Männer-Turnverein beispielsweise veranstaltete jedes Jahr im Fasching einen sogenannten „Dienstbotenball“, in dem man sich über diese Berufsgruppe lustig machte.[28] Ausgehend von einer derartigen Einstellung war es meist nur ein Schritt hin bis zur offenen Diskriminierung – in Neuburg besonders ausgeprägt durch die hervorgehobene Rolle des Militärs. In Offizierskreis etwa galten Dienstmädchen lediglich als „Prostituierte“, die stationierte Soldaten mit Geschlechtskrankheiten anstecken würden.[29]
Gesundheitsfürsorge
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wies in vielen deutschen Städten die öffentliche Gesundheitsfürsorge eklatante Defizite auf. Darunter zu leiden hatte vor allem die weniger gut situierte Bevölkerung, auch in Neuburg. Wenn in den Krankenhäusern der Stadt junge Frauen an Knochenentzündungen starben, wenn dort 25-jährige Dienstknechte an den Folgen einer Entzündung im Rachenbereich dahinsiechten und wenn im Jahre 1912 die Einführung einer Müllabfuhr deshalb scheiterte, weil die Bürger alles selbst hätten bezahlen müssen und sich darum nur 30 Haushalte beteiligen wollten,[30] dann wirft dies kein gutes Licht auf die Gesundheitspolitik und auf die Fürsorgepflicht der Kommune. Unter denjenigen jedenfalls, die von diesen Zuständen zunächst betroffen waren, dürfte sich, verstärkt durch ihre soziale Deklassierung, ein erhebliches Frustrationspotential ausbildet haben.
Freilich richtete sich der Unmut nie gegen die lokale Obrigkeit. Als im November 1918 auch an der Donau für die progressiven Kräfte der Zeitpunkt gekommen wäre, die Machtfrage zu stellen, erwies sich Neuburg als ein Musterbeispiel an Ruhe und Ordnung. Bürgermeister und Magistrat blieben im Amt, während sich die örtliche Sozialdemokratie für den Schutz des Privateigentums aussprach und sich gegen jede Form des Radikalismus wandte.[31] Das lange Verharren in überkommenen gesellschaftlichen Verhältnissen schien zunächst auch in Neuburg über den Epochenbruch Erster Weltkrieg hinauszuwirken.
Ausblick
Neuburg im Jahr 1912 – eine Kleinstadt zwischen Tradition und Moderne, wobei die Zeichen einer neuen Zeit noch eher schwach zu vernehmen waren. Aber sie waren gleichwohl unübersehbar, vor allem im kulturellen Leben der Stadt. Noch einige Jahre sollten diesem relativ beschaulichen Dasein vergönnt sein, bevor die Folgen des Weltkrieges letztlich doch für einschneidende Veränderungen sorgten. Schien es im Frühjahr 1919 nach Waffenstillstand und Revolution zunächst, als seien die Umwälzungen, die die Metropolen Mitteleuropas erfasst hatten, an der Kleinstadt Neuburg fast spurlos vorübergegangen, so machte spätestens der Vertrag von Versailles deutlich, dass dies nicht der Fall war. Der Einschnitt kam mit der erzwungenen Abrüstung, die der Friedensschluss vorsah und dem der Garnisonsstandort Neuburg zum Opfer fiel.
Die Auswirkungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges veränderten den Alltag der Stadt gänzlich. Die gesellschaftliche Neuformierung, die die deutsche Terrorherrschaft über Europa mit sich brachte, machte auch an der Donau nicht halt. Die Ankunft von Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebenen setzte einen Bevölkerungsanstieg in Gang, führte zu bis dahin ungeahnten Aktivitäten im Wohnungsbau und resultierte seit den fünfziger Jahren in einer planmäßigen Ansiedlung von Industriebetrieben. Allmählich entstand das heutige Bild Neuburgs.
[1] Unter den Neuerscheinungen zum Ersten Weltkrieg am ausführlichsten: Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, München 2014.
[2] Exemplarisch dazu: Martin H. Geyer: Verkehrte Welt Revolution, Inflation und Moderne, München 1914-1924, Göttingen 1998.
[3] Vgl. Rudolf Oswald, „Fußball-Volksgemeinschaft“. Ideologie, Politik und Fanatismus im deutschen Fußball 1919-1964, Frankfurt a.M., New York 2008, 94ff.; Matthias Marschik, Topographie der freien Zeit, in: SWS-Rundschau 33 (1993), H. 3, 353-363.
[4] Vgl. etwa: Justus H. Ulbricht, „Wege nach Weimar“ und „deutsche Wiedergeburt“: Visionen kultureller Hegemonie im völkischen Netzwerk Thüringens zwischen Jahrhundertwende und „Drittem Reich“, in: Wolfgang Bialas und Burkhard Stenzel (Hg.), Die Weimarer Republik zwischen Metropole und Provinz, Weimar, Köln, Wien 1996, 23-35.
[5] Vgl. Oswald, „Fußball-Volksgemeinschaft“, 51f.
[6] Vgl. Wolfgang Wollny, Die Neuburger Arbeiterbewegung zwischen 1918 und 1945, in: Barbara Zeitelhack u.a. (Hg.), Umbrüche. Leben in Neuburg und Umgebung 1918-1948. Ausstellung des Stadtmuseums Neuburg an der Donau vom 28. März bis 5. Oktober 2008, Neuburg a.d. Donau 2008, 97f.
[7] Dazu die einschlägigen online-zugänglichen Statistiken.
[8] Thomas Menzel: Neuburg an der Donau als Militärstandort, in: Zeitelhack, Umbrüche (wie Anm. 6), 49f.
[9] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 7.2.1912.
[10] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 18.1.1912, 24.1.1912 und 28.1.1912.
[11] Zu den einzelnen Inszenierungen und Besprechungen: Neuburger Anzeigeblatt, 30.1.1912, 8.2.1912, 22.2.1912, 2.3.1912, 10.3.1912, 16.3.1912, 21.3.1912, 28.3.1912 und 31.3.1912. Über die männliche Hauptfigur von Heijermans Tragödie „Ghetto“ war im „Anzeigeblatt“ vom 19.3.1912 zu lesen: „Ihn ekelt das Treiben seiner jüdischen Stammesbrüder an.“
[12] Neuburger Anzeigeblatt, 28.3.1912.
[13] Vgl. etwa: Neuburger Anzeigeblatt, 3.3.1912.
[14] Zu den genannten Veranstaltungen: Neuburger Anzeigeblatt, 22.2.1912, 12.3.1912, 17.3.1912 und 25.4.1912.
[15] Vgl. etwa: Neuburger Anzeigeblatt, 4.1.1912, 5.1.1912, 17.2.1912, 2.3.1912, 30.3.1912, 6.4.1912, 14.4.1912, 20.4.1912, 27.4.1912, 4.5.1912, 12.5.1912, 1.6.1912, 8.6.1912, 15.6.1912, 22.6. 1912 und 21.7.1912.
[16] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 6.1.1912, 18.1.1912, 21.1.1912 und 13.4.1912.
[17] Vgl. Tanzmusik-Bewilligungen 1906-1920, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1561 I).
[18] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 17.1.1912, 25.1.1912, 6.4.1912, 7.7.1912 [Zit. ebd.] und 18.7.1912.
[19] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 12.7.1912.
[20] Vgl. Zeitungsartikel o. Dat., Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (669).
[21] Vgl. Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (3036 und 3014) sowie die einschlägigen Artikel des „Neuburger Anzeigeblattes“ zur Gesangsvereinigung „Liederkranz“.
[22] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 25.4.1912, 2.6.1912, 4.6.1912 und 15.6.1912.
[23] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 17.1.1912, 4.4.1912, 12.4.1912 und 15.5.1912.
[24] Vgl. Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1563, 3030 und 3039).
[25] Vgl. Programm zum „Propaganda-Schwimmfest“ am 30.6.1912, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1563).
[26] Vgl. Turnverein Neuburg a.D. an den hohen Stadtmagistrat der Stadt Neuburg a.D., 10.3. 1912 und 21.3.1912; Festprogramm zum 50 jährigen Jubiläum, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (3014).
[27] Zu den einzelnen Delikten: Neuburger Anzeigeblatt, 3.1.1912, 22.2.1912, 5.3.1912, 24.3.1912 [Zit. ebd.], 9.6.1912, 26.1.1912 und 3.7.1912.
[28] Vgl. Neuburger Anzeigeblatt, 2.2.1912.
[29] Vgl. dazu etwa: Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (2943).
[30] Zu den einzelnen Missständen vgl. die entsprechenden amts- und bezirksärztlichen Gutachten, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (3884). Zur Müllproblematik in Neuburg vor dem Ersten Weltkrieg vgl. Bekanntmachung des Stadtmagistrats vom 9.4.1912 und Beschluss vom 6.5.1912, Stadtarchiv Neuburg a.d. Donau, XX 02 (1009).
[31] Vgl. Wollny, Arbeiterbewegung (wie Anm. 6), 99f.
Quelle: http://neuburg.hypotheses.org/236








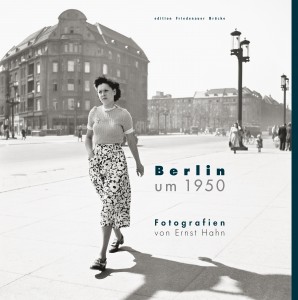



 Die Formung eines Körpers ist immer eine Begegnung der konkreten Materie mit immateriellen Ordnungspraktiken wie Moral, Gesundheit oder Vernunft. Von dieser Prämisse geht
Die Formung eines Körpers ist immer eine Begegnung der konkreten Materie mit immateriellen Ordnungspraktiken wie Moral, Gesundheit oder Vernunft. Von dieser Prämisse geht