Wilma’s Tutorials sind die Produkte des Projekts “Let’s Learn – Screencasts zu Studien-, Lern- und Arbeitstechniken von Studierenden für Studierende”. Prezi Basics – die zoomende Präsentationssoftware In diesem Video wird die online Präsentationssoftware Prezi vorgestellt. Bis zu 10 Personen können damit gemeinsam eine professionelle Präsentation erstellen oder bearbeiten. In diesem ersten Video-Tutorial zum Thema werden die Basics des Programms erklärt: Wie es funktioniert und aufgebaut ist. Das Skript zum Video-Tutorial zu den Prezi-Basics ist hier als PDF Dokument verfügbar. Weitere Informationen und Kontakt: Wenn […]
Spiritualität und Alltag: Eine Geschichte des zisterziensischen Frauenklosters Günterstal im 15. und 16. Jahrhundert
Gastbeitrag von Edmund Wareham (Jesus College, Oxford/Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.)
Im Mittelpunkt meiner Forschung steht ein Notizenbuch der Küsterin und zweier anderer unbekannter Nonnen aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert. Dieser Band (Karlsruhe, Generallandesarchiv Abt. 65/247) aus 54 Papierblättern berichtet von zahlreichen Ereignissen (von 1480 bis 1519), von Klosterbräuchen verschiedenster Art und schildert die Hauswirtschaft des Klosters einschließlich Kochrezepten, Schnittmustern, einer Almosenordnung und Neujahrsgeschenken. Ein Bücherverzeichnis aus dem Jahre 1457 ist auch in der Handschrift erhalten. In Verbindung mit anderen Quellen aus dem Kloster einschließlich der erhaltenen Handschriften und Inkunabeln, Bildmaterial, Gerichtsprotokollen, Besitzurkunden und Visitationsberichten aus dem sechzehnten Jahrhundert, habe ich vor, die Entwicklung der Spiritualität der Nonnen in einem Zeitalter der monastischen Reform und der Reformation zu untersuchen. Ich interessiere mich dafür, wie der Körper, die Sinne, materielle Kultur und Raum sich gegenseitig beeinflussen, um diese Spiritualität zu entwickeln und wie sie sich im Alltagsleben manifestierte.
Die Gliederung meiner Doktorarbeit basiert auf einem Zitat aus einem Abschnitt des Notizenbuchs, in dem zwei Priester einer sterbenden Nonne die Sterbesakramente austeilen. Einer der Priester segnet die Nonne „an die ougen, an die oren, an die naßen, an den mund, an die hend, an dz herz und an die füß“. Jedes Kapitel der Arbeit wird auf einem Körperteil basieren. Das Kapitel „die ougen“ wird die visuelle Umgebung des Frauenklosters untersuchen. Die im Freiburger Augustinermuseum aufbewahrten Günterstaler Altartafeln, die illustrierten Handschriften und Büchern und die Hinweise in dem Notizenbuch auf die Architektur und die Verzierung des Konvents werden dabei unter die Lupe genommen. In dem Kapitel „an die oren“ wird die akustische Umgebung diskutiert. Im Mittelpunkt des Interesses steht in diesem Abschnitt die Bedeutung der Glocken, des Singens und Schweigens im alltäglichen Leben der Nonnen. In dem Kapitel „an den naßen“ wird der Geruchssinn der Nonnen untersucht. Der Weihrauch spielte eine wichtige Rolle im Gottesdienst und die Kochrezepte enthalten etliche Hinweise auf Gewürze. Dies führt zum Kapitel „an den mund“, in dem die Kochrezepte und Beschreibungen von Festmählern beim Besuch wichtiger Personen wie beispielsweise des Weihbischofs, des Abts von Salem oder des päpstlichen Kommissars im Mittelpunkt stehen werden. Im fünften Kapitel „an den hend“, werde ich mich mit den Listen von Neujahrgeschenken (inklusive Handschuhe!), der Almosenordnung und den Spenden für das Kloster befassen. Dies führt zu der Frage, wie die Nonnen das Konzept von Klausur verstanden haben. Das Kapitel „an das herz“, wird sich mit dem Hauptproblem der Arbeit, Spiritualität, befassen und die erhaltene andächtige Literatur des Klosters in Betracht ziehen. Das abschließende Kapitel, „an die füß“ wird Umzüge und geistliche Pilgerfahrten innerhalb der Klostermauern und die Einflüsse der Bundschuh-Bewegung und des Bauernkriegs auf das Kloster betrachten.
In der Forschung wurde viel über die Texte der sogenannten Frauenmystik, wie Viten und dominikanische Schwesternbücher, geschrieben. Dank der Arbeit von Forscherinnen wie Eva Schlotheuber1 sowie Anne Winston-Allen2 und Charlotte Woodford3 aus dem angelsächsischen Raum gibt es aber ein zunehmendes Interesse an von Frauen selbst geschriebenen, konventsinternen Dokumenten. Das Günterstaler Notizenbuch ist ein naheliegendes Beispiel dafür. Quellen wie Tagesbücher, Chroniken und Rechnungsbücher sind genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, als mystische Texte für unser Verständnis von Erziehung, Alltagsleben und Spiritualität von Nonnen in dieser Epoche.
- Klostereintritt und Bildung. Die Lebenswelt der Nonnen im späten Mittelalter. Mit einer Edition des ‚Konventstagebuchs‘ einer Zisterzienserin von Heilig-Kreuz bei Braunschweig (1484-1507) (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 24), Tübingen 2004.
- Convent Chronicles: Women Writing about Women and Reform in the Late Middle Ages, University Park, Pennsylvania 2004.
- Nuns as Historians in Early Modern Germany, Oxford 2002.
Digital Humanities Conference 2014 – Begegnungen, Gespräche und Geschichten
Gut zwei Wochen nach dem Ende der Digital Humanities Konferenz in Lausanne sind im Internet bereits viele Berichte, Videos, Präsentationen, Visualisierungen, gesammelte Tweets und weitere Materialien zur Konferenz zu finden.1 Auch infoclio.ch beteiligt sich an der Dokumentation der Konferenz. In den nächsten Tagen werden wir die Tagungsberichte unseres Reporting-Teams aufschalten.
Legende und Geschichte – die römische Königszeit, Teil 2
 |
| Münze mit dem Abbild Tullus Hostilius |
 |
| Kampf gegen Veji und Fidernae |
 |
| Schwur der Horatier |
 |
| Münze mit Abbild Ancus Marcius |
Ancus Marcius repräsentiert mehr oder weniger die Konsolidierungsphase Roms. Die Kriege gegen die Latiner dienten wie zu Romulus Zeiten der Vergrößerung der Bevölkerung, die einfach im eigenen Territorium angesiedelt wurde (und das Bürgerrecht erhielt). Das römische Bürgerrecht dient hier bereits als eine Art Zuckerbrot, das begleitend zum Gebrauch der militärischen Peitsche benutzt wird.
Gleichzeitig aber sind die anderen in Ancus Marcius fallenden Vorgänge interessant. Seine weiteren Stadtbefestigungen vergrößerten und konsolidierten das römische Siedlungs- und Wirtschaftsgebiet. So schloss er den Hügel Janiculum an Rom an, der westlich des Tibers lag und trotz seiner Größe nicht zu den ursprünglichen "Sieben Hügeln" von Rom zählt. Hierzu wurde eine Brücke gebaut, die die römische Dominanz beider Tiber-Ufer besiegelte. Neue Stadtbefestigungen und ein öffentliches Gefängnis zementierten diesen Status Quo auch gegen Feinde der öffentlichen Ordnung.
 |
| Marktplatz in Ostia (GNU 1.2 FoekeNoppert) |
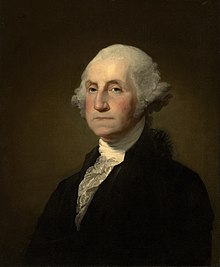 |
| George Washington |
Alfred Heuss - Römische Geschichte
Simon Baker - Rom - Aufstieg und Untergang einer Weltmacht
Martin Jehne - Die römische Republik - Von der Gründung bis Caesar
Guy de la Bedoyere - Die Römer für Dummies
Quelle: http://geschichts-blog.blogspot.com/2014/07/legende-und-geschichte-die-romische.html
aventinus media Nr. 17 [15.07.2014]: Europäische Geschichte Online (EGO), betrb. v. Institut für europäische Geschichte Mainz [=Skriptum 3 (2013) Nr. 2, S. 98-102]
Regards sur les ghettos

Ghetto Lodz, ca. 1940-1944, Hans Biebow, Leiter der NS-Verwaltung des Ghettos Litzmannstadt, und ein unbekannter jüdischer Mann
Foto: Walter Genewein
Im Pariser Mémorial de la Shoah ist noch bis Ende September 2014 eine Visual History der Ghettos zu sehen. Die Sonderausstellung „Regards sur les ghettos“ zeigt über 500 Ghetto-Fotografien in Schwarz-Weiß und Farbe aus drei Kameraperspektiven: die der jüdischen Ghetto-Insassen, die der deutschen Soldaten und der deutschen Propagandakompanien. Bei jeder einzelnen Fotografie versuchen die Ausstellungsmacher, den Fotografen zu benennen, seine Motivation und die genauen Umstände der Aufnahme zu klären sowie Aussagen zur Überlieferungsgeschichte zu liefern, ja selbst das Modell und die Besitzverhältnisse des Fotoapparates zu kennzeichnen.
Die eindrucksvolle und bislang einmalige Gesamtschau der Ghetto-Fotografie wurde im November 2013 von der deutschen Botschafterin in Frankreich feierlich eröffnet. Die Ausstellungsgestalter und Kuratoren, zu denen auch der Holocaustüberlebende Roman Polański gehörte, entschieden sich in der Ausstellungsgestaltung meist für vergrößerte Reproduktionen der Fotografien, die nach Ghetto-Orten und Fotografen gruppiert frei von Deckenschienen herabgehangen wurden.
Das Mémorial hat eine eigene Internetseite zur Ausstellung gestaltet, die ansprechend, funktional und informativ Inhalte und Fotografien wiedergibt sowie Informationen zu dem umfangreichen wissenschaftlichen Begleitprogramm der Exposition enthält. Der aufwändig gestaltete Katalog dürfte die bislang größte Fülle an Ghetto-Fotografien nebst Informationen zu ihrer Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte aufweisen und könnte neue Forschungsimpulse gerade für die Geschichte kleinerer, unbekannterer Ghettos liefern.
Siehe zur Ausstellung und zum Katalog auch die Rezension von René Schlott auf H-Soz-u-Kult vom 12.4.2014
Mémorial de la Shoah Musée, Centre de documentation: Regards sur les ghettos. Scenes from the Ghetto, 13.11.2013-28.09.2014, Paris
Quelle: http://www.visual-history.de/2014/07/15/regards-sur-les-ghettos/
„Zürcher Erklärung zur digitalen Kunstgeschichte“ veröffentlicht
Wie hier im Blog bereits angekündigt, hat die Tagung „Digitale Kunstgeschichte: Herausforderungen und Perspektiven“ vom 26. und 27. Juni 2014 in acht Workshops fachspezifische Positionen und Forderungen zu drängenden Fragestellungen im Zeichen des digitalen Wandels erarbeitet und als Endergebnis die „Zürcher Erklärung zur digitalen Kunstgeschichte“ veröffentlicht, die den Anliegen der kunstwissenschaftlichen Community Ausdruck gibt.
Weitere Informationen und die Möglichkeit die Erklärung zu unterzeichnen gibt es unter: http://sik-isea.ch/Aktuell/Veranstaltungen/DigitalArtHistory/tabid/359/Default.aspx
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=3801
Ein streitbarer Gelehrter
Wenn von Humanisten die Rede ist, denkt man an Gelehrte, die vor allem ihr perfektes klassisches Latein schulen, ansonsten aber eine eher weltabgewandte Existenz führen. Das mag es gegeben haben, doch nahmen viele dieser Gelehrten lebhaften Anteil an den Debatten ihrer Zeit und prägten sie auch mit. Dies gilt in ganz besonderem Maße für Kaspar Schoppe, der seine Gelehrsamkeit für zahlreiche polemische Attacken im konfessionellen Streit des frühen 17. Jahrhunderts einsetzte. Ursprünglich stammte Schoppe aus einer protestantischen Familie in der Oberpfalz, doch konvertierte er, knapp 22jährig, 1598 zum Katholizismus. Schon damals hatte er begonnen, sich mit seinen philologischen Studien einen Namen zu machen. Doch ein ruhiges Gelehrtenleben war nicht seine Sache; konfessioneller Furor, nicht ganz untypisch für Konvertiten, und Streitlust verschafften ihm eine Berühmtheit von zweifelhaftem Ruf: Seine Publikationen machten ihn teilweise so verhaßt, daß er sich im Reich nicht mehr sicher fühlte und bereits vor Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs nach Italien ging. Dort lebte und wirkte er an verschiedenen Orten, bis er sich 1635 in Padua niederließ, wo er bis zu seinem Tod 1649 bleiben sollte.
Schoppe erlebte also nicht nur den Dreißigjährigen Krieg bis zu seinem Ende, sondern hatte auch die Vorkriegszeit mit ihrer sich ständig weiter aufheizenden konfessionellen Spannung miterlebt – und beschränkte er sich dabei nicht nur auf die Rolle eines Zuschauers, sondern gestaltete die Phase auch mit. Er begeisterte sich für die Idee, daß sich die katholischen Reichsfürsten in einem Sonderbund zusammenschließen, wie es dann in der Katholischen Liga geschah (vergleiche den Aufsatz von Franziska Neuer-Landfried), und half mit seiner Publizistik eifrig mit, die Tonart zwischen den Konfessionsparteien zu verschärfen: sein berüchtigtes „Classicum belli sacri“ von 1619 war nichts weniger als ein Aufruf zum Krieg gegen den Protestantismus; die lateinische Urfassung wurde auch rasch in deutscher Übersetzung verbreitet als „Alarm zum Religions-Krieg in Teutschland“. Seine Schriften – und genauso die harschen Gegenreaktionen, die er damit hervorrief – sind mittlerweile sehr gut über das VD17 zu recherchieren. Doch gibt es neben den publizistischen Zeugnissen auch eine Autobiographie und einen umfänglichen Briefwechsel, die mittlerweile in sieben stattlichen Bänden ediert vorliegen. Für diese Edition zeichnet Klaus Jaitner verantwortlich, der diesen Quellenkorpus zwischen 2004 und 2012 herausgegeben hat.
Unter dem Titel „Philotheca Scioppiana“ ragt besonders die Autobiographie hervor, die Schoppe 1585 einsetzen ließ (es war das Jahr, als er in Amberg das Pädagogicum besuchte) und bis zum Jahr 1630 fortführte; hier beschreibt er noch den Regensburger Kurfürstentag (er war damals selbst vor Ort), bevor dieses Werk unvermittelt abbricht. Hinzu kommen knapp 1.500 Briefe, die einen Zeitraum von Anfang 1595 bis August 1649 abdecken. Aus diesen Zeugnissen erschließt sich ein schillerndes Bild der miterlebten Jahre; auch auf viele zeitgenössische Persönlichkeiten fällt ein Schlaglicht – nicht unbedingt immer ein positives: Ferdinand II. erfährt keine sonderlich schmeichelhafte Würdigung, ihm wirft Schoppe vor, allzu sehr von jesuitischen Einflüsterungen abhängig zu sein. Dafür belegt der Humanist den Feldherrn Tilly, den er noch 1630 in Regensburg getroffen hatte, mit den ehrenden Beinamen eines Gideon und Judas Maccabäus – Streiter für den Glauben, wie er es auch bei Tilly sah.
Die Philoteca ist natürlich in lateinischer Sprache verfaßt (in der Edition ist allerdings eine deutsche Übersetzung beigefügt), auch die Korrespondenz ist vor allem auf Italienisch und Lateinisch gehalten, wenige Briefe in deutscher und spanischer Sprache. Das mag mühselig erscheinen, doch einem Humanisten kommt man nun einmal nur auf diese Weise nahe. Immerhin bietet jetzt eine kurze, aber illustrative Würdigung der Edition von Alexander Koller in den QFIAB eine erste Einführung zu diesen Schriften Schoppes: Die Freiheit von Wort und Schrift. Zur Edition der Autobiographie und der Korrespondenz des Philologen und politisch-konfessionellen Grenzgängers Kaspar Schoppe (1576-1649), in: QFIAB 93 (2013), S. 363–376 (der vollständige Text wird auf perspectivia.net im März 2015 erscheinen können).
Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/495
Mittelalterliche Unsinnsdichtung
Von achtzehn Wachteln und dem Finkenritter. Deutsche Unsinnsdichtung des Mittelalters. Mittelhochdeutsch / Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hg. von Horst Brunner. Stuttgart: Reclam Verlag, 2014. [Verlags-Info]

