»Cancel Culture« im Kulturbetrieb?
#Satire
Es gibt im deutschen Medien- und Kulturbetrieb wohl kein Gerichtsurteil, das derart skurril und gleichzeitig lebensnah erscheint wie das sogenannte »Penis-Urteil« in der Auseinandersetzung zwischen Kai Diekmann, damals noch Chefredakteur der Bild und der Tageszeitung (taz).
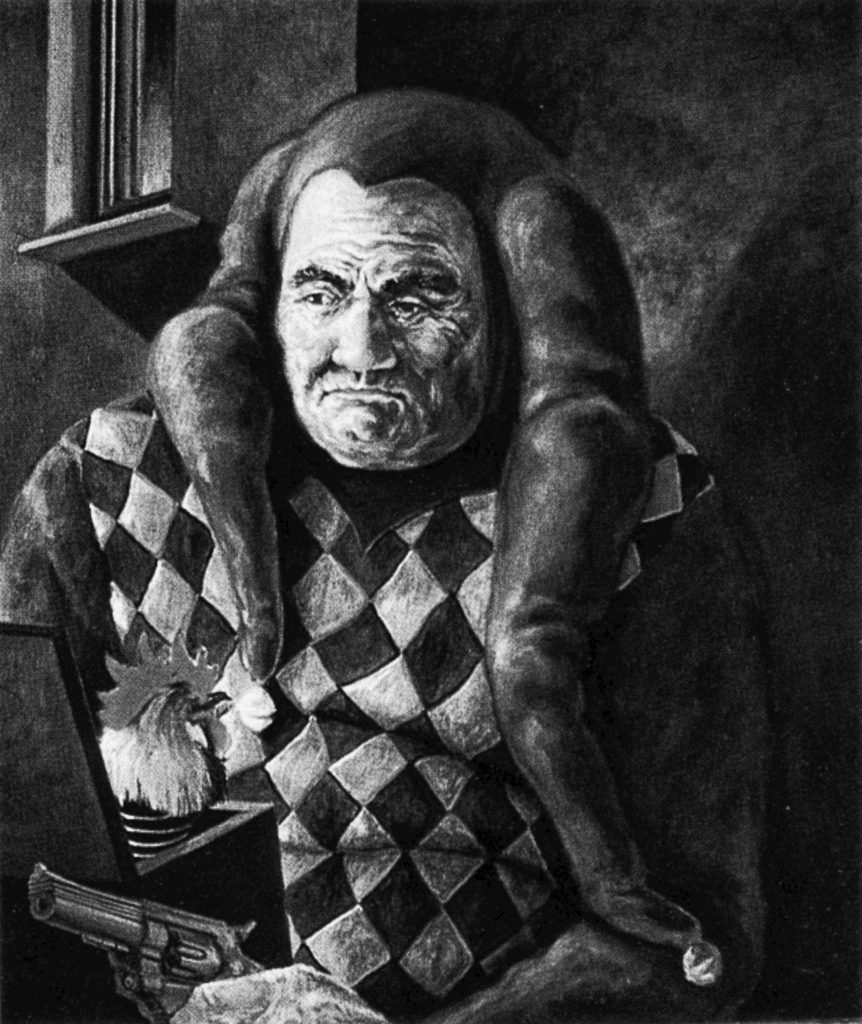
Ja, richtig gelesen: »Penis-Urteil«. Alles begann damit, dass die Tageszeitung in ihrer Satire-Rubrik »Die Wahrheit« einen Text über Diekmanns missglückte Penis-Verlängerung veröffentlichte. Die Operation selbst und die »Spezialklinik in Miami« waren genauso frei erfunden wie die Titelzeile: »Sex-Schock! Penis kaputt«. Der gesamte Beitrag war ungefähr so subtil wie eine rostige Wasserrohrzange. Kai Diekmann war wenig begeistert und ging vor Gericht. Der salomonische Richter untersagte der Tageszeitung die weitere Veröffentlichung des Textes, wies aber auch das geforderte Schmerzensgeld in Höhe von 30.000 Euro gegenüber Diekmann ab. Ein Urteil, mit dem beide Parteien gut leben konnten.
Bis die Urteilsbegründung zugestellt wurde. Darin heißt es unter anderem, dass »gegen das Bedürfnis für eine Geldentschädigung (spricht), dass der Kläger Chefredakteur der Bild-Zeitung ist«. In dieser werden laut Kammer »häufig persönlichkeitsrechtsverletzende Beiträge veröffentlicht«, für die der Kläger in »äußerungsrechtlicher Hinsicht verantwortlich« ist. Sinngemäß heißt es weiter in der Urteilsbegründung: Wer seinen wirtschaftlichen Vorteil daraus zieht, dass er andere Menschen fertig macht, deren Persönlichkeitsrecht verletzt und oftmals in deren Intimsphäre eindringt, muss damit zurechtkommen, wenn man diese Machenschaften satirisch auf’s Korn nimmt. Man könnte es auch so formulieren wie es die Großmutter immer getan hat: »Wer austeilt, muss auch einstecken können.« Dass das nicht unbedingt jedem gelingt, sieht man, höchst offiziell und mit richterlichem Segen, am obigen Beispiel. Diekmann verzichtete auf weitere Rechtsmittel und die Satiriker der Deutschen Presseagentur titelten »Keine Verlängerung des ›Penis-Prozesses‹«.
Von den vielen Pausenhofweisheiten, die einem im Leben so unterkommen, ist das vielleicht die wichtigste. Wer hart gegen andere Menschen urteilt, sollte auch mit Kritik an der eigenen Person umgehen können. Alles andere wäre unsouverän und gelinde gesagt auch ziemlich peinlich.
Nun, sagen wir mal so: Diekmann ist alles andere als ein Einzelfall. Eine gewisse Alice Weidel beispielsweise rief während eines Bundesparteitages der »Alternative für Deutschland« (AfD) unter lautem Applaus folgendes: »Wir werden uns als Demokraten und als Patrioten nicht den Mund verbieten lassen. Denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte!« Als es wenige Tage später in der Satiresendung extra3 hieß »Jawoll, Schluss mit der politischen Korrektheit! Lasst uns alle unkorrekt sein, da hat die Nazi-Schlampe doch recht!« war Alice Weidel von dieser derartig politischen Unkorrektheit allerdings wenig begeistert. Ähnlich wie Kai Diekmann vor 15 Jahren ging auch sie gegen die Satire vor und reichte beim Landgericht Hamburg einen Antrag auf Unterlassung ein. Der Antrag wurde abgewiesen, die Begründung des Gerichts ist durchaus lesenswert. Darin heißt es, dass der Bezug zu »Nazi« darin seinen Grund finde, dass »Alice Weidel als Spitzenkandidatin einer Partei auftritt, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit eher als Partei des rechten, teilweise auch sehr rechten Spektrums wahrgenommen wird«. Für den Begriff »Schlampe« war offensichtlich »allein die Forderung, die politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen, Anlass für ihre Verbreitung«.
Dass gerade diejenigen besonders dünnhäutig auf Gegenwind und politisch unkorrekte Grenzüberschreitung reagieren, die mit ihrer Politik und ihrer Berichterstattung tagtäglich Menschen ausgrenzen und die Diskriminierung von Minderheiten zum erträglichen Geschäftsmodell erheben, ist der größte Witz in Tüten. Wenn Chefredakteure der Bild und Fraktionsvorsitzende der AfD ausnahmsweise selbst einmal (satirisch!) betroffen sind von hässlichen Worten und wenig schmeichelhafter Berichterstattung, hört man schnelle Bekundungen über den Schutz der Persönlichkeit, den Schutz der Privatsphäre und die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde.
Schutzrechte, die den Opfern der Bild und der AfD selten bis niemals zugestanden werden.
Diese beiden Geschichten sprechen nicht nur Bände über die Austeil- und Einsteckfähigkeiten der radikalen Rechten in Deutschland, sie zeigen auch, dass der deutschen Gesellschaft – und ihrer Richterschaft! – noch eine andere Pausenhofweisheit wichtig ist: »Wenn jemand am Boden liegt, tritt man nicht nach.« Das wiederum führt geradewegs zur Frage, was Satire eigentlich ist und was Satire uneigentlich darf.
Wer diese Frage einigermaßen umfänglich beantworten möchte, muss sich der geschichtlichen Urform der Satire nähern: Der Narretei. Bei Hof erfüllte der Narr zweierlei Funktionen. Einerseits diente er Königen und Fürsten durch seine Künste, seine Tollpatschigkeit und seine Belustigungen der kurzweiligen Unterhaltung. Andererseits oblag es ihm, der höfischen Macht ein Gegengewicht entgegenzusetzen und die politischen Entwicklungen kritisch zu kommentieren. Vom Spott des Narren waren auch die Mächtigen nicht ausgenommen, was als »Narrenfreiheit« noch heute die Satire definiert, wenn es heißt »Satire darf alles!«.
Aus dieser Ausprägung der Narrenfreiheit und der Kritik gegen die Herrschenden entwickelten sich institutionalisierte Formen von Humor und Satire wie Fastnacht und Karneval, wo in Volksfesten gegen »die da oben« gelacht wird. Wo jeder sein »Fett weg bekommt« und wo »kein Blatt vor den Mund« genommen wird.
Die Narretei entwickelte allerdings auch eine andere, dunkle Seite. Eine, die nicht die gesellschaftlichen Umstände und die Obrigkeiten, sondern die Marginalisierten und Ausgegrenzten verlachte. So wurden über Jahrhunderte hinweg Kleinwüchsige, »Elefantenmenschen« und Schwarze im Zirkus und auf Jahrmärkten vorgeführt. Sie wurden angekettet und in Käfige gesperrt. Sie wurden entrechtet und entmenschlicht. Sie wurden zur Schau gestellt und als Abnormitäten des menschlichen Lebens dem Hohn und Spott geopfert. Ihren Höhepunkt fand diese abscheuliche Menschenverachtung in der Darstellung der Juden, die als geldgierige Unmenschen mit langen Nasen und spitzen Händen portraitiert wurden, um die gleichzeitig stattfindende Ausgrenzung und Vernichtung allen jüdischen Lebens zu begleiten. Das alles sollte man wissen, wenn man über Satire spricht.
Die humorvolle Kritik des Alltäglichen und die satirische Beobachtung des Menschlichen ist heute genauso anerkannter Teil der Satire wie die Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Der Tritt nach unten hingegen, die Diskriminierung und Ausgrenzung von Armen, Schwachen und all jenen, die ohnehin der alltäglichen Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt sind, wird heute glücklicherweise kritisch begleitet und nicht mehr als Teil irgendeiner Kunstform hingenommen. Die Ausstellungen der Schwarzen in Käfigen und die Darstellungen der Juden im »Stürmer« gehören glücklicherweise der Vergangenheit an.
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Das scheint nur leider nicht bei allen angekommen zu sein. Wie schwer es für Nachkriegsdeutsche sein muss, in Liedtexten auf antisemitische Erzählungen zu verzichten, sieht man am Beispiel der deutschen Kabarettistin Lisa Fitz. Sie veröffentlichte 2018 ein Lied, in dem sie die »Rothschilds, Rockefeller, Soros & Consorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten« für eine fieser werdende Welt verantwortlich macht. Man muss nun wahrhaftig kein Experte für antisemitische Verschwörungstheorien sein, um den antisemitischen Grundgehalt dieses Liedes festzustellen. Die Veröffentlichung im YouTube-Kanal eines Verschwörungstheoretikers passt zudem zum Grußwort, das Fitz 2017 anlässlich der Verleihung des Kölner Karls-Preises an den antisemitischen Verschwörungsideologen Ken Jebsen verfasste. Ach ja: Lisa Fitz bekam 2019 den Bayerischen Verdienstorden für ihre Arbeit und durfte im Dezember 2020 im SWR einen Kabarettbeitrag zum Thema »Verschwörungstheorien« zum Besten geben. Kein Witz.
Ihre Kollegin Lisa Eckhart ist ebenfalls weder Antisemitin noch Rassistin, zumindest nach eigenem Bekunden. »Nimmt man von allen Ching-Chongs die Ding-Dongs und legt sie nebeneinander auf, hat man etwa die Länge einer kongolesischen Vorhaut.«, ist beispielsweise so ein angeblich völlig un-rasstischer Gag in ihrem Programm. In einem weiteren angeblich nicht-antisemitischen Stück aus ihrem Programm fallen Sätze wie: »(den Juden) geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld. Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. (…) Den Juden Reparationen zu zahlen, das ist, wie dem Mateschitz ein Red Bull auszugeben. (…) Die heilige Kuh hat BSE.«
Der WDR sieht darin weder Rassismus noch Antisemitismus am Werk. Im Gegensatz zum Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, dem Direktor des American Jewish Committee in Berlin, dem Bundesverband Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS), dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA), der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) und vielen weiteren jüdischen Verbänden und Einzelpersonen. Was natürlich alles nichts zu bedeuten hat, schließlich kann es sein, dass sich die Programmdirektoren des WDR einfach besser mit Judenfeindlichkeit auskennen als die Jüdinnen und Juden selbst.
Ein Beispiel für die enorm schwierige Abgrenzung zu Rechtsradikalen und Neonazis ist der Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle. Nach eigenem Bekunden ist Steimle mit der rassistischen PEGIDA-Bewegung zärtlich verbunden. Zur besten Sendezeit fragt er im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch schon mal, »wieso die Amerikaner und Israelis Kriege anzetteln und wir Deutsche den Scheiß bezahlen dürfen«. Seine Theorie, dass die Deutschen in einem »besetzten Land« lebten und von Menschen wie Marietta Slomka und Claus Cleber ferngesteuert und in Unfreiheit gehalten würden, verbreitet er zudem gerne in Presseorganen wie dem Propagandasender des russischen Staates »Russia Today« oder bei »COMPACT«, »Junge Freiheit« und »Tichys Einblick«. All dieser Dinge zum Trotz hielt der MDR an seinem Star-Komiker fest, nahm ihn in Schutz und wiegelte ab. Selbst als er sich mit einem schwarz-rot-weißen »Kraft durch Freunde«-T-Shirt ablichten ließ, wies der Sender darauf hin, dass Steimle Kabarettist und Satiriker sei. Man achte darauf, »dass seine Satire auch als solche erkennbar ist«.
Steimle musste erst den öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst angreifen und dessen Unabhängigkeit infrage stellen, bis der MDR schlussendlich eingriff und ihn vor die Tür setzte. Nicht der Flirt mit Rechtsradikalen und wiederholte antisemitische Reminiszenz führten zum Rausschmiss, sondern erst die Kritik am eigenen Arbeitgeber.
Interessanterweise war es auch im Falle Steimles wieder ein Richter, der all dies bereits früh richtig einzuordnen wusste. Als der freie Journalist Andreas Vorrath Steimle einen »völkisch-antisemitischen Jammer-Ossi« nannte, zog dieser vor Gericht und wollte dies verbieten lassen. Der Richter hingegen meinte, Steimle habe »wiederholt Vorlagen geliefert, die eine solche Meinung zuließen« und wies die Klage ab.
Lisa Fitz, Lisa Eckhart und Uwe Steimle gelten in ihrer Funktion als vollkommen un-antisemitische und un-rassistische Komiker*innen gleichzeitig als Kronzeugen für eine »Cancel Culture«, die angeblich in Deutschland ihr Unwesen treibe. Sie tilge alle diejenigen aus dem öffentlichen Sichtfeld und dem nationalen Gedächtnis, die nicht gewillt seien, dem »linken Mainstream« und dem »linken Zeitgeist« zu huldigen.
Was genau diese »Cancel Culture« allerdings sein soll und wer ihr bisher zum Opfer gefallen wäre, ist unbekannt oder streng geheim. Die Redaktion der Welt am Sonntag versuchte sich unlängst an einer Auflistung all derjenigen, die dem »Cancel Culture«-Blutbad erlegen sind und veröffentlichte unfreiwilligerweise nur das Gegenteil dessen, was sie eigentlich beweisen wollte. Keine »Cancel Culture«. Nirgendwo.
Lisa Fitz wurde nach (!) ihrer antisemitischen Grenzüberschreitung mit Preisen geehrt und trat ohne jede Einschränkung im öffentlichen Fernsehen weiter auf. Lisa Eckhart kann diejenigen Sendeformate, in denen sie ihr neues Buch noch nicht vorgestellt hat, nur noch an einer halben Hand aufzählen. Und Uwe Steimle wirkte nach seinen zahlreichen Skandalen geradezu überrascht, als der MDR verlauten ließ, er sehe keinen Grund sich von seinem Komiker trennen. Was sich wie gesagt erst später und aus deutlich anderen Gründen ändern sollte – fünf Jahre (!) nachdem ein Zeitungsportrait über Uwe Steimle erschien, das den Titel »Fernsehkabarett – Da wo der Antisemitismus blüht« trägt.
Antisemitismus und Rassismus als Satire-Programm, der beherzte Tritt nach unten gegen diejenigen, die ohnehin Diskriminierung und Rassismus erfahren, während man gleichzeitig jede Kritik am eigenen Tabubruch zur »Cancel Culture« hochstilisiert und nicht damit umzugehen weiß, wenn man an Menschenwürde und Anstand erinnert wird – all dies ist bemerkens- und beklagenswert. Dass wir als Gesellschaft diesen gefährlichen Unfug nicht hinzunehmen bereit sind, ist dagegen ein gutes Zeichen.
Wie weit aber das Gerede von der »Cancel Culture« bereits gediehen ist, sieht man am Beispiel Dieter Nuhrs besonders deutlich. Nuhr, der wie kein anderer in seinen Sendungen den Tabubruch und die Kontroverse zelebriert, meinte in mehreren Sendungen zur Kritik an seiner Person: »Der Shitstorm ist ja quasi (…) die humane Variante des Pogroms.« Auf die ungläubige Nachfrage des Interviewpartners führt Nuhr weiter fort: »(…) ich habe ja extra gesagt, die humane Variante –, weil es geht nur um die soziale Vernichtung. (…) die humane Variante funktioniert so, wie auch ein Pogrom funktioniert. Nur dass das Pogrom in der richtigen Welt funktioniert hat und zur physischen Vernichtung geführt hat, und das will ich keinesfalls vergleichen.« Ein Pogrom. Die humane Variante eines Pogroms.
Ausgerechnet diejenigen, deren Eltern- und Großelterngeneration für Reichspogromnacht und Holocaust verantwortlich sind, die in ihren Satiresendungen ohne jegliches Schamgefühl denselben großelterlichen Antisemitismus befördern und die von öffentlichen Geldern alimentiert ihre Menschenfeindlichkeit in die Welt hinausschreien, haben nun allen Ernstes das Gefühl selbst ausgegrenzt, verfolgt und vernichtet zu werden. Humane Variante eines Pogroms. Kein Witz.Wer noch immer nicht weiß, was Satire darf, dem sei gesagt: das nicht. Vielleicht würde es der gesamten Debatte um Kunst, Kultur, Satirefreiheit und »Cancel Culture« auch einfach guttun, wenn man die bereits erwähnten Lebensweisheiten der Großmutter berücksichtigte:
1. Wer austeilt, muss auch einstecken können.
2. Wenn einer am Boden liegt, tritt man nicht nach.
Damit ließen sich dann auch Penis-Urteile und humane Pogrome verhindern.
Der Beitrag »Cancel Culture« im Kulturbetrieb? erschien zuerst auf der rechte rand.
AfD: Heteronormativ statt homofeindlich
#Homosexualität
Die Verfolgung männlicher und die Negation weiblicher Homosexualität waren lange Zeit Konsens in der bundesdeutschen Gesellschaft wie auch in der extremen Rechten. 1994 wurde der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches endgültig gestrichen, 2001 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt und 2017 die Ehe für homosexuelle Paare erlaubt.
In ihrer familien- und geschlechterpolitischen Programmatik äußert sich die »Alternative für Deutschland« (AfD) selten offen homofeindlich, sondern, wie es der Kulturwissenschaftler Patrick Wielowiejski formuliert, »heteronormativ«. So erklärt die Partei in ihrem Europa-Wahlprogramm 2019: »Alle Personen haben das Recht, ihren Lebensstand frei zu wählen. Andere Formen des Zusammenlebens als die Ehe zwischen Mann und Frau sind zu respektieren, damit aber weder gleichzusetzen noch zu fördern.« Dieses Zitat zeigt eine gewisse Anerkennung von homosexuellen Lebensweisen, was gleich darauf jedoch durch den Hinweis eingeschränkt wird, Homosexualität könne niemals ein gleichberechtigter Teil der Norm sein. Sie soll freilich, wie es die AfD Sachsen formuliert, »nicht mehr Raum einnehmen, als sie im Alltagsleben hat«. Homosexuellen Lebensweisen wird damit eine randständige Existenz zugewiesen, die sich unterzuordnen habe.
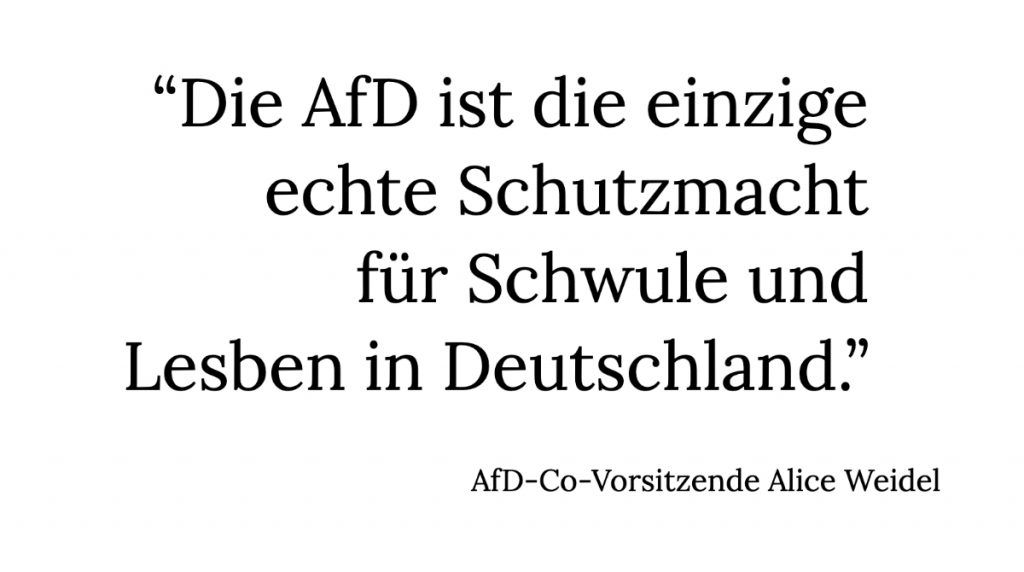
Leitbild der heterosexuellen Mehrkinderfamilie
Das Bekenntnis zum Leitbild der Familie aus Mutter, Vater und mehreren Kindern steht seit 2017 im Zentrum der Familienprogrammatik der AfD in den verschiedenen Landes-, Europa- und Bundeswahlprogrammen. Familien sollen als »Keimzelle der Gesellschaft« die biologische und kulturelle Reproduktion des deutschen Volkes als Abstammungs- und Wertegemeinschaft langfristig garantieren. Im Programm zur Bundestagswahl 2021 bekennt sich die Partei überdies zum »Leitbild der 3-Kind-Familie (sic!)« , um dem demografischen und »ethnisch-kulturellen« Wandel entgegenzuwirken: »Mehr Kinder statt Masseneinwanderung«, hatte die Partei bereits 2016 in ihrem Grundsatzprogramm formuliert. Diese Losung richtet sich sowohl gegen migrantische und migrantisierte Familien als auch gegen Regenbogenfamilien.
Ablehnung des Adoptionsrechtes für homosexuelle Paare
Die AfD fordert in ihrem Europa-Wahlprogramm 2019, die »privilegierte Position von Vater und Mutter (müsse) im Hinblick auf den Schutz des Kindeswohls (…) in vollem Umfang erhalten werden«. Imaginierten »Adoptionsquoten für gleichgeschlechtliche Paare« hält sie entgegen, Kinder seien »keine Objekte der Bedürfnisbefriedigung, sondern eigenständige Persönlichkeiten mit individuellen Rechten«.
Der Verweis auf den vermeintlichen Schutz des Kindeswohls dient der Partei als moralische Waffe zur Legitimierung der eigenen Ablehnung von homosexueller Elternschaft. Rhetorisch wird eine Nähe zwischen Homosexualität und Pädophilie hergestellt, wie sie in christlich-konservativen und extrem rechten Kreisen immer wieder behauptet wird und vor der es die Kinder zu schützen gelte. Und auch jenseits des Pädophilie-Vorwurfs wird schlicht behauptet, Kinder bräuchten Mutter und Vater, ohne dies näher zu begründen oder gar die Situation von Kindern aus Regenbogenfamilien miteinzubeziehen.
Die Ablehnung homosexueller Elternschaft gründet sich auf der verbreiteten Ansicht, Familie sei dort, wo Kinder sind. Die zunehmende rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Normalisierung von Regenbogenfamilien stellt aus dieser Perspektive die Hegemonie der heterosexuellen Mehrkinderfamilie infrage. An der Frage der Kinder entscheidet sich also die von der AfD eingeforderte Unterscheidung von Homosexualität als akzeptierte, aber deviante Lebensform oder die abgelehnte Toleranz von Homosexualität als Teil der kulturellen Norm. Eben diese (statisch imaginierte) Norm sieht die AfD durch eine kulturkämpferische Gender-Bewegung bedroht. Aufgrund der antifeministischen Konstruktion eines omnipotenten, die heterosexuelle Norm bedrohenden Feminismus schlägt Patrick Wielowiejski die verfremdete Schreibweise »/G/ender« vor. Diese stellt die in antifeministischen Kreisen verbreitete Aussprache mit /g/ als Anlaut heraus und macht deutlich, dass es sich hierbei um eine (extrem) rechte Umdeutung, nicht aber um das soziologische Konzept »Gender« handelt.
Feindbild »Gender«
Aktuelle antifeministische Strategien aufgreifend beklagt die AfD einen Kulturkampf, der die Auflösung von Cis-Geschlechtlichkeit und Heterosexualität sowie die Zerstörung der heterosexuellen Mehrkinderfamilie zum Ziel habe. Diesen Kampf verortet die Partei sowohl in gleichstellungspolitischen Projekten als auch in den Gender Studies, in gendersensiblen Sprachregelungen, in der Sexualpädagogik der Vielfalt und in der 2017 beschlossenen Ehe für homosexuelle Paare. Gender wird dabei als omnipotente (homosexuelle) Macht konstruiert, gegen welche die eigene Freiheit behauptet werden müsse.
Diese imaginäre Umkehrung der Machtverhältnisse ermöglicht es der AfD, sich weiter vehement auf das Leitbild der heterosexuellen Mehrkinderfamilie zu beziehen und eine vermeintliche Opferposition einzunehmen. Überdies erlaubt die Konstruktion des Feindbildes Gender der Partei eine Trennung zwischen »guten« Homosexuellen, die die Norm nicht infrage stellen, und »schlechten« Queers, die die soziale Ordnung bedrohen würden. Auf diese Weise kann die Partei dem Vorwurf der Homofeindlichkeit – mit den Worten des neu-Rechten Martin »Lichtmesz« Semlitsch ein »zentraler Hebel im homosexuellen Kulturkampf« – wirkungsvoll begegnen.
Islamfeindliche Homofreundlichkeit
Neben Gender ist auch der Islam im Kontext Homosexualität ein wichtiges Feindbild der AfD. Vor diesem gelte es, die »guten« Homosexuellen zu schützen. Homofeindlichkeit wird in den Programmen der AfD ausschließlich in Abgrenzung zu einem als homogen und homofeindlich konstruierten Islam thematisiert. In diesem Zusammenhang wird die Akzeptanz von Homosexualität, die zuvor in enge Schranken verwiesen wurde, zu einem vermeintlich »nationalen Wert«, den es gegenüber dem muslimischen Anderen zu verteidigen gelte. Diese Akzeptanz homosexueller Lebensweisen bleibt dabei stets prekär und an diverse Bedingungen geknüpft.
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Homosexuelle Mitglieder in der AfD
In der AfD gibt es diverse offen homosexuelle Mitglieder, sowohl an der Parteibasis als auch in der Führungsriege. Manche von ihnen waren oder sind Teil einer explizit homosexuellen Parteigruppierung, viele haben sich jedoch dagegen entschieden, da sich ihre Handlungsmöglichkeiten und -grenzen mit der Einnahme einer kollektiven homosexuellen Sprecher*innenposition verändern.
Die erste dezidiert homosexuelle Gruppierung in der Partei war die »Bundesinteressengemeinschaft Homosexuelle in der AfD« (BIG), die von 2014 bis 2017 existierte. Die BIG hatte sich zunächst dafür eingesetzt, die AfD solle die Volladoption für homosexuelle Paare fordern. Diese Forderung stieß in der Partei auf viel Kritik und wurde nach Bernd Luckes Austritt 2015 nicht mehr offen formuliert. Stattdessen sah es der damalige Sprecher Mirko Welsch 2016 als Aufgabe der BIG an, die AfD gegen den Vorwurf der Homofeindlichkeit zu verteidigen und homosexuelle Wähler*innen zu gewinnen. Zentrale Themen der BIG waren zu dieser Zeit die vermeintliche Islamisierung als Gefahr für Homosexuelle und trans* Personen sowie die Ablehnung von Gender. Bei den Themen Ehe und Familie herrschte Uneinigkeit in der BIG. Während einige Mitglieder lediglich den Status quo erhalten wollten, erklärte Welsch, man müsse die heterosexuelle Kleinfamilie schützen. Die BIG setze sich aber dennoch für ein Ende der Diskriminierung von Alleinerziehenden, Patchwork- und Regenbogenfamilien ein. Im Januar 2017 spalteten sich schließlich jene BIG-Mitglieder ab, die dem völkisch-nationalistischen »Flügel« nahestanden. Sie gründeten die »schwul-lesbische Plattform«, aus der schließlich die »Alternative Homosexuelle« (AHO) hervorging.
Die AHO ersetzt die BIG in Fragen der homosexuellen Ablehnung von Gender, insbesondere der gleichgeschlechtlichen Ehe und des Adoptionsrechtes. Zudem betreibt sie aktiv eine homonationalistische Abwertung eines als homofeindlich begriffenen Islams in Abgrenzung zur vermeintlich homofreundlichen deutschen Nation. Kritik an parteiinterner Homofeindlichkeit findet sich hier nicht. Stattdessen positioniert sich die AHO offensiv im nationalen »Wir«: »Denn Schwulen und Lesben liegt Deutschland genau so sehr am Herzen wie jedem anderen liebenden Menschen mit einem Bezug zu Familie, Heimat und Nation!« Im Gegenzug bekommt die AHO Unterstützung durch die Parteiführung, etwa durch einen Besuch des ehemaligen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen auf ihrer Jahrestagung 2018.
Es ist dabei sicherlich kein Zufall, dass dieser Besuch durch den vermutlich heterosexuellen Jörg Meuthen und nicht durch die offen lesbische Co-Vorsitzende Alice Weidel erfolgte. Deren Distanz zu politisch organisierten Homosexuellen erlaubt es ihr, eine andere Sprecher*innenposition in der Partei einzunehmen.
Homosexuelle Einzelpersonen in der AfD
Ähnlich wie es Aufgabe der BIG und der AHO war und ist, die Partei vor dem Vorwurf der Homofeindlichkeit zu schützen, scheint dies auch ein Anspruch von nicht-organisierten homosexuellen Einzelpersonen in der AfD zu sein. Besonders medienwirksam tat dies Weidel 2017 bei einer Wahlkampfrede in Viernheim. Nach ihrem dortigen Outing fragte sie die anwesenden Parteiunterstützer*innen in betont sarkastischem Ton: »Jemand hier, der mich hasst? Nein? Kein einziger hier, der es nicht erträgt, dass ich mein Leben mit einer Frau verbringe? Puh, vielen Dank.«
Zudem betonen offen homosexuelle AfD-Politiker*innen stets die vermeintliche Bedrohung homosexueller Menschen durch die steigende Zahl von Muslim*a in Deutschland und spielen die anhaltende Homofeindlichkeit unter christlichen Deutschen herunter. So erklärte der stellvertretende Vorsitzende der NRW-Landtagsfraktion Sven Tritschler 2017, die »völlig fehlgeleitete Migrations- und Integrationspolitik (setze Homosexuelle) nämlich Gefahren aus, die eine Verurteilung nach § 175 geradezu harmlos erscheinen lassen«.
Auch bemühen sich homosexuelle AfD-Politiker*innen um die Gewinnung homosexueller Wähler*innen. Weidel ließ sich im Wahlkampf 2017 mit den Worten zitieren: »Die AfD ist die einzige echte Schutzmacht für Schwule und Lesben in Deutschland.«
Ein Unterschied zu den Möglichkeiten und Grenzen homosexueller Gruppierungen in der AfD zeigt sich bei der Thematisierung von Ehe und Familie. Diesbezüglich erklärte Weidel, sie »ganz persönlich begrüße jede Verbesserung der Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, auch im Zweifel gegen die Mehrheitsmeinung meiner eigenen Partei. So viel Freiheit gestehe ich mir ein.« Allerdings relativiert sie ihre Aussage sogleich, indem sie darauf verweist, es könne »den Schwulen und Lesben in diesem Land (…) am Ende des Tages völlig egal sein, ob ihre Beziehung ‹eingetragene Lebenspartnerschaft› heißt oder Ehe, wenn sie sich kaum noch Arm in Arm auf die Straße trauen können«. Weidel äußert hier ihre Einstellung zu Ehe und Familie zwar sichtbar, jedoch zugleich als »persönliche Meinung«. Sie spricht als homosexuelle Einzelperson und betont, sie habe keine Ambitionen, familienpolitische Sprecherin der Partei zu werden. Darüber hinaus verweist sie auf den Islam als gemeinsamen Feind, dessen Bekämpfung wichtiger sei als der Ausbau der Rechte für Homosexuelle. Sie suggeriert innerparteiliche Meinungsdiversität und Toleranz, ohne letztlich den Status quo auf der Ebene politischer Veränderungen in Frage zu stellen.
Heteronormativ statt homofeindlich
Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu einer voranschreitenden Anerkennung von Homosexualität spiegelt sich in der Programmatik der AfD in einer teilweisen Akzeptanz einer angepassten, privaten Form von Homosexualität, welche die Norm der heterosexuellen Mehrkinderfamilie nicht infrage stellt und keine politischen Freiheitsrechte fordert. Insbesondere die rechtliche Gleichstellung mit der heterosexuellen Ehe und die Adoption von Kindern stellen weiterhin, der offiziellen Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare zum Trotz, klare Grenzen dar. In der Benennung und Bekämpfung von Gender und dem Islam als gemeinsame Feinde kann diese Form der Homosexualität Teil der nationalen Gemeinschaft werden.
Offen homosexuelle Parteimitglieder müssen ihre Partei vor dem Vorwurf der Homofeindlichkeit schützen, stattdessen den Islam als zentralen Feind ausmachen und damit homosexuelle Wähler*innen gewinnen. Wenn eine kollektive homosexuelle Sprecher*innenposition eingenommen wird, gilt es zudem, jede Form von rechtlicher oder politischer Verbesserung für homosexuelle Menschen unter dem Begriff Gender aktiv abzulehnen und innerparteiliche Homofeindlichkeit zu akzeptieren, um keine Gefahr für die heterosexuelle Norm darzustellen. Als homosexuelle Einzelperson hingegen kann ein Ausbau homosexueller Rechte als »freie Meinung« geäußert werden, solange damit keine Forderungen nach politischer Umsetzung verbunden werden.
Der Beitrag AfD: Heteronormativ statt homofeindlich erschien zuerst auf der rechte rand.
Farm Hall Transcripts Reconsidered
Abstract
The Farm Hall Transcripts appeared to offer a unique opportunity for a study in the history and sociology of science. My request for access to the transcripts was initially denied, but later was allowed thanks to the intervention of British intellectuals. The recorded opinions of the interned German scientists indicate that initially they had attempted to produce a nuclear weapon, but later abandoned it. The record also traces their development of a view of history, by which the relative morality of the German scientists’ work could be judged, versus that of the Allies.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202280104?af=R
Did Werner Heisenberg Understand How Atomic Bombs Worked?
Abstract
Drawing upon primary sources and using a comparison with the American Manhattan Project for context, this article examines the question whether Werner Heisenberg understood how atomic bombs work.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202100032?af=R
The Drama of Farm Hall: A Historian Ventures into Play Writing
Abstract
In this paper, the author, a historian, describes the challenges he encountered as he sought to turn the Farm Hall event and its surviving transcripts into a theatrical play. The play, Farm Hall, was produced in New York in 2014 and published in Cassidy 2017. This paper further discusses what the author learned about the nature and elements of a play, how he applied those lessons to his play, and the advantages and disadvantages of this genre for bringing historical events to the general public.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202100034?af=R
Editorial
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202280105?af=R
Commentary: New Directions in the History of Ethology
Abstract
This welcome set of original and instructive papers illuminates and enriches the history of twentieth-century ethology in multiple ways. It adds a wealth of actors, animals, methods, and places to those featured in previous treatments of ethology's development. Some of the papers extend the chronology beyond the heyday of ethology's disciplinary construction to consider exciting developments in the 1970s and beyond. Others consider animal behavior research programs pursued contemporaneously with but independently of mainline ethology's development from the 1930s through the 1960s. Another paper takes us inside an ethologist's archive of visual images to examine the importance of such images (and such a setting) for ethological practice. Collectively, the papers provide new opportunities to contemplate how research programs and disciplines evolve; the relations between concepts, practices, and places; ethology and politics, and much more. At the same time, the individuality of the papers is conspicuous. They have not been constructed on the same model. The authors have followed their own approaches, corresponding to their own, respective interests. A short commentary is not sufficient to do justice to each of them. Rather than attempt to review them one by one, I will consider a pair of themes that may help relate the papers to each other and to the history of ethology: (1) the ongoing challenge of defining ethology and identifying who the ethologists were (or are); (2) the practices and places of animal behavior study.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202280103?af=R
Farm Hall—Another Look
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202200031?af=R

