Breaking the Code: Political Control and the Humanities in 1960 s Bulgaria
Abstract
Certain tendencies in Bulgarian academia in the 1960s are explored as constituting a decisive moment in the emancipation of scientific authority from the intrusion of communist political power. With the focus on aesthetics, the major tenet is that, in the face of repression, specific theoretical approaches and currents of thought emerged that proved effective in dismantling dogma and boosting scientific authority vis-à-vis ideological control. Although open clashes with the repressive machinery of the communist regime certainly played a role in advancing the autonomy of science while on the other hand networks existed that allowed the clashes to be resolved in favor of science, emphasis here is on the deliberate shaping of an academic ethos and the implementation of modes of thinking, theoretical tools, and stances that were resilient to control and demonstrated their superiority to dogma. In 1960s aesthetics, this process involved battles surrounding the dogmatic conceptualization of reflection by Stalinist philosopher Todor Pavlov. A theorization of art as the production of freedom emerged in the course of these battles—a theorization which might, in fact, be crucial for this production and therefore a necessary condition for an otherwise fragile potentiality.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bewi.202100006?af=R
Nicht alle Mittel sind sinnvoll
#Stiftung
Wird der Verfassungsschutz zum Schiedsrichter über die Politische Bildung? Kritische Anmerkungen zur Kampagne gegen die AfD-nahe »Desiderius-Erasmus-Stiftung«.
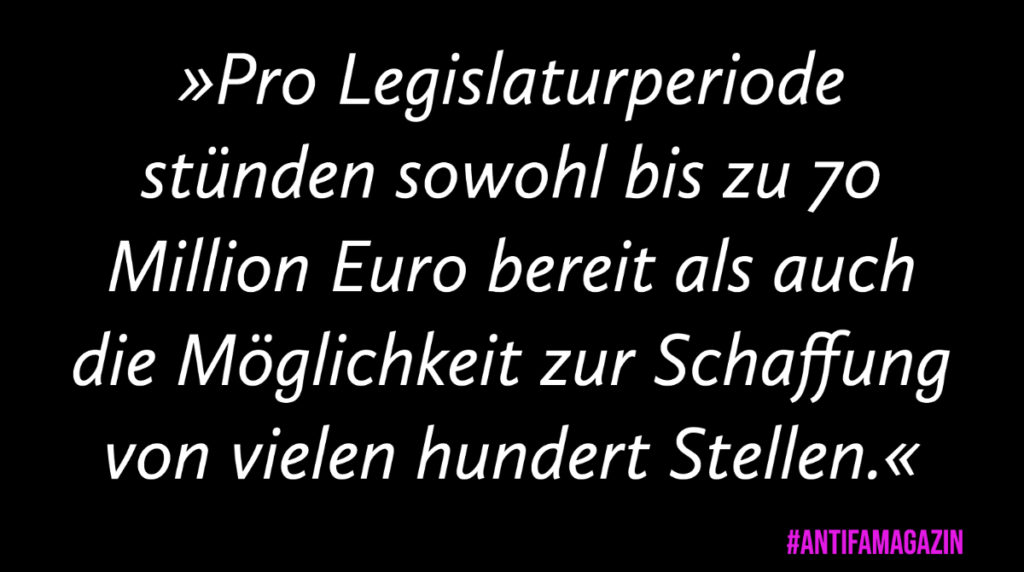
Die Gefahr der baldigen Finanzierung einer parteinahen Stiftung der »Alternative für Deutschland“ (AfD) ist seit dem 26. September und dem Wiedereinzug der Partei in den Bundestag deutlich größer geworden. Die Vorsitzende der »Desiderius-Erasmus-Stiftung« (DES), Erika Steinbach, hat gleich am Tag nach der Wahl einen entsprechenden Brief an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Bundestages geschickt. Dieser wurde bisher passenderweise vom AfD-Abgeordneten Peter Boehringer geleitet. Zumindest das wird sich ändern, denn der für die Staatfinanzen zentrale Ausschuss wird traditionell von der stärksten Oppositionspartei geleitet, demnächst also wohl von der CDU. Der Haushaltsausschuss ist von zentraler Bedeutung, weil hier auch über die Gelder für die parteinahen Stiftungen entschieden wird und die Frage geklärt werden muss, ob absehbar auch Geld für die DES in den Haushaltsentwurf eingestellt werden soll.
Was die Förderung einer parteinahen Stiftung einer in Teilen völkischen Partei der extremen Rechten bedeuten würde, haben zahlreiche Publikationen herausgearbeitet: Pro Legislaturperiode stünden sowohl bis zu 70 Million Euro bereit als auch die Möglichkeit zur Schaffung von vielen hundert Stellen. Das ermöglicht politische Bildungsarbeit im Inland, den Aufbau von Auslandsbüros, die Etablierung eines Studienwerkes und damit die Förderung akademischen Nachwuchses – alle diese Möglichkeiten würden sich auch für die DES ergeben. Sie würde so zum zentralen ideologischen Motor und zur finanziellen Absicherung einer ganzen Generation rechter Aktivist*innen werden. Insofern gibt es gute Gründe, darüber nachzudenken, ob und wie sich die Finanzierung der DES verhindern lässt.
Verfassungsfeindlich?
Vor allem dem »Anne Frank Zentrum« in Frankfurt am Main ist es zu verdanken, dass es zur Frage der Finanzierung der Stiftung eine breitere öffentliche Debatte gibt. Rechtlich, darin sind sich alle einig, ist es auf Grundlage der jetzigen Verteilung der Gelder schwer bis unmöglich, der DES mittelfristig den Zugang zu verweigern. Verzögerungen und gerichtliche Auseinandersetzungen bei einer möglichen Verweigerung der Mittel durch den Bundestag wären nur eine Vertagung des grundsätzlichen Problems. Wie ein Ausschluss der DES begründet werden könnte und auch gerichtlich haltbar ist, darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Einig sind sich hingegen alle, die an dieser Fragestellung arbeiten, dass es nur auf Grundlage einer gesetzlichen Fixierung der Stiftungsfinanzierung geht.
Häufig genannt werden die vom Bundesverfassungsgericht im NPD-Verbotsverfahren entwickelten Kriterien zur Feststellung der Verfassungsfeindlichkeit der NPD: Verstoß gegen das Prinzip der Menschenwürde im Grundgesetz, Verstoß gegen das Demokratieprinzip und Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Es erscheint zweifelhaft, ob diese Punkte der DES so nachgewiesen werden können, dass es gerichtsfest für einen Ausschluss von der Finanzierung reicht. Zumal man davon ausgehen kann, dass die Punkte der AfD als »Mutterpartei« der Stiftung dann ohne jeden Zweifel nachgewiesen werden könnten. Wäre dem so, dann wäre die AfD ein Fall für ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.
„Wehrhafte Demokratie“
Aktuell gibt es Vorschläge, den Ausschluss der DES mit den formalen Mitteln der »wehrhaften Demokratie« bundesdeutscher Prägung zu bewerkstelligen. Hier sollten Antifaschist*innen sehr hellhörig werden, denn damit befindet man sich schnell im Argumentationsgeflecht der Extremismustheorie. Der vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten Volker Beck (Bündnis90/Die Grünen) entwickelte Gesetzesvorschlag als zentralem Hebel zur Verhinderung der Finanzierung der DES basiert auf den Begriffen der »wehrhaften Demokratie« und der »freiheitlich demokratischen Grundordnung« (fdGo). Geregelt werden soll mit einem solchen Gesetz die staatlich finanzierte politische Bildungsarbeit generell, also neben den parteinahen politischen Stiftungen auch die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung. Neben obskuren Konstruktionen im Entwurf von Beck, wie »verfassungsphoben« Stiftungen oder Parteien, durchzieht den Entwurf eine Orientierung am Extremismus-Ansatz und das uneingeschränkte Bekenntnis zur fdGo als Voraussetzung jeder Förderung. Zwar orientiert sich Beck bei der inhaltlichen Bewertung nicht förderungswürdiger Positionen an den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Urteil. Aber in wichtigen Passagen des Entwurfes wird deutlich, dass sich die formalen Kriterien auch gegen Linke und Antifaschist*innen richten werden. So heißt es etwa im Entwurf: »Bei Parteien oder Stiftungen, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen der Nichtigkeit nach I.C.2.1.d. Satz 1 erfüllt sind. Gleiches gilt, wenn Personen in den Stiftungsgremien Mitglied einer im Verfassungsschutzbericht als extremistisch erwähnten Organisation sind oder selbst dort erwähnt werden.«
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Geheimdienst als Schiedsrichter?
Mit einer solchen Ausrichtung würde der Inlandsgeheimdienst zum Schiedsrichter für demokratische Bildungsarbeit. Alle Bemühungen von Antifaschist*innen und Projekten gegen die extreme Rechte, gerade diese Institution im Kampf gegen rechts zu delegitimieren, würden damit konterkariert. Nur in kleinen Teilen ausgeprägt ist diese Kritik am Extremismus-Ansatz in den Parteien, die wahrscheinlich die kommende Regierungskoalition tragen. Und auch im linksliberal-grünen Spektrum trifft diese Argumentation nicht nur auf Verständnis, sieht man sich hier doch als demokratische Mitte der Gesellschaft und Träger einer diversen aber universalen, menschenrechtlich orientierten Demokratie. Linke Bedenken werden hier schnell als Hindernis im Kampf gegen Rechts wahrgenommen und für die erfolgreiche Verhinderung der Finanzierung einer AfD-Stiftung wird von Linken und Antifaschist*innen erwartet, auf ihre radikalen Teile einzuwirken oder sie abzuspalten. Damit wird jedoch verkannt, dass sich die »wehrhafte Demokratie« historisch immer vor allem gegen links gewandt hat. Zudem wird die Deutungshoheit darüber, was demokratisch legitim ist, in eben jener Mitte vorgenommen, die in den zahlreichen Mitte-Studien der letzten Jahre als Ort des Problems und nicht der Lösung beschrieben wurde.
Der Beitrag Nicht alle Mittel sind sinnvoll erschien zuerst auf der rechte rand.