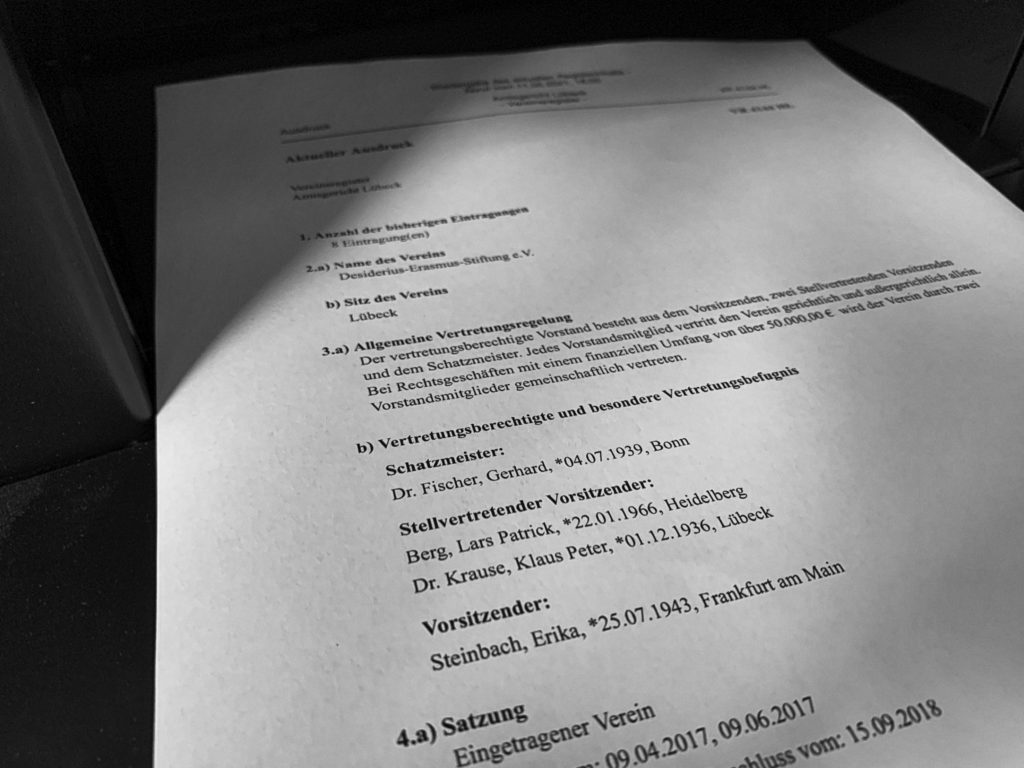Veränderungen in der Justizlandschaft
#NSU
Zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU spricht »der rechte rand« mit Rechtsanwalt Björn Elberling, der seit 2013 als Nebenklägervertreter am Münchener NSU-Prozess beteiligt war, über Veränderungen innerhalb der Justiz.

drr: Was hat sich in den letzten zehn Jahren zum Besseren entwickelt in Bezug auf juristisches Vorgehen gegen Nazis?
Björn Elberling: Die spannende Frage ist, ob sich überhaupt etwas signifikant verändert hat. Klar, die Ermittlungskompetenzen und Personalressourcen der Sicherheitsbehörden sind massiv ausgeweitet worden. Auch die Möglichkeit der Bundesanwaltschaft, Verfahren an sich zu ziehen, wurde erweitert. Das für sich genommen ändert aber nichts Wesentliches, weil es schon immer nicht um ein Regelungs-, sondern um ein Vollzugsdefizit gegangen ist. Und die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen ist eben zweischneidig und vor allem abhängig von den lokalen Strukturen in Polizei und Justiz. Da erleben wir dann durchaus Verfahren wegen Nazi-Gewalt, die mit Nachdruck und einem gewissen Verständnis auch für die politischen Hintergründe verfolgt werden. Das zeigt sich etwa auf der Bundesebene, wo etwa der Vertreter der Bundesanwaltschaft im Verfahren gegen Stephan Ernst in seinem Plädoyer die Hintergründe des Mordes an Walther Lübcke wie auch des Mordversuchs an Ahmed I. sehr treffend eingeordnet hat. Ich habe auch bei einigen Körperverletzungs-Verfahren lokal in Kiel den Eindruck, dass mindestens Wert darauf gelegt wird, dass Fälle rassistischer Gewalt erkennbar ernst genommen werden.
Aber das ist alles fragil: Die Fälle, die die Bundesanwaltschaft gerade nicht an sich gezogen hat, sind zahlreich. Mit dem #AntifaOst-Verfahren scheint auch dort die Fraktion, die lieber die Linke als die wahre Gefahr für den Rechtsstaat verfolgen will, wieder stärker zu werden. Und regional gibt es dann etwa das Ballstädt-Verfahren, wo die Justiz mit den Tätern einen Deal macht, ihnen für einen wirklich brutalen Überfall Bewährungsstrafen gegen Geständnisse zusagt – und sie dann nicht mal zu den für das Urteil wichtigen Details befragt und stattdessen die Geschädigten erneut verhöhnt, indem sie sie dazu befragt. Und wir erleben wirklich viele Verfahren, die irgendwo dazwischen liegen – bestimmt besser als das, was den Familien der durch den NSU Ermordeten und den Menschen in der Keupstraße bis 2011 widerfahren ist, aber auch alles andere als vorbildlich.
Erhalten Verletzte von rassistischen, antisemitischen und neonazistischen Anschlägen und Angehörige von Ermordeten mehr Gehör und wird ihnen mehr geglaubt vor Gericht?
Dass die Nebenkläger*innen im NSU-Verfahren und ihre Anwält*innen sich Raum und Gehör verschafft haben, hat sich durchaus auch auf Betroffene späterer Verfahren ausgewirkt. Auch diese konnten sich selbstbewusster aufstellen und ihre Rolle einfordern, auch dank der Unterstützung durch Opferberatungen und antifaschistische, antirassistische und zivilgesellschaftliche Gruppen. Wie die Gerichte dann mit ihnen umgehen, ist – siehe oben – weiterhin von den einzelnen Gerichten und Richter*innen abhängig: Das Spektrum reicht von Einfühlsamkeit und Empathie über die Behandlung als nervige, weil nicht einfach emotionslos ihre Aussage machende Zeug*innen bis hin zu Gerichten, die eben Deals mit Nazi-Angeklagten machen und dann verbal gegen die Nebenklage austeilen, wenn die sich darüber beschwert.
Was sind die größten Hemmnisse aus Sicht von Anwält*innen, die auf Seiten der NSU-Opferangehörigen standen?
Hemmnisse gibt es auf mehreren Ebenen. Für den NSU-Komplex zum Beispiel ist da immer noch die absurde Geheimhaltung um alles, was nicht das Münchener Verfahren angeht. Über die unter Verschluss gehaltenen Akten haben sich ja schon viele beschwert. Ebenso wissen wir bis heute nicht, was mit den Verfahren gegen neun der Unterstützung der NSU-Beschuldigten ist. Das würde ich letztlich auf das zurückführen, was wir schon ganz zu Beginn des Münchener Prozesses gesagt haben: Die These von der isolierten Zelle NSU, das Für-Abgeschlossen-Erklären des Themas mit dem Münchener Verfahren, ist letztlich Folge einer politischen Entscheidung, auch dieses Kapitel deutscher Geschichte lieber früher als später für fertig »aufgearbeitet« zu erklären. Ein ganz wesentliches Problem, das sich in vielen Verfahren stellt, ist, dass die Justiz nicht willens oder in der Lage ist, die Besonderheiten rassistischer und anderer rechter Taten als Botschaftstaten, die dahinterstehende Ideologie, die Strukturen, in denen die Täter sich bewegen, zu erfassen. Teilweise liegt das, so meine Wahrnehmung, schlicht an fehlender Kenntnis, zum Teil aber auch daran, dass es einfach leichter ist, diese Fälle nach demselben Schema zu behandeln wie »ganz normale« Körperverletzungs- oder Tötungsdelikte.
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, der realistisch ist, was wäre das aus deiner Sicht?
Wünsche in Richtung von Gesetzesreformen sind immer heikel, die gehen meist nach hinten los. Und gesellschaftliche Veränderungen werden ja eigentlich erkämpft und nicht herbeigewünscht …
Ich gebe mal eine ganz lokale Antwort: Wenn wir es schaffen, dass bei den Landtagswahlen am 8. Mai 2022 die AfD, die ja wegen ihrer Hetze zurecht als parlamentarischer Arm des Rechtsterrorismus bezeichnet wird, aus dem Landtag von Schleswig-Holstein fliegt, würde mich das schon froh machen.
Vielen Dank für das Interview!
Der Beitrag Veränderungen in der Justizlandschaft erschien zuerst auf der rechte rand.