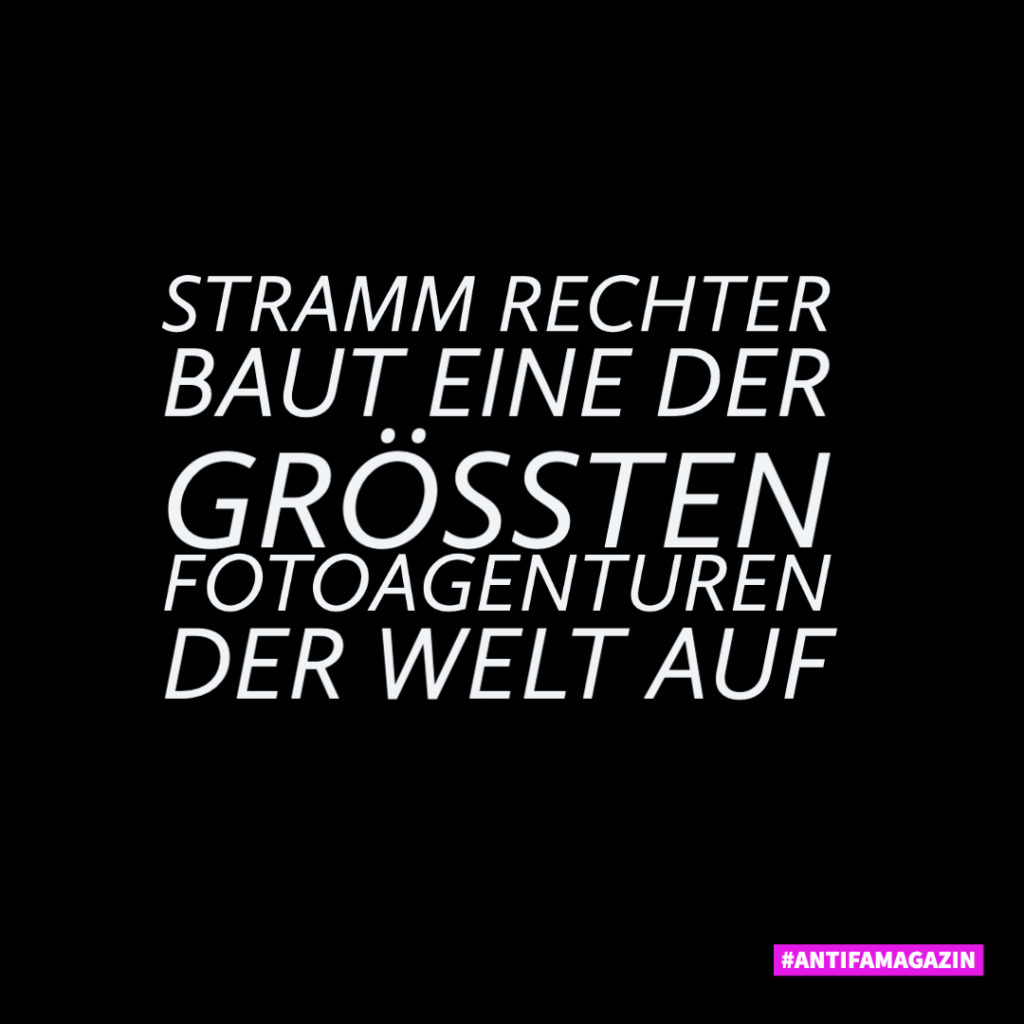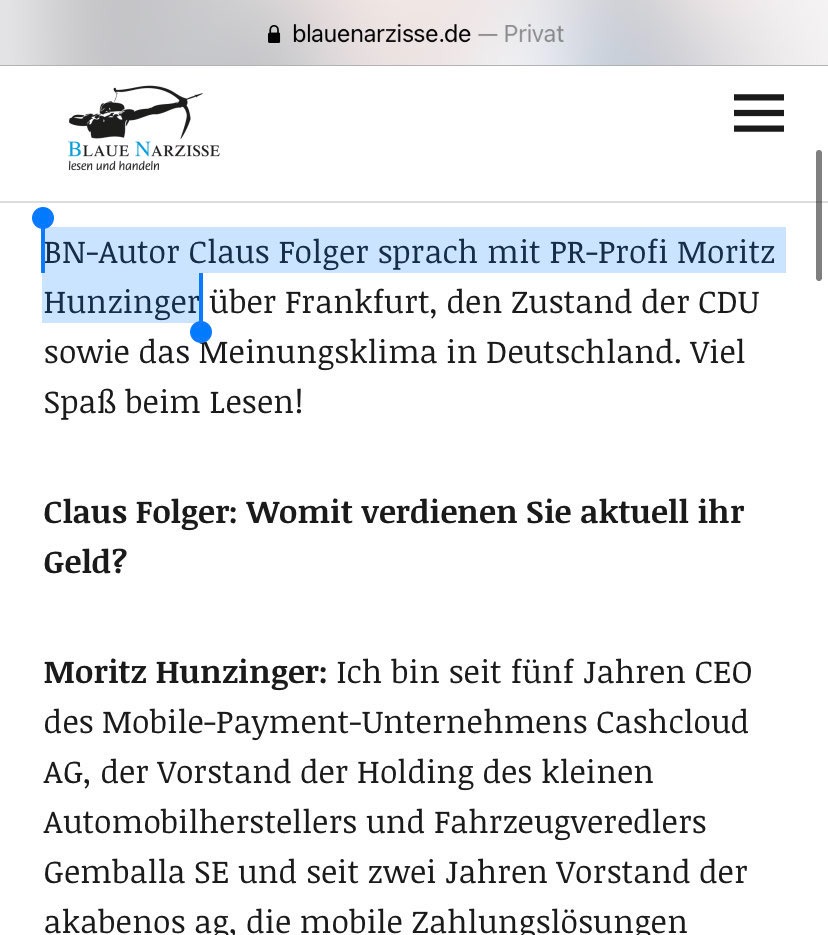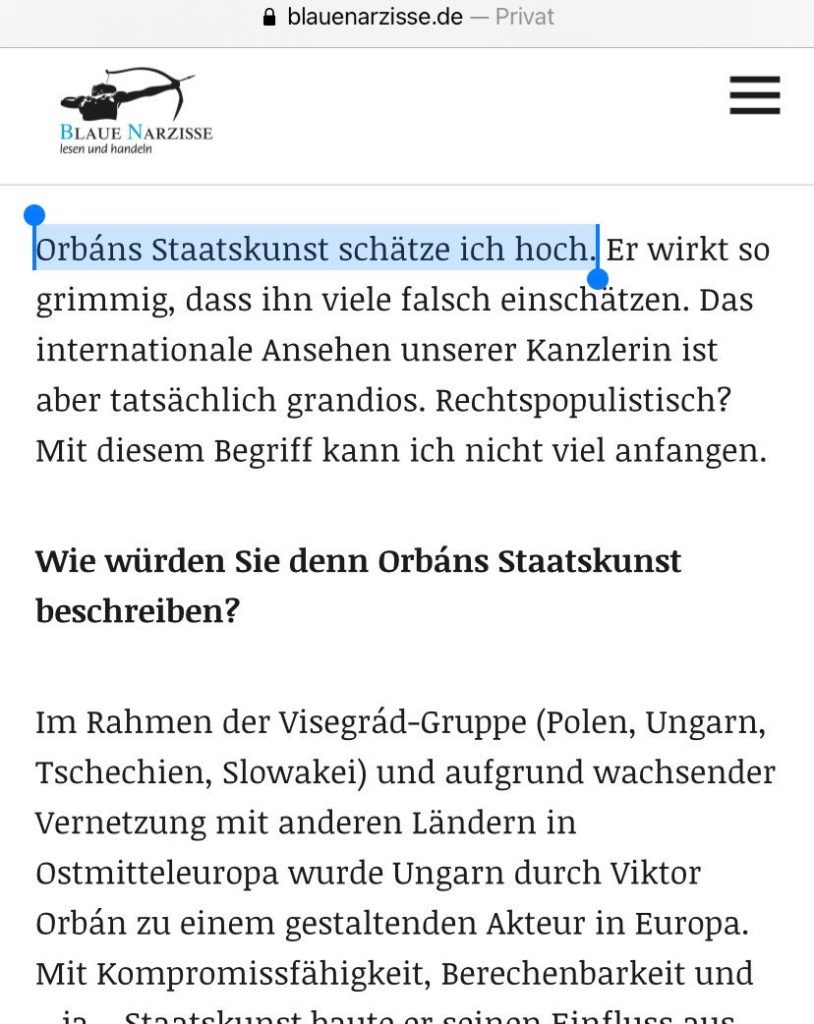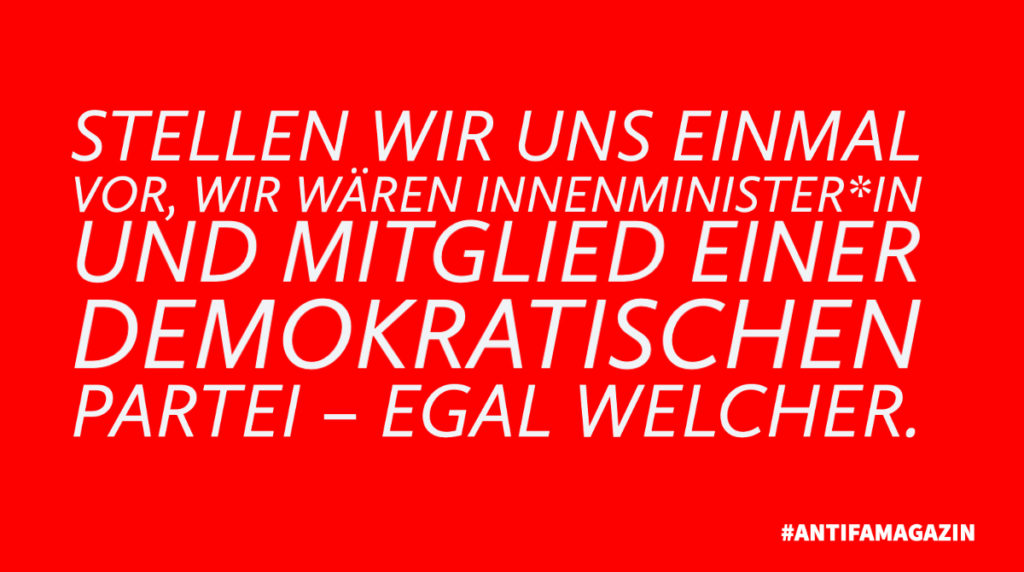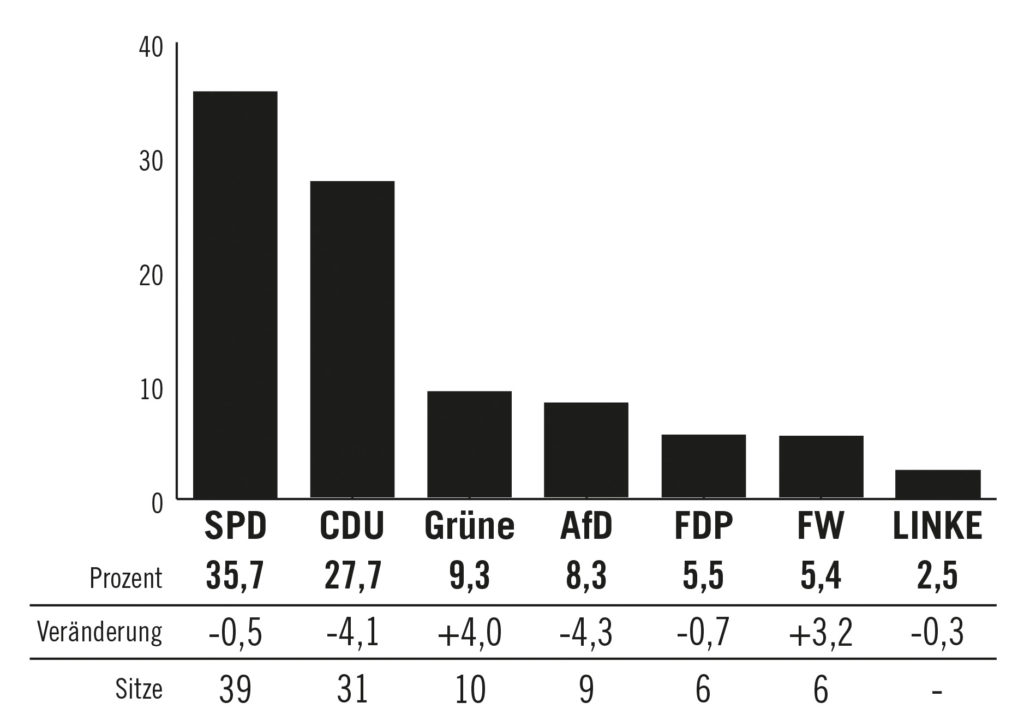»Rote Linien ziehen«
#Angriff
Wie umgehen mit der »Alternative für Deutschland« in den Parlamenten? Diese Frage wird seit ihrem Einzug kontrovers diskutiert. Die Bundestagsabgeordnete Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) hat die AfD-Bundestagsfraktion fast vier Jahre lang erlebt. Sascha Schmidt hat im Juni 2021 mit ihr für »der rechte rand« gesprochen.

drr: Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag im September 2017 kündigte der damalige Vorsitzende Alexander Gauland vor laufenden Kameras an: »Wir werden sie jagen.« Hat die Partei ihre Drohung wahr gemacht?
Renate Künast: Obwohl Gauland auch immer wieder versucht, sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben, hat er damit gesagt, was er will. Bei dem Wort »jagen« sieht man Menschen laufen und man weiß, dass es auch um die Zerstörung von Menschen geht. Das war auch symbolisch aufs Parlament gerichtet und heißt dann: Wir werden sie verjagen und wir werden den Parlamentarismus zerstören – und damit eine Basis der Demokratie. Sie haben es versucht. Ich weiß noch, wie im Februar 2018 in unserer und auch in anderen Fraktionen eine sehr intensive Debatte darüber entstand, wie man mit dem Getöse, das die AfD veranstaltet, umgehen soll. Es ist ja so: Man sitzt regelmäßig im Plenum – manchmal von morgens um neun bis nach Mitternacht – und alle fünfundvierzig Minuten kommt ein Beitrag von denen. Und wenn jedes Mal alle darauf reagieren und sich distanzieren von diesen menschenverachtenden Dingen und Ungeheuerlichkeiten, geht dafür die ganze eigene Energie drauf. Nach ein paar Sitzungen hat man es dann verstanden. Wir haben uns entschieden, nur noch begrenzt darauf einzugehen, weil wir ihre Provokationen nicht weiter vorantreiben wollen. Bei Geschäftsordnungsanträgen wird dann schon mal entschieden, dass einer die Gegenrede macht und nicht jede Fraktion – weil uns das sonst nur aufhält. Wenn jeder fünf Minuten Gegenrede hält, wird das nachts immer länger und genau das ist das Interesse der AfD. Aber wenn man sich ständig dieses Zeug anhören muss, geht das nicht spurlos an einem vorbei. Zumal es nur ganz wenige sachliche Reden von der AfD gibt. Und bei denen kannst du dann vor Langeweile einschlafen. Aber ansonsten: Abwertung und Hetze. Wenn sie versuchen mal jemanden zu loben, wird gleichzeitig gesagt: »Alle anderen sind Idioten.« Das ist schon anstrengend. Aber treiben lassen wir uns nicht.
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Sie haben angedeutet, dass es Absprachen zwischen den Fraktionen gegeben hat. Gab es zwischen den Fraktionen auch einen Solidarisierungseffekt oder einen Schulterschluss gegen die Angriffe der AfD?
Wir haben ja eine Masse an Aufgaben. Dann kamen Corona, Gerichtsentscheidungen zum Thema Klima, darauf muss man reagieren. Politik ist ein schnelles Geschäft, wo immer zusätzliche Themen kommen. Ja, es gibt eine Kooperation, um das Parlament arbeitsfähig zu halten. Das finde ich schon einen positiven Punkt. Als ich Anfang 2018 wochenlang wegen eines Beinbruchs pausierte, fiel mir auf, wir verwenden zu viel Zeit dafür. Damit am Ende die Leute nicht sagen: »Ihr kümmert euch nicht um unsere Kinder, um soziale Fragen und um Jobs!« Zudem sind die Medien am Anfang über jede Provokation gesprungen. Anfangs wurden deren Aktivitäten, egal ob bei Twitter oder im Plenum, zehnmal durch die Republik gesendet. Das war ein Problem. Im Ergebnis meine ich, dass nicht nur wir uns im Parlament überlegen müssen, wie wir damit umgehen, sondern auch die Zivilgesellschaft und die Medien müssen sich fragen, ob man sich vor jeden Karren der AfD spannen lässt.
In einem internen Strategiepapier aus dem Jahr 2017 hatte die AfD Ihre Partei als den »eigentlichen Gegner« und die »Verkörperung der ›68er‹« bezeichnet. War überwiegend Ihre Fraktion den Angriffen ausgesetzt oder richteten sich diese gegen alle Fraktionen im Bundestag?
Also ich erlebe es schon so, dass wir besonders bedacht werden. Aber der Unterschied ist jetzt auch nicht riesig. In Wahrheit ist das Parlament für die AfD ein Aufnahmestudio für YouTube-Videos, um Menschen aufzuhetzen und bestimmte Thesen endlos wiederzugeben. Mit allen Tricks, die sie dann anwenden. Was aber auffällt ist, dass sie in klarer rechtsextremer Manier Misstrauen gegenüber den handelnden Personen und Mitgliedern der Regierung säen. Und dann gibt es einige Personen, über die sie sich besonders abwertend äußern. Sie wenden sich zum Beispiel besonders gegen Frauen und uns ›Grüne‹.
Gerade mit Blick auf den Sexismus und Antifeminismus der AfD – wie geht die Fraktion mit Frauen um?
Politisch aktive Frauen sind ihnen ein besonderer Dorn im Auge. Insbesondere, wenn diese sich unbeeindruckt von den Angriffen zeigen und selbstbewusst durch die Welt laufen. Da merkt man schon: das reizt sie. Und dann fangen sie an, sich besonders abwertend über diese Personen zu äußern. Wenn du als Frau bei denen einen Zwischenruf machst, kriegst du garantiert eine abwertende Äußerung, die dann immer persönlich ist.
Sie haben angesprochen, wie die AfD den Bundestag als Plattform nutzt. Man hört aber immer wieder, dass es auch außerhalb des Plenums, auf den Fluren beispielsweise, Rempeleien oder ähnliche Provokationen gab. Haben Sie solche Erfahrungen gemacht?
Ich persönlich bin noch nicht angerempelt worden. Ich höre aber von anderen, dass es verbale Übergriffe, Anrempeleien und Pöbeleien gab. Ich weiß auch, dass ein besonderes Leid die FDP-Frauen haben, die direkt neben denen sitzen und alles hören, was die von sich geben. Das bekommen andere oft gar nicht mit. Und es gibt die Geschichte, dass Gäste oder auch Abgeordnete der AfD Videos mit dem Handy drehen, beispielsweise an der Wahlurne. Das ist schon ein komisches Gefühl, denn du weißt: Sie wollen daraus jetzt ein Hetzvideo machen. In dem Augenblick weißt du: Der will gegen dich hetzen und du weißt nicht, wie weit das geht, welchen Shitstorm sie damit provozieren. Und wir wissen ja alle, dass der Übergang von der digitalen Welt in die analoge kurz ist.
Dann gibt es eine andere Variante, das ist besonders abstoßend: Wenn sie sich teilweise richtig einschleimen. Also nicht nur, dass sie eine Zeit lang versucht haben, sich als bürgerliche Partei zu gerieren. Eine Rechnung, die nicht aufging. Sie schleimen sich dann ein, im Sinne von: »Wir können uns doch da, wo wir einer Meinung sind, gegenseitig unterstützen.« Ich habe klar gesagt, dass in meinem Lebensplan nicht vorgesehen ist, dass ich jemals in meinem Leben einen Antrag der AfD unterstütze. Sie sind doch die Partei, die Hass und Hetze und Drohungen gegen mich unterstützt und jetzt soll ich mit ihnen zusammenarbeiten? Die AfD hat die Atmosphäre hier schon massiv verändert. Es hat so abwertende Formen angenommen, dass wir hier wirklich den Parlamentarismus verteidigen müssen. Wir hatten hier Demos, wo Corona-Leugner*innen versucht haben, Polizeisperren zu durchbrechen. Da wurden alle Türen des Reichstages geschlossen. Als dann AfDler Leute eingeschleust haben, angebliche Journalisten, die dann Räume gestürmt haben, haben sich viele Mitarbeiter*innen sicherheitshalber eingeschlossen. Nie habe ich so viel nachgedacht wie jetzt über die Frage: Wie war das eigentlich damals, als es mit der NSDAP anfing?
Daran anschließend, zu der kontrovers diskutierten Frage der Bewertung der AfD: Wenn Sie die Partei mit einem politischen Etikett versehen müssten, welches wäre das?
Sie sind Rechtsextreme. Weil sie alle Facetten davon darstellen. Sie haben das Interesse, Parlamentarismus, demokratische Strukturen und Prozesse zu zerstören. Sie akzeptieren die Würde jedes einzelnen Menschen und die Gleichheit der Menschen nicht. Sie sind islamophob, homophob, antisemitisch und antifeministisch. Die Rechtsextremen haben mittlerweile die Partei übernommen.
Es gibt ja die These, dass der Parlamentarismus die Radikalen einhegen könne. Wenn Sie auf die vergangenen vier Jahre und die AfD-Fraktion zurückschauen: Hat sich deren Auftritt, im Umgang mit anderen Abgeordneten und im Sinne einer Versachlichung, verändert? Man könnte ja meinen, dass irgendwann die Provokation auch nicht mehr selbstbefriedigend wirken kann.
Künast: Ich glaube, dass denen die Autosuggestion reicht, dass sie erfolgreich sind. Deren Interesse ist ja gar nicht, innerhalb des Parlamentarismus erfolgreich zu sein, sondern Bilder zu schaffen, wie »wir werden sie jagen«, um Menschen aufzuhetzen. Sie haben überhaupt kein Bedürfnis, innerhalb des Parlamentarismus Erfolg zu haben, weil sie ja einen autoritären Staat wollen. Da gibt es keine Einhegung. Aber es wird kein Parlament geben, das dem Problem alleine entgegenwirken kann. Wenn wir das glauben, hätten wir die Rechnung ohne die systemrelevante engagierte Zivilgesellschaft gemacht. Und die brauchen wir. Ohne die geht es gar nicht. Die rote Linie müssen wir gemeinsam ziehen.
Vielen Dank für das Interview!
Der Beitrag »Rote Linien ziehen« erschien zuerst auf der rechte rand.
Quelle: https://www.der-rechte-rand.de/archive/7751/rote-linien-ziehen-renate-kuenast/