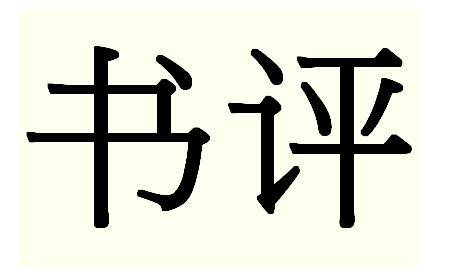Die Linguistik bzw. vielmehr die linguistische Pragmatik hat mit der Diskussion um den Praktikenbegriff (vgl. Deppermann et al. 2016a) neuerlich eine Hinwendung zu vermehrt kulturanalytischen Perspektiven unternommen (vgl. bereits Günthner/Linke 2006). In der Regel vollziehen sich solche Hinwendungen als Weiterungen: gegenstandsbezogene, disziplinäre, methodische Weiterungen. Ich möchte hier den Versuch unternehmen, für die Gattungsanalyse eine weitere Weiterung vorzuschlagen, die an bereits vergessene und an noch unentdeckte Konzeptionen anknüpft. Diese Weiterung soll dann für eine kulturanalytische Rekonstruktion der Gattung Vorlesung (vgl. Goffman 1981; Monteiro/Rösler 1993; Grütz 2002; Hambsch 2009; Hausendorf 2012; Carobbio/Zech 2013), verstanden als unproblematisches aber dennoch fortwährend auch problematisches Problem (vgl. Berger/Luckmann 2000:26f.
[...]
Der ‚Sitz im Leben‘ oder: Was die Textsorten-Linguistik eigentlich interessant macht
Wenn man — wie das für das Setzen von Fußnoten schon mal geschieht — einzelnen Begriffen hinterherrecherchiert, die sonst oft selbstverständlich anzitiert oder auch nur im Vorübergehen fallen gelassen werden, wird man ja manchmal überrascht. So ging es mir dieses Wochenende mit der scheinbar so einleuchtenden Metapher des ‚Sitzes im Leben‘. In der Regel kommt sie Linguist_innen im Zusammenhang mit den Kategorien ‚Textsorte‘ oder ‚Gattung‘ unter und ist dann oft so eine hübsch schillernde, begriffliche Abkürzung. ‚Sitz im Leben‘ gibt nicht nur so einen leicht altmodischen Beigeschmack, der ja auch allein schon deswegen cool ist, weil der Ausdruck unübersetzt in den englischen und französischen Diskurs übernommen wurde; die Metapher gibt darüber hinaus so einen soziokulturellen Horizont von Ganzheitlichkeit mitzuverstehen, ohne ihn recht auszubuchstabieren: Ja, auch die gesellschaftliche Wirklichkeit dessen, was ich untersuche, ist mir wichtig. Irgendwie also ein ziemlich effektives Schlagwort. Wo kommt es aber eigentlich her? Und welchen Begriff soll es benennen?
Wendet man sich mit diesen Fragen an den Urheber des Begriffes, kann man mit Erstaunen feststellen, wie ausdifferenziert bereits dort ein Zugriff auf jene Größe ausgearbeitet war, die sehr viel später dann bspw. ‚Textsorte‘ genannt wird.
[...]
Eristik des Konsens. Zur Spezifik chinesischer Rezensionen
“Wenn man eine Publikation bewertet, sollte man deshalb nicht nur an die Schwäche einer Arbeit denken, sondern vor allem an ihren zu schätzenden Wert.” (Liang 1991: 304)
Im Rahmen einer interessanten Analyse eines nachwuchswissenschaftlichen Blogeintrages habe ich einen kleinen Ausflug in linguistische Analysen wissenschaftlicher Rezensionen gemacht. Im Zug (Köln-Siegen) habe ich gerade den sprach-/kulturvergleichenden Aufsatz von Yong Liang (1991) gelesen, der deutsche und chinesische Rezensionen untersucht und spannende Spezifika der jeweiligen sprachlichen Bewertungsmuster anhand 8 deutscher und 8 chinesischer Texte herausarbeitet.
Den für mich interessantesten Punkt habe ich im obigen Zitat herausgestellt. In Liangs (1991) Untersuchung zeigt sich nämlich eine diametral entgegengesetzte Gewichtung positiver und negativer Bewertungshandlungen. Während nämlich die deutschsprachigen Rezensionen davon geprägt sind, dass kritische Auseinandersetzungen mit dem rezensierten Werk innerhalb der Besprechung einen gewichtigen Teil ausmachen und mit Bezugnahmen auf den Forschungsstand begründet werden, sind chinesische Rezensionen davon geprägt, das rezensierte Werk in seinen Leistungen zu würdigen. Daraufhin wird auch die Einordnung in den Forschungsstand funktionalisiert, die dazu dient, daran ‘das Neue und Wertvolle’ zu kennzeichnen und zu charakterisieren.
Auch in den abschließenden Resümees zeigte sich diese Gewichtungsasymmetrie. Während deutschsprachige Rezensionen vorwiegend abschließend positive Bewertungen vornehmen und diese sich pauschal und recht unbegründet auf das Gesamtwerk beziehen, nutzen chinesische Rezensenten das Resümee, um vereinzelte negative, zu kritisierende Aspekte anzusprechen, ohne diese oft allgemeinen Aspekte aber zu begründen.
“Im Chinesischen zeichnet sich die Stärke wissenschaftlichen Rezensierens vor allem dadurch aus, das Positive im Rahmen des Gültigen zu entdecken und hervorzuheben. Deshalb ist dort die Würdigung der Objektpublikation weitgehend dominant. Die Meinungsverschiedenheit spielt nur eine untergeordnete und stark eingeschränkte Rolle und kann nur dann repräsentiert werden, wenn die Harmonie dadurch nicht beeinträchtigt wird [...]. In deutschen Rezensionstexten spielt hingegen die Meinungsverschiedenheit eine dominierende Rolle.” (Liang 1991: 309)
Liang (1991: 304) begründet diese Spezifik chinesischer Rezensionen einerseits mit der traditionell auch alltäglich äußerst wichtigen “Höflichkeitsmaxime” und andererseits mit dem “Respekt vor der vertikalen akademischen Pyramide, also vor der Autorität”. So würden “kategorisch negative Bewertungen [...] das Ansehen des Rezensenten bei Fachkollegen [sogar] eher schwächen als stärken”.
Dies wirft interessante Fragen zur chinesischen Wissenschaftskultur auf. Während die europäische Wissenschaftstradition am Dissens interessiert ist, um sich der Wahrheit zu nähern, scheint das – wie Liangs (1991) Arbeit ahnen lässt – in der chinesischen Tradition ganz anders auszusehen und sich in den sprachlichen Verfahren der Erkenntnisdarstellung und -besprechung niederzuschlagen. Von dort aus ist es nicht weit, um zu ahnen, dass das auch die Erkenntnisproduktion betrifft. Ich stecke da zu wenig drin, um genaueres herauszustellen. Ich werde in nächster Zeit aber nach Überblickswerken ausschau halten, die mir die Zusammenhänge und (historischen) Hintergründe dieser Wissenschaftstradition durchsichtiger werden lassen. Für Hinweise bin ich immer offen!
Für einen zentralen Begriff meiner Dissertation, für den Begriff der Eristik nämlich, und für die Frage, wie dieser zu Konzeptualisieren ist, bin ich aber abermals in der Idee bestärkt, dass er nicht nur auf streitende, d.h. kritische Sprechhandlungen bezüglich der Geltung wissenschaftlichen Wissens beschränkt werden kann, sondern ebenso affirmative Bezugnahmen auf bestehendes Wissens umfassen muss. Es geht also nicht nur um die sprachliche Verhandlung von Dissens, sondern auch um die sprachliche Verhandlung von Konsens. Damit wird es dann möglich, ‘eristische Strukturen’ (Ehlich) nicht nur als Menge sprachlicher Mittel zu betrachten, sondern ihm einen wissenschaftsspezifischen Zweck zuzuordnen, der in der Modellierung einer forschenden Position im verfügbaren wissenschaftlichen Wissen bestünde. Liangs (1991) Arbeit zeigt eindrücklich, in welcher Weise dieser Zweck neuzeitlicher Wissenschaftskommunikation kulturvariant bearbeitet werden kann.
*
Liang, Yong (1991): Zu soziokulturellen und textstrukturellen Besonderheiten wissenschaftlicher Rezensionen. In: Deutsche Sprache 19, S. 289-311.
Über die Gefahr ‚unterwegs im Malfeld abzusaufen‘…
… diese Formulierung hat eine Freundin einmal gefunden, um die Schwierigkeiten zum Ausdruck zu bringen, die mit dem fünften der funktional-pragmatischen Felder einhergehen. Und in der Tat rühren diese Schwierigkeiten daher, dass dieses Feld noch wenig bestellt ist.
Ich habe mich an diese Formulierung erinnert, als ich letztens wieder einmal über die Beobachtungsgabe Erving Goffmans staunen musste. Sie geht freilich einher mit einer Gabe, zu schildern, was er beobachtete.
“First, there are overlayed “keyings.” The published text of a serious paper can contain passages that are not intended to be interpreted “straight,” but rather understood as sarcasm, irony, “words from another’s mouth,” and the like. However, this sort of self-removal from the literal content of what one says seems much more common in spoken papers, for there vocal cues can be employed to ensure that the boundaries and the character of the quotatively intended strip are marked off from the normally intended stream. (Which is not to say that as of now these paralinguistic markers can be satisfactorily identified, let alone transcribed.) Thus, a competent lecturer will be able to read a remark with a twinkle in his voice, or stand off from an utterance by slightly raising his vocal eyebrows. Contrariwise, when he enters a particular passage he can collapse the distance he had been maintaining, and allow his voice to resonate with feeling, conviction, and even passion. In sensing that these vocally tinted lines could not be delivered this way in print, hearers sense they have preferential access to the mind of the author, that live listening provides the kind of contact that reading doesn’t.” (Goffman 1981: 174f.)
Hier handelt es sich um einen Auszug aus Goffmans kursorischem Gang durch die Spezifika von Vorlesungen; und was er dort berührt, ist ein nicht uninteressanter Aspekt von Hochschul- und noch mehr von (interner) Wissenschaftskommunikation. Dabei kennzeichnet die Eingangspassage schon eine erste Schwierigkeit, die sich mit diesen Aspekten verbindet. Bei der Umsetzung in die Schriftlichkeit mögen Spuren der von Goffman beobachteten Aspekte noch übrig bleiben. Diese aber identifizieren zu können, gestaltet sich als äußerst voraussetzungsreiche Aufgabe.
Um was für Aspekte handelt es sich dabei aber? Und warum sind diese für mich, sprich für mein Promotionsprojekt1 eigentlich interessant?
Beginnen wir mit dem eingangs erwähnten Malfeld oder vielleicht besser mit der sog. Fünf-Felder-Lehre der Funktionalen Pragmatik: Karl Bühler (1934/1984) hat in seiner Sprachtheorie zwei sprachliche Aufgabenfelder unterschieden. Das Zeigfeld und das Symboldfeld. Das Zeigfeld betrifft die Organisation von Aufmerksamkeit. Indem mit verschiedenen Wörtern und anderen Zeighilfen in unterschiedlichen Verweisräumen gezeigt wird, wird die Aufmerksamkeit von Sprecher und Hörer synchronisiert. Ich, jetzt, hier, her, hin, da, dort, jener, dieser, du. Das sind Beispiele für deiktische Ausdrücke. Nonverbale Deixeis spielen selbstverständlich eine ebenso wichtige Rolle (vornehmlich in der Kommunikation unter Anwesenden). Das Symbolfeld betrifft den begrifflichen Haushalt einer Sprache. Symbolfeldausdrücke sind dazu in der Lage begriffliche Gehalte im Hörer zu aktualisieren oder sie veranlassen ihn dazu, in seinem Wissen danach zu suchen. Die Substantive, Adjektive und Verben bzw. ihre Stämme sind die einfachsten Beispiele für Symbolfeldausdrücke. Hören wir diese Stämme geht es nicht darum unsere Aufmerksamkeit auf etwas im Wahrnehmungs-, Rede-, Text- oder Vorstellungsraum zu richten, sondern wir aktualisieren ein begriffliches Wissen; man könnte auch sagen: einen spezifisch strukturierten Frame mit charakteristischen Anschlussstellen (siehe z.B. Busse 2012).
In Auseinandersetzung mit Bühler hat die Funktionale Pragmatik drei weitere sprachliche Aufgabenfelder ausgemacht (vgl. überblickend Ehlich 2010). Die einzelnen sprachlichen Felder benennen dabei Zweckbereiche sprachlichen Handelns unterhalb der Ebene des Sprechakts. Auf dieser Ebene sprachlichen Handelns wird davon gesprochen, dass “Prozeduren” ausgeführt werden, um spezifische Zwecke zu bearbeiten. Bspw. deiktische Prozeduren mit sprachlichen Mitteln wie ich oder hier zum Zweck der Aufmerksamkeitssynchronisation. Prozeduren sind also Handlungseinheiten, deren Zweck sie zu einem Feld zuordenbar macht. In den verschiedenen Sprachen wurden die sprachlichen Mittel, die diese fünf Aufgabenfelder bearbeiten, jeweils unterschiedlich funktionalisiert. Mit Prozeduren werden sprachliche Akte und Handlungen, also Handlungseinheiten höherer Stufe gebildet.
Die drei weiteren Felder, die die Funktionale Pragmatik unterscheidet, sind die Folgenden: das Bearbeitungsfeld, das Lenkfeld, das Malfeld. Zum Bearbeitungsfeld werden sprachliche Mittel gezählt, die das Verhältnis anderer Ausdrücke zueinander verstehbar machen (operative Prozeduren). Damit erfüllen sie eine spezifische Funktion bei der Konstitution propositionaler Gehalte aus einfachen, aneinandergereihten Ausdrücken. Zum Lenkfeld gehören sprachliche Mittel, die einen ‘direkten’ Eingriff ins hörerseitige Handeln nehmen (expeditive Prozeduren). Hörerseitige Interjektionen beispielsweise geben auf subtile aber äußerst präzise und ökonomische Art und Weise dem Sprecher einen Eindruck davon, wie sein Gesagtes verstanden wird, das er auf diese Verstehenssignale hin anpassen kann. Vokativ und Imperativ gehören ebenso in diese Kategorie.
Was leistet nun diese Kategorie der sprachlichen Prozeduren, versammelt in unterschiedlichen sprachlichen Feldern?
“Es sind nun die sprachlichen Prozeduren, die die sprachliche Realisierung von Handlungen [...] tragen, Scharniere, in denen sich die sprachlichen Funktionen, wie sie sich in den mentalen Prozessen hörerseitig niederschlagen, formal erfassen lassen und damit den bekannten linguistischen Analyse-Instrumentarien öffnen.” (Rehbein 2001: 937)
Mit der Kategorie der Prozeduren wird es also möglich die kleinsten grammatischen Strukturen handlungstheoretisch zu begreifen und zu fragen, was diese Mittel interaktional und kommunikativ leisten. Die Feldzugehörigkeit einzelner Ausdrücke und anderer sprachlicher Mittel ist nicht zwangsläufig eine einfache, d.h. einzelne Ausdrücke können durch Aspekte zweier Prozeduren bestimmt sein und in ihrer Funktionalität gerade davon abhängen. Zudem ist die Feldzugehörigkeit, also die Funktionalität (einzelner) sprachlicher Mittel historisch (und auch subkulturell) veränderlich – wie das bei Sprache immer der Fall ist.
Nun zum letzten Feld, dem Malfeld. Sprachliche Mittel dieses Feldes werden ausgeführt, um expressive Prozeduren zu realisieren. Zum Malfeld heißt es an unterschiedlichen Stellen z.B.:
“Mittels der malenden Prozedur drückt der Sprecher eine affektive Befindlichkeit aus, die er so dem Hörer kommuniziert, um eine vergleichbare Befindlichkeit bei ihm zu erzeugen.” (Ehlich 2010: 541f.)
“Abgleichung der S+H-Einschätzungen” (Ehlich 2009: 435)
“das Malfeld mit Ausdrücken zum Vollzug malender Prozeduren, d.h. im weiten Sinne zur expressiven Verbalisierung von Atmosphärischem und Emotionen, was im Deutschen vor allem durch intonatorische Modulation, kaum durch einzelne Wörter geschieht” (Redder 1998: 67)
“die expressiven Prozeduren des Malfeldes wie Imitationen, geheimnisvolle oder expressive Intonation (wie Toll!), die bei H eine Bewertung bewirken” (Rehbein 2001: 937)
“Solche Prozeduren haben es mit der Kommunikation von situativer “Atmosphäre” und psychophysischer Befindlichkeit, von Stimmung und Emotion zu tun.” (Redder 1994: 240)
Das Malfeld erweist sich in diesen Charakterisierungen wahrlich als ein weites Feld, dessen Bestimmung offenbar noch nicht präzise greifbar ist: Befindlichkeit, Einschätzung, Atmosphärisches, Emotionen, Bewertung. Das scheint mir eine äußerst heterogene Liste zu sein, die andeuten könnte, dass das Malfeld als – wie es sich bisher darstellt – Restkategorie des Subjektiven vielleicht grundlegend überdacht werden sollte.2 Dass sich das so darstellt, liegt auch daran, dass Untersuchungen dazu noch recht rar sind. Redders (1994) Analyse einer Nacherzählens stellt dazu einen ersten Schritt dar. Zu den sprachlichen Mitteln des Malfeldes schreibt sie:
“Es dominieren eindeutig Formen der Modulation. Allerdings sind auch vereinzelte lexikalische Formen verwendet, namentlich ‘ach Gott!’ [...] und das Kompositumelement ‘Riesen-’ [...]. Eine einzig syntaktisch zu nennende Form fällt auf, nämlich die rhythmische Isolierung syntaktisch ansonsten verbundener Ausdrücke [...]; ich habe sie als Parallelismus interpretiert.” (Redder 1994: 253)
Das bringt uns zurück zum obigen Zitat von Goffman, in dem er eine Reihe kommunikativer Mittel hervorhebt, mit denen bewertet, eingeschätzt, eine Befindlichkeit gegenüber dem Gesagten zum Ausdruck gebracht wird. Er beschreibt unterschiedliche intonatorische, modulatorische aber auch nonverbale Mittel der Distanzierung und der Approximation an das Gesagte. Sein Beispiel stammt selbstverständlich aus einem spezifischen Kommunikationsbereich. In der Wissenschaft besteht eine große Notwendigkeit solche Verhältnisse zum Zitierten, um das es hier ja hauptsächlich geht, herzustellen. Genauer: Es besteht essentielle Notwendigkeit eine Positionierung zum bisherigen Forschungsstand darzustellen. Und Goffman hat hier quasi die virtuosen Mittel herausgegriffen, die diesen Zweck auf äußerst subtile und differenzierte Art und Weise bearbeiten und er hat nicht einfache Formulierungsmuster im Blick, die das Zitierte oder Referierte in bestimmter Weise qualifizieren, indem dieses in Matrixsätze wie X betont zu recht, dass oder Y hat sehr treffend herausgearbeitet, dass eingebettet wird (Steinseifer 2010: 95). Das sind gewissermaßen neuralgische Punkte, an denen sich eristische Handlungen manifestieren dürften (vgl. da Silva 2014),3 da die Qualifizierung fremder Erkenntnisse für die Konturierung der eigenen Position – ich bin geneigt zu sagen: der eigenen eristischen Origo – wesentlich ist.
Wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, wir die Beherrschung der Mittel, die dem Hörer oder Leser solche Hinweise geben, mit zunehmender Sozialisation im Wissenschaftsbetrieb immer zahlreicher, immer subtiler und auch (mehrfach) adressierbar.4 Und wie Goffman zeigt, geht es dabei nicht nur um Einschätzungen des Wahrheitsgehaltes vorgängiger Forschung. Wissenschaft ist ja gewissermaßen eine Lebensentscheidung. Zwangsläufig bleiben Befindlichkeiten und Emotionen nicht aus. Fraglich ist nur, wie stark sie einerseits Eingang in die traditionellen Publikationsinfrastrukturen finden DÜRFEN und andererseits, ob sie überhaupt Eingang finden KÖNNEN in diese Verdauerung wissenschaftlicher Kommunikation. Nicht ohne Grund schreibt Goffman:
“In sensing that these vocally tinted lines could not be delivered this way in print, hearers sense they have preferential access to the mind of the author, that live listening provides the kind of contact that reading doesn’t.” (Goffman 1981: 174f.)
In der Tat sind die Mittel, die Redder (1994) herausgearbeitet hat, nicht einfach in die Schriftlichkeit überführbar, ja sie scheinen nicht einmal einfach ‘übersetzbar’ zu sein, wenn man bedenkt, welche stilistischen, ja normativen Anforderungen an den wissenschaftlichen Ausdruck geknüpft sind. Nichtsdestotrotz haben wir alle schon Texte von Kolleg_innen gelesen, die wir gut und lange kennen, mit deren Auffassungen und deren Stil wir vertraut sind. Mit diesem Hintergrundwissen meint man, Spuren malender Prozeduren in einzelnen Texten ganz sicher ausmachen zu können, man ‘hört’ den_die Autor_in und seine_ihre Befindlichkeiten gewissermaßen beim Lesen selbst sprechen. Welche Mittel das sind, die uns diesen Eindruck gewinnen lassen, ist freilich nicht so ohne Weiteres zu sagen. Ist doch schließlich auch das höchst individuell.
Das Problem linguistischer Analysen diesen Zuschnitts ist, dass sie mit zunehmendem Hintergrund-, ja mit zunehmenden Feldwissen zunehmend komplex und detailliert; aber auch zunehmend idiosynkratisch werden. Gerade für das Malfeld, das in weiten Bereichen sicherlich auf gruppenspezifisches Hintergrundwissen aufbaut oder anders: das die detaillierte Kenntnis gemeinsamer oder zumindest geteilter Kommunikationsgeschichte bedarf, um umfänglich verstanden zu werden – gerade für das Malfeld also bedeutet das, dass dessen Rekonstruktion äußerst voraussetzungsreich ist. Genauso verhält es sich mit der titelgebenden Phrase und der gewählten Illustration. Es schließt sich die Frage an, ob es sinnvoll erscheint, diese Voraussetzungen für die Analyse z.B. interner Wissenschaftskommunikation restlos einzuholen. Mir scheint nicht. Sind doch die Mitglieder der akademischen Gemeinschaft, die am Diskurs teilnehmen, i.d.R. auch nicht umfänglich über die Hintergründe verständigt, die die jeweiligen Anspielungen vielleicht nur von den Mitgliedern einer Schule oder gar nur von einer kleinen Gruppe von Kollegen lesbar werden lassen.
Die illokutiven Horizonte5, die wissenschaftliche Texte bergen, weil ihre Autor_innen damit befasst sind, kontinuierlich, konkurrenziell und kooperativ um die Wahrheit zu ringen, sind also mit unterschiedlichen Wissenshintergründen auch unterschiedlich tief zu erschließen. Selbiges kennzeichnet aber auch die Situation des durchschnittlichen Wissenschaftlers, was diese hermeneutische Herausforderung nicht zu einem Spezifikum der Forschungssituation macht, sondern auch die alltägliche Situation der Akteure selbst kennzeichnet.
Literatur
Bühler, Karl (1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Ungekürzter Nachdruck der Ausgabe von 1934. Stuttgart: Gustav Fischer.
Busse, Dietrich (2012): Frame-Semantik. Ein Kompendium. Berlin, Boston: De Gruyter.
Ehlich, Konrad (2009): Interjektion und Responsiv. In: Hoffmann, Ludger (Hg.): Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin, New York: De Gruyter, S. 423–444.
Ehlich, Konrad (2010): Prozedur. In: Glück, Helmut (Hg.): Metzler-Lexikon Sprache. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler, S. 541–542.
Goffman, Erving (1981): The Lecture. In: Erving Goffman: Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, S. 160–196.
Pohl, Thorsten (2007): Studien zur Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens. Tübingen: Niemeyer.
Redder, Angelika (1994): “Bergungsunternehmen” – Prozeduren des Malfeldes beim Erzählen. In: Brünner, Gisela/Graefen, Gabriele (Hg.): Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der funktionalen Pragmatik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 238–264.
Redder, Angelika (1998): Sprachbewusstsein als handlungspraktisches Bewusstsein – eine funktional-pragmatische Diskussion. In: Didaktik Deutsch 3 (5), S. 60–76.
Rehbein, Jochen (2001): Das Konzept der Diskursanalyse. In: Brinker, Klaus/Antos, Gerd/Heinemann, Wolfgang/Sager, Sven F. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Linguistics of Text and Conversation. Berlin, New York: De Gruyter (HSK, 16.2), S. 927–945.
Silva, Ana da (2014): Wissenschaftliche Streitkulturen im Vergleich. Eristische Strukturen in italienischen und deutschen wissenschaftlichen Artikeln. Heidelberg: Synchron.
- Wobei ich betonen möchte, dass ich nicht nur aus Promotionsprojekt bestehe! ;-)
- Überdacht vor allem deswegen, weil die expressiven Prozeduren, im Vergleich zu allen anderen Prozeduren, gewissermaßen omnipräsent sind. D.h. es muss angenommen werden, dass Ausprägungen expressiver Prozeduren überall und immer in unterschiedlicher Markiertheit vorhanden sein müssen, da immer eine Befindlichkeit, Stimmung, Emotionalität in verschiedenen Graden rekonstruiert werden kann. Ein Anschluss an die Diskussionen der linguistischen Stilistik (z.B. die Arbeiten von Fix oder Sandig) erschiene hier sinnvoll.
- Ich bin gerade über Ana da Silvas (2014) Dissertation. Sie ist ganz frisch erschienen und ich freue mich schon auf ihre Analysen.
- Pohl (2007) scheint mir zum Thema der Ontogenese wissenschaftlicher Schreibfähigkeit äußerst reichhaltig und ertragreich zu sein. Dem muss ich bei Gelegenheit noch mehr Aufmerksamkeit widmen.
- Ana da Silva (vgl. 2014: 45f.) spricht von ‘illokutiven Strata’.
Wozu braucht die Linguistik (noch) den Zeichenbegriff?
 Wenn man wissenschaftlich aufwächst an einem Ort, an dem die Zeichennatur der Sprache ganz selbstverständlich vermittelt wird, braucht es – selbst bei professoralem Frischwind – eine Weile, bis man die Grenzen dieses Begriffes wirklich durchschaut und dann zu der unumgänglichen Frage kommt: Wozu ist der dann eigentlich noch gut?
Wenn man wissenschaftlich aufwächst an einem Ort, an dem die Zeichennatur der Sprache ganz selbstverständlich vermittelt wird, braucht es – selbst bei professoralem Frischwind – eine Weile, bis man die Grenzen dieses Begriffes wirklich durchschaut und dann zu der unumgänglichen Frage kommt: Wozu ist der dann eigentlich noch gut?
Jüngst bin ich wieder auf einen Handbuchartikel von Ludwig Jäger gestoßen, den ich noch aus meiner Chemnitzer Zeit als Preprint kannte. Und wie das so ist, wenn man ‘flügge’ wird, stellen sich die Dinge rückblickend manchmal ganz anders und wieder draufschauend ganz neu dar.
Es handelt sich um den Artikel Sprache, erschienen in Binczek, Natalie/Dembeck, Till/Schäfer, Jörgen (Hg.) (2013): Handbuch Medien der Literatur. Berlin: De Gruyter, S. 11–26. Hier möchte ich nicht eingehen auf die sehr guten Gedanken bezüglich der Materilität/Körpergebundenheit von Sprache, ihre bewusstseins- und weltkonstitutive Kraft und die fruchtbare Relektüre von Saussures (2003a; 2003b) nachgelassenen Schriften. Was mich hier interessieren soll, ist der Abschnitt zur “Zeichenhaftigkeit” von Sprache (S. 16-19).
Die Zeichenhaftigkeit von Sprache steht gewissermaßen – auch widerstreitend in meinem Kopf – der Handlungsqualität von Sprache gegenüber. Schließen sich diese beiden Gedanken wechselseitig aus? Sicherlich nicht – auch wenn Ausdrücke wie ‘Zeichenhandeln’ oder ‘Zeichengebrauch’ doch stark den Eindruck einer begrifflichen Krücke machen. Fraglich ist dabei nur, wer wen wie abstützt und auf welche begrifflichen Schwächen das hinweist?
Diese Ausdrücke weisen auf jeden Fall darauf hin, dass dem Begriff des Zeichens die Handlungsqualität nicht unmittelbar zu eigen ist. Man fühlt sich zu dieser Wortbildung oder zur Erwähnung des Determinatums genötigt, um diesen Aspekt am Zeichen hervorzukehren. Solch eine Explikationsform findet sich auch in Jägers Ausführungen zur Sozialitätsbedingung von (sprachlichen) Zeichen:
“Gerade hier hat die Sozialität sprachlicher Zeichen ihren systematischen Ort. Die Konstitution von Bewusstsein ist eng mit dem Gebrauch von Zeichen im diskursiven Horizont sozialen Austauschs verknüpft.” (Jäger 2013: 18; Herv. i.O.)
Im Kontext der Zeichentheorie scheint es also nicht das Determinatum (“-handeln”) zu sein, das es gilt, zu bestimmten und so bspw. Zeichenhandeln von anderem Handeln zu unterscheiden, sondern vielmehr ist es das Determinans (“Zeichen-”), dem hier etwas nebengeordnet wird. Aus dem Determinativkompositum wird in dieser Verwendung ein doppelköpfiges Kopulativkompositum. Die Relation zwischen diesen beiden ‘bestimmenden’ Bestandteilen/Köpfen des Kompositums ist nun relativ unklar. Wie stehen Zeichen und Handlung in einem Verhältnis zueinander? Wie lässt sich Zeichenhandeln hinsichtlich beidem, der Zeichennatur und der Handlungsqualität, bestimmen? Hier deutet sich schon die – m.E. einzige – begriffliche Lösung an, auf die ich am Ende zurückkommen werde.
Vorher soll hier aber darauf eingegangen werden, was für ein Bias allgemein im Zeichenbegriff liegt und wie diesen auch Jäger in seinen zeichenphilosophischen Überlegungen reproduziert, die Handlungsqualität von Sprache daher nur als argumentativen Unterbau gebraucht, sie in der Explikation seines Sprachbegriffs nur randständig behandelt und damit große Bereiche der zur Verfügung stehenden sprachlichen Mittel ausblendet.
Zwar hat Jäger in seinem Handbuchartikel auch einen Abschnitt über die “Funktionalität” von Sprache (S. 12f.), dort deutet sich der eben erwähnte Bias aber schon an. Geht er dort doch nur recht abstrakt auf einerseits die “kommunikativen Funktionen” “der Übertragung, Distribution und Speicherung von Sinn” und andererseits die “kognitive[.] Funktion” ein. Bei letzterer geht es um das Verhältnis von Ich- und Weltbewusstsein und deren wechselseitige, konstruktive Abhängigkeit von einem gesellschaftlichen Gebrauch vergesellschafteter Mittel. Hier spricht er sich also gegen eine simple Auffassung der Relation zwischen Bewusstsein und Welt aus, die in Begriffen des ‘Abbilds’ oder der ‘Wiederspiegelung’ auch in der Linguistik immer noch präsent sind. Die diesbezügliche Pointe ist – platt gesagt – das Medium ist die Botschaft: Die unterschiedlichen Sprachen sind mit ihren Strukturen immer auch Strukturierer: Sprache “verarbeitet keinen sprachtranszendenten Sinn, sondern sie erzeugt Eigensinn” (S. 12).
Wie dieser Eigensinn nun aber en détail und mithin sprachtypologisch je verschieden hervorgebracht wird, fällt aus Jägers philosophischer Perspektive heraus. Dies ist damit auch nicht Thema weder, wenn es um die Funktionalität von Sprache, noch, wenn es um ihre Zeichenhaftigkeit geht. Im Abschnitt zur Zeichenhaftigkeit wird auch wieder deutlich, wie stark Jäger der sprachphilosophischen und wie wenig er der im engeren Sinne linguistischen Diskussion verpflichtet ist.
Der ganze Abschnitt beschäftigt sich mit der großen Frage des Zusammenhangs zwischen materialem Zeichen und mentalem Begriff. Jäger formuliert in diesem Abschnitt vier Bedingungen, die die “Darstellungsleistung” (S. 16) von Sprache ermöglichen. Den Zusammenhang zwischen Ausdruck und Inhalt denkt Jäger also alles andere als (ver)einfach(t) und das begriffliche Entfalten der Handlungsqualität von Sprache torpediert diese Überlegungen m.E. auch nicht. Dennoch sind sie gewissermaßen auf einem Auge blind und einer zeichentheoretischen Tradition verpflichtet, die eine spezifische, durchaus wichtige Qualität von Sprache hervorhebt, damit aber eine Grundcharakteristik verkennt. Eine Reihe von Substantiven, die in diesem Abschnitt präsent sind, können verdeutlichen, um welchen Bias es mir hier geht:
“Bedeutung”, “Begriff”, “Darstellungsmittel”, “Darstellungsleistung”, “Gehalt”, “Ausdruck”, “Inhalt”, “Referenzgegenstände”, “Objekt”.
Weisen nicht alle diese Substantive mit gleicher Intensität in dieselbe Richtung und stammen sie u.a. auch aus unterschiedlichen Philosophenfedern (prominent sind Cassirer, Humboldt, Peirce), so wird doch durch diese Zusammenschau deutlich, dass dem Zeichenbegriff allgemein und auch in Jägers Artikel ganz zentral die Zweiseitigkeit von materialem Zeichen und mentalem Begriff zu eigen ist: aliquid stat pro aliquo. Wie komplex man diese antike Formel auch immer begreifen will, Gültigkeit hat sie nur für einen spezifischen Mittelbereich menschlicher Sprachen: für die “Symbolfeldausdrücke” (vgl. z.B. Redder 2005: 48) oder mit Bühler (1982: 149) die “Nennwörter”. Die funktional-pragmatische Unterscheidung von 5 sprachlichen Feldern (überblickend Ehlich 2007a), also von 5 Aufgaben- oder Zweckbereichen, für die in der Genese der Einzelsprachen die je spezifischen sprachliche Mittel funktionalisiert wurden, knüpft an Bühler an und folgt konsequent einer Rekonstruktion sprachlicher Handlungsqualität.
Die sprachlichen Mittel, die mit dem zeichentheoretischen Bias Jägers ausschließlich in den Blick kommen, sind z.B. Substantive, Adjektive und Verben. Diese werden als Symbolfeldausdrücke verstanden. Symbolische Prozeduren bearbeiten den Zweck begriffliches Wissen in der mentalen Sphäre des Hörers zu aktualisieren:
“In allen Sprachtheorien gilt eine Funktion von Sprache gemeinhin als fundamental, nämlich die des sprachlichen Benennens von Wirklichkeitselementen, mithin der durch nennende Prozeduren vollzogene Zweck. Deshalb erscheinen die Ausdrucksmittel des Symbolfeldes zumeist als sprachliche Mittel par excellence – so auch im Primat der Darstellungsfunktion von Sprache bei Bühler. Gewöhnlich gelten Symbolfeldausdrücke als situationsentbundene, kontextunabhängige Zeichen, eben als Symbole im Sinne der Semiotik. Handlungstheoretisch wird demgegenüber der Zeichenbegriff für Symbolfeldausdrücke wie auch für die anderen sprachlichen Mittel verflüssigt, wenn Zeichen nicht als Basisgrößen gelten, sondern als Mittel zum Vollzug von Prozeduren zwischen S[precher] und H[örer]. Der Zeichenbegriff gewinnt daher in der F[unktionalen] P[ragmatik] eine abgeleitete Qualität. Symbolische Ausdrucksmittel, Ausdrücke des Symbolfeldes also, gelten dann auch nicht länger als Leitgrößen für semantische Konzepte, für Bedeutungshaftigkeit schlechthin. Vielmehr haben alle sprachlichen Ausdrucksmittel gleichermaßen eine prozedurale Bedeutung. Beispielsweise besteht eine symbolische, nennende Prozedur in der Aktualisierung von sprachlich verfasstem Wissen über Wirklichkeit(selemente) [...]; das ist die kategoriale Bedeutung einer nennenden Prozedur. Die besondere, ausdrucksspezifische Prozedur ist im Falle von Symbolfeldausdrücken als das spezifisch zu aktualisierende Wissen zu rekonstruieren.” (Redder 2005: 48f.)
Handlungstheoretisch betrachtet, stellt sich die Rekonstruktion von solchen Ausdrücken also etwas anders dar als mit der Zeichenkonzeption: Es geht nicht nur um “Darstellungsleistung” (S. 16). Es geht vielmehr um die konstitutive Qualität der “kommunikative[n] Dyade” (Weinrich 2006: 17) und damit um die konsequent gestellte Frage, was macht ein sprachliches Mittel wie ein vom Sprecher geäußertes Substantiv mit dem Hörer?
Mehr noch aber führt die handlungstheoretische Sprachkonzeption dazu, zu bemerken, dass eine große Menge sprachlicher Mittel von der Aliquid-stat-pro-aliquo-Vorstellung des Zeichens gar nicht berührt wird: Was für einen begrifflichen Gehalt sollten auch Wörter wie ‘du’, ‘dabei’, ‘er’, ‘aber’, ‘der’, ‘seitdem’ etc. haben? Deren Funktionalität (bei der Konstitution von Ich- und Weltbezug) kann nicht als Zeichen und auch nicht als Zeichenhandeln befriedigend herausgearbeitet werden. In diesem Sinne gewinnt, wie Redder (2005: 48) schreibt, der “Zeichenbegriff” als spezifischer, nicht generalisierbarer Fall nur “abgeleitete Qualität“.
Es bleibt also die Frage, wozu der Zeichenbegriff dann noch taugt? Ist er lediglich ein Begriff für ein spezifisches semantisches Verhältnis, wie es die Symbolfeldausdrücke kennzeichnet? – Ich denke, damit wird man dem Zeichenbegriff der semiologischen Tradition nicht gerecht. Mag er zwar den erörterten Bias aufweisen, liegt doch aber eine Menge seines begrifflichen Gewichtes weniger im ‘Inhalt’ als vielmehr im ‘Ausdruck’! Immer, wenn von Zeichen gesprochen wird, ist unweigerlich seine materiale Beschaffenheit im Fokus, damit seine basale medialisierende Funktion, also das sinnliche Wahrnehmbar-Werden für Sprecher und Hörer im Sprechhandeln oder allgemein im Zeichenhandeln.
Hier kann das ‘Zeichenhandeln’ nämlich wieder als Determinativkompositum ernst genommen werden. Im Verständigungsprozess bedienen wir uns naturgemäß immer “Sprache und mehr” (Linke et al. 2003). Der Zeichenbegriff ist vor dem Hintergrund der obigen Kritik mit dem begrifflichen Fokus auf die medial-materiale Charakteristik des Verständigungsprozesses m.E. ‘nur noch’ dazu geeignet, unterschiedliche Mittelkomplexe kontrastierend beschreibbar zu machen. Mit ihm kann auf die Prozesse der medialen Materialisierung und der daran geknüpften Eigenlogik der Sinnkonstitution abgehoben werden. So kann beispielsweise in den Fokus gelangen, wie Sprache im Vergleich zu Bildern ihre kommunikative Funktionalität aufgrund ihrer spezifischen materialen Struktur entfaltet. Dafür kommen eine Reihe von Bestimmungen infrage, die der Sinnentfaltung während des Sprechens, d.h. während des Material-Werdens von Gedanken, sowohl für den Sprecher wie auch für den Hörer zugrunde liegen. Dies stellt vor allem eine Herausforderung für die Medienlinguistik dar.
Die unumgehbare Linearität des Zu-Verstehen-Gebens und des Verstehens ist da nur die augenfälligste Bestimmung. Ehlich (2007b: 60) hat bspw. die sprachtypologisch unterschiedlich ausprägte Nutzung der materialen Potentiale des menschlichen Stimm- und Hörapparates als “Entscheidungen” beschrieben, die der Bearbeitung sprachinterner Zwecke dienen. ‘Entscheidung’ ist hier freilich nicht teleologisch zu verstehen, sondern weithin metaphorisch.
Der Zeichenbegriff ist also da noch gebrauchbar, wo es darum geht, die unterschiedlichen Mittel kommunikativen Handelns in ihrer materialen Eigenlogik und in ihrem, darauf beruhendem, potentiellen Zusammenwirken zu beschreiben. Jenseits dieser Basisdifferenzierung unterschiedlicher medialer Qualitäten der unterschiedlichen Zeichen, bedarf es aber dann einer handlungstheoretischen Konzeption, um beschreibbar zu machen, in welcher Weise im Verständigungsprozess Sprecher und Hörer gemeinsam sich dieser differenzierten Mittel bedienen, um Verstehen zu ermöglichen.
Bühler, Karl (1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Ungekürzter Nachdruck der Ausgabe von 1934. Stuttgart: Gustav Fischer.
Ehlich, Konrad (2007a): Prozedur. (Eintrag aus dem Metzler-Lexikon Sprache). In: Konrad Ehlich: Sprache und sprachliches Handeln. Band 2: Prozeduren des sprachlichen Handelns. Berlin, New York: De Gruyter, S. 1–2.
Ehlich, Konrad (2007b): Sprachmittel und Sprachzwecke. In: Konrad Ehlich: Sprache und sprachliches Handeln. Band 1: Pragmatik und Sprachtheorie. Berlin, New York: De Gruyter, S. 55–80.
Jäger, Ludwig (2013): Sprache. In: Binczek, Natalie/Dembeck, Till/Schäfer, Jörgen (Hg.): Handbuch Medien der Literatur. Berlin: De Gruyter, S. 11–26.
Linke, Angelika/Ortner, Hanspeter/Portmann-Tselikas, Paul R. (Hg.) (2003): Sprache und mehr. Ansichten einer Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen: Niemeyer.
Redder, Angelika (2005): Wortarten oder sprachliche Felder, Wortartenwechsel oder Feldtransposition? In: Knobloch, Clemens/Schaeder, Burkhard (Hg.): Wortarten und Grammatikalisierung. Perspektiven in System und Erwerb. Berlin, New York: De Gruyter, S. 43–66.
Saussure, Ferdinand de (2003a): Linguistik und Semiologie. Notizen aus dem Nachlass : Texte, Briefe und Dokumente. Gesammelt, übersetzt und eingeleitet von Johannes Fehr. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Saussure, Ferdinand de (2003b): Wissenschaft der Sprache. Neue Texte aus dem Nachlass. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Jäger. Übersetzt und textkritisch bearbeitet von Elisabeth Birk und Mareike Buss. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Weinrich, Harald (2006): Einige kategoriale Überlegungen zur Leiblichkeit und zur ‘Lage’ der Sprache. In: Harald Weinrich: Sprache, das heißt Sprachen. Mit einem vollständigen Schriftenverzeichnis des Autors 1956–2005. 3., ergänzte Auflage. Tübingen: Narr, S. 17–25.
“Sir, To perform my late promise to you, I shall without further ceremony acquaint you, that …”
… schreibt Isaac Newton 1671 in den Philosophical Transactions of the Royal Society. Nein! Eigentlich ist das falsch. In diesem Zusammenhang kann man noch gar nicht von ‘jmd. schreibt etw. in” sprechen. Wir befinden uns vielmehr gerade auf dem Weg dorthin und sehen im Zitat ein Interim.
Nein, Newton schrieb nicht in den Transactions, er schrieb vielmehr an den Herausgeber Henry Oldenburg. Wir befinden uns am Beginn der Entstehung des wissenschaftlichen Artikels und es zeigt sich, dass diese Entstehung eng damit verknüpft ist, dass sich ein Bewusstsein für eine neue Kommunikationsform herausbildet. Die Überreste der alten Kommunikationsform, dem Brief an den Herausgeber nämlich, zeigen sich noch in reduzierter Form. Und vielleicht lässt sich hier eine Parallele ziehen zum Kommentar im (wissenschaftlichen) Weblog?
Die oben beschriebene Konstellation zwischen Newton, Oldenburg, den Transactions und der Royal Society, sowie der lesenden Community wird im Absatz vor Beginn des ‘Papers’ von Oldenburg noch sichtbar gemacht.1 Es wird von einem “Letter” gesprochen, “containing his New Theory“, der dem Herausgeber am 6. Februar geschickt wurde, “in order to be communicated to the R. Society“.
Sprachlich schlägt sich das Kommunikationsformenwissen und die Sprechsituation des Briefes noch in der reduzierten Anrede nieder. Aber dass diese nur noch formal eine Rolle spielt, zeigt sich im unmittelbar angestrebten Beginn der Ausführungen “without further ceremony”. Newton ist sich sehr bewusst, dass es dieser Brief ist, der abgedruckt werden wird. Das zeigt auch der Verweis auf die Vorgeschichte: “To perform my late promise to you”. Interessant ist, dass er als Prädikat “acquaint” nutzt. Newton setzt Oldenburg in Kenntnis, informiert ihn. Ob darin die Umwegskonstellation zum Ausdruck kommt, in der Newton durch Oldenburg zur Community spricht oder ob es Teil der rhetorischen Strategie Newtons ist, wie sie Bazerman (1988, 90) herausarbeitet als Strategie
“to give an account of his findings so that they appear as concrete fact, as real as an earthquake or ore found in Germany, even though the events that made these facts visible to Newton occured in a private laboratory as the result of speculative ponderings and active experimental manipulations.”
Das Spannungsverhältnis zwischen der zunehmenden Privatheit der Erkenntnisproduktion und der In-Kenntnis-Setzung der Community stand ganz am Anfang der Herausbildung der Transactions und bringt mit der Zeit die wissenschaftliche Öffentlichkeit als solche erst hervor.
Die Frage, die sich mir gerade aufdrängte, als ich den Bazerman (1988) las, war die nach der sprachlichen Gestalt von Kommentaren in (wissenschaftlichen) Weblogs. Bisher bin ich noch nicht über Untersuchungen gestolpert, die das genauer im Blick haben, aber es findet sich von Zeit zu Zeit eine Musterhaftigkeit in Blogkommentaren wieder, die sich von Briefen über E-Mails, Newsletter und Mailinglisten auch in Kommentaren in Weblogs durchhält. Es ist die simple Reihe ‘Anrede-Hauptteil-Grußformel’, um die es hier geht. Aus meinem persönlichen Eindruck heraus finde ich es durchaus ungewöhnlich, diese Struktur in einem Kommentar zu verwenden, aber da treffen vielleicht einfach unterschiedliche Generationen Kommunikationsformenwissen (bzw. -konvention) aufeinander. Günther/Wyss (1996, 66) sprechen von den “konstitutiven Elementen, die funktional die Kontaktaufnahme, den Abbruch des Kontaktes und die Übermittlung der Information regeln: Anrede + Text + Gruss“.
Interessant ist nun, wann und warum es zum Wegfall dieser funktionalen Elemente kommt? Bei den Transactions ist das recht einfach zu erklären: Die Kommunikationsform Zeitschrift wurde für Zwecke der Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse funktionalisiert, die spezifische institutionelle Abwicklung (samt Peer Review) muss erst noch entstehen, die Rolle des Herausgebers ist noch viel präsenter, seine medialisierende Rolle ist noch wenig eingeschränkt – er ist noch einer der gewichtigen obligatorischen Passagepunkte (vgl. Star/Griesemer 1989), die zur wissenschaftlichen Öffentlichkeit führen. Im Zuge der Formierung dieser Öffentlichkeit entwickelt sich die eigenständige Gattung des wissenschaftlichen Artikels, der den Zwecken der Briefform entwächst. Mit der Formierung der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ergibt sich also eine ganz andere zu bearbeitende Konstellation, die anderer sprachliche Mittel bedarf (vgl. Graefen/Thielmann 2007).
Warum aber, gibt es Kommentare auf Weblogs mit und ohne diese Elemente der Kontaktbearbeitung? Entgegen der Beteiligungsstruktur der Einträge, die man durchaus als massenmedial (1:n) charakterisieren kann, sind die Kommentare oft primär von einem 1:1 eingeprägt: der Kommentator spricht den Blogger an. Das ermöglicht es erst, dass eine ‘Anrede-Text-Gruß’-Form gewählt werden kann, um eine Kontaktsituation explizit zu etablieren.
Hat sich nun unter Bloggern ein Kommunikationsformenwissen ausgebildet, dass solche funktionalen Elemente obsolet macht? Ich denke nicht, dass sie obsolet geworden sind. Ich denke aber, dass sie gewissermaßen abgegeben oder besser delegiert wurden. Kommentatoren, die selber Bloggen, geben sich über die Kommentareingabemaske oft mit ihrem Blogaccount zu erkennen. Bild und Name (als Link) erscheinen dann über dem Kommentar und weisen die sprechende Person aus. Bei hypotheses.org wird das zum Beispiel so artikuliert “H says: [Datum, Uhrzeit] KOMMENTAR [Antwort-Button]“. In der verdauerten Textoberfläche wird der Kommentator auf diese Weise präsentisch als Diskurspartner vorgehalten (vgl. zu Charakteristika des Diskursiven in Weblogs: Schlobinski/Siever Hg. 2007). Interessanterweise anders als der Autor des Eintrags, der in typischer Schriftlichkeitsmanier unter dem Titel mit “Posted on [Datum] by S” genannt wird. Hier scheint auch eine genauere Datierung nicht notwendig zu sein (zumindest bei hypotheses.org).
Was man also vielleicht sagen könnte, ist, dass die kommentatorenseitige Adresse, die Origo des Kommentierenden schon durch die Metadaten des Kommentars zur Darstellung kommen, dass sie nicht eigens, sprachlich hergestellt werden müssen. Das erklärte zumindest die fehlende Grußformel. Das Fehlen der Anrede könnte (gerade bei wiss. Weblogs) als Sachbezogenheit interpretiert werden: Beziehungspflege ist nicht derart vordergründig, als das sie explizit konturiert werden müsste. Aber dazu braucht es noch aussagekräftige Untersuchungen, die einen solchen Zusammenhang unterstützten. Intuitiv würde ich das nicht auf sachbezogene Blogs reduzieren. Vielmehr habe ich den Eindruck, als würde die Kommunikationsform Weblog sich durch eine gewisse Vororientiertheit von Adressanten-Adresse und Adressaten-Adresse (Meiler 2013) auszeichnen. Die Identitäten der Kommunizierenden sind entweder nicht von Belang oder hinreichend ans Hypertextgeflecht angebunden, in dem sie als solche auch immer präsent, gewissermaßen immer erreichbar sind. Der verdauerte Diskurs der Kommentare braucht u.U. eine präzise Temporalisierung2 und ist deswegen nicht nur von präzisen Zeitangaben, sondern mittlerweile auch von hierarchischen Zuordnungen gekennzeichnet.3 Das scheint der wichtigere, zu bearbeitende Zweckbereich zu sein, der der diskutierten Sache gewissermaßen mehr Priorität einräumt, wenn die Kontaktpflege mehr oder weniger automatisiert ist.
Die vorsichtige These, die seit einiger Zeit in meinem Kopf steckt, wäre also, dass es Kommunikationsformen gibt, wie bspw. Weblogs, bei denen die funktionalen Elemente der Kontaktbearbeitung sich wesentlich aus dem Verbund der Soziotechnik ergeben, an sie delegiert werden und dann nicht mehr sprachlich expliziert werden müssen. Es ist dies vornehmlich eine Frage der Adressenkonstitution.4 Der Übergang, den wir darin also heute beobachten können, könnte dem Interim vergleichbar sein, das wir oben bei Newton sahen…
Bazerman, Charles (1988): Shaping Written Knowledge. The Genre and Activity of the Experimental Research Article in Science. Madison: The University of Wisconsin Press.
Graefen, Gabriele/Thielmann, Winfried (2007): Der Wissenschaftliche Artikel. In: Auer, P./Baßler, H. (Hg.): Reden und Schreiben in der Wissenschaft.Frankfurt/New York: Campus, S. 67-98.
Günther, Ulla/Wyss, Eva Lia (1996): E-Mail-Briefe – eine neue Textsorte zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In: Hess-Lüttich, Ernest W. B. (Hg.): Textstrukturen im Medienwandel. Frankfurt/Main etc.: Lang, S. 61-86.
Meiler, Matthias (2013): Kommunikationsformenadressen oder: Prozeduren des Situationsvollzugs am Beispiel von Weblogs. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 59/2. S. 51-106.
Schlobinski, Peter/Siever, Torsten (Hg.) (2007): Sprachliche und textuelle Merkmale von Weblogs: ein internationales Projekt. In: Networx 46.
Star, Susan Leigh/Griesemer, James R. (1989): Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–1939. In: Social Studies of Science 19. S. 387–420.
Wichter, Sigurd (1991): Zur Computerwortschatz-Ausbreitung in die Gemeinsprache. Elemente der vertikalen Sprachgeschichte einer Sache. Frankfurt/Main: Lang.
- Was ich hier beschreibe, ist keine Neuigkeit, sondern schon wunderbar herausgearbeitet von Bazerman (1988) und z.B. auch Graefen/Thielmann (2007).
- Und eigentlich braucht es keinerlei Lokalisierung, als vielleicht nur die im Hypertext – was schon eine spezifische vor allem zeitbezogene Adressenordnung darstellt; vgl. Meiler (2013).
- Insofern wird das sog. “Mühlen-Prinzip” (Wichter 1991, 78) noch thematisch ergänzt.
- Die Vorstellungen oder besser: das gemeinschaftliche Wissen, das die Kommunizierenden von diesen Adressen haben und die Frage, wie sie diese im Verhältnis zum Kommunizierten einschätzen, ist natürlich nicht vollständig von Gattungs- und Domänencharakteristiken zu trennen.
Problematisieren ohne Problemlösen? Zu einer Passage in Schröders (2003) “Die Handlungsstruktur von Texten”
Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Illokutionsstruktur von Texten. Das ist eines der wichtigsten Bestimmungspunkte meiner Arbeit. Bezüglich dieses Komplexes eine begründete Position herauszuarbeiten, wird die empirische Analyse und ihren theoretischen wie auch praktischen Ertrag wesentlich prägen. In diesem Zusammenhang wurde mir vor einiger Zeit eine Monografie von Thomas Schröder empfohlen. Diese Woche bin ich endlich dazu gekommen, einen Blick in sie zu werfen. Dabei ist mir ein interessanter eristischer Zug in die Hände gefallen.
In seiner Habilitationschrift “Die Handlungsstruktur von Texten. Ein integrativer Beitrag zur Texttheorie” (2003) geht Thomas Schröder (Innsbruck) das Problem an, wie Texte in ihrer Binnenstruktur handlungstheoretisch zu rekonstruieren sind. Das ist eine wichtige und immer noch aktuelle Fragestellung der linguistischen Pragmatik.
Darin findet sich im ‘Theoriekapitel’ die folgende Passage:
“Äußerungs- und Handlungsebene werden also parallel betrachtet: Genauso wie ein Text als Äußerungseinheit ein Produkt aus Sätzen ist, wird auch die Texthandlung als ein Produkt aus „Satzhandlungen“ gesehen. Die möglichen Probleme, die mit einer solchen Parallelsetzung von Sätzen und einfachen Handlungen verbunden sind, werden an dieser Stelle bewußt ausgeklammert. Beide Kategorien, erst recht aber ihr Verhältnis, sind heftig umstritten. Diese Diskussion hier aufzunehmen, würde allzu weit vom Hauptgegenstand der Untersuchung wegführen.” (Schröder 2003, 35f.)
Zurecht weist Schröder hier auf einen Problemkomplex hin, der “heftig umstritten” ist. Dass er so “heftig umstritten” ist, hat den Grund, dass es sich hierbei um eine der zentralen Fragen linguistischer Pragmatik handelt. Und es ist wohl ziemlich normal, dass sich an solchen Fragen, die Geister scheiden.
Um das kurz zu explizieren: Was Schröder da anspricht, ist die Frage des Verhältnisses von Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur. Oder anders: Was sehen wir (Forscher_innen), wenn wir uns die Buchstabenkombinationen eines Textes anschauen? Oder: Welche Leistung vollbringt die Medialität von Sprache? Welches Vermittlungsverhältnis liegt vor?
Schröder beantwortet diese Frage mit einem Abbild- oder Repräsentationsverhältnis. Was wir sehen/hören ist die Handlung: “Äußerungs- und Handlungsebene werden also parallel betrachtet”, kurz darauf spricht er von “Parallelsetzung”. Das ist strenggenommen kein Identitätsverhältnis, wie ich es mit “ist” ausgedrückt habe. Es ist sogar ein spezifisches Differenzverhältnis, dass sich auch in seinen Illokutionsstruktur-Schemata niederschlägt. Zwischen der Handlungs- und der Äußerungsebene ist immer ein weißer Graben gezogen, der zwei formgleiche Seiten trennt: Auf der einen steht Satz, auf der anderen Satzhandlung, Teiltext – Teiltexthandlung, Text – Texthandlung. Was dieser gezogene Graben genau bedeuten soll, wird nicht erklärt. Die Formgleichheit auf beiden Seiten impliziert aber, dass es sich um das parallelgeführte Vermittlungsverhältnis von Oberfläche und Tiefe handelt, was durch die Formgleichheit als Abbildungsverhältnis identifizierbar wird. Die Tiefenstruktur schlägt sich 1:1 in der Oberflächenstruktur nieder. So kann der gezogene Graben zwischen Beiden nur die Vermittlung, die Medialisierung zwischen Mentalem und Medialem meinen, der aber als weißes, unentdecktes Land diagrammatisch einfach übersprungen wird.
Was aber ist eigentlich damit gemeint, wenn von Tiefenstruktur gesprochen wird. Es ist freilich eine konzeptuelle Metapher, die unterstellt, hinter oder unter der wahrnehmbaren Oberfläche der Phänomene gibt es eine wirkende Kraft, die bestimmt, wie die Oberfläche sich ausformt. Nun meinen Linguist_innen, wenn sie von Tiefenstrukturen sprechen, keine metaphysischen Wirkkräfte aufzufinden. Wenn wir von Tiefenstrukturen sprechen, meinen wir gesellschaftliches oder zumindest gemeinschaftliches Sprachwissen, dass anhand der empirischen Oberfläche begrifflich rekonstruiert werden kann. Die sprachliche Oberfläche erscheint in diesem Zuschnitt als Mittelarrangement, dass im sozialen Austausch durch wiederkehrende Handlungskonstellationen zweckadäquat geformt wird. Das ist die Position, wie sie die Funktionale Pragmatik seit den späten 1970er Jahren kontinuierlich entfaltet hat, um eine ganzheitliche, linguistische Perspektive auf sprachliches Handeln herauszuarbeiten: sowohl theoretisch, wie auch empirisch (vgl. z.B. Ehlich 1991; 2007b; Rehbein 2001; Redder 1998).
Arbeiten von Rehbein, Redder und Hoffmann finden sich auch in Schröders Habil. Die Funktionale Pragmatik hat nun den Standpunkt herausgearbeitet, dass kein “Homomorphie”-Verhältnis zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur herausgearbeitet werden kann (Rehbein 2001, 933; Ehlich/Rehbein 1986, Kap. 6) und beziehen damit eine deutliche Position bezüglich des im Zitat problematisierten Sachverhalts.
Mit dem Begriff der Illokution werden nun die Zwecke sprachlicher Handlungen “mittlerer Größenordnung” benennbar: die Zwecke der Sprechhandlungen (Redder 1998, 64). Wie die Sprachakttheorie gezeigt hat, sind diese Benennungen nur selten in der sprachlichen Oberfläche auffindbar oder anders: eine empirische Handlung findet in ihrem Vollzug nur selten eine Explizierung ihres Zwecks durch die Handelnden selbst. In den meisten Fällen ist es also eine hermeneutische Analyseleistung, welche Illokution hinter einer Äußerung verborgen liegt. Diese müssen die Wissenschaftler_innen, wie die Interaktanten gleichermaßen leisten, um zu verstehen; gleichwohl die Interaktanten dies im höheren Maße routiniert leisten, weil sie beim Verstehen freilich ganz andere Interessen verfolgen als ein_e Linguist_in.
Schon diese wenigen Ausführungen reichen aus, um zu verdeutlichen, dass ein einfaches abbildhaftes Parallelisieren von Satz und Handlung nicht ausreichend zu sein scheint, um deren Verhältnis zu bestimmen. Zieht man nun das Verhältnis von Illokution und Handlungsmuster heran (vgl. Ehlich/Rehbein 1979; 1986), wird das noch einmal deutlicher. Denn damit wird ersichtlich, dass Illokutionen nicht einfach in sich selbst aufgehen, sondern zentrale Einheiten im interaktiven Vollzug von Handlungsmustern darstellen (vgl. Ehlich 2007a, 33f.). Ohne die jeweilige Rekonstruktion der Position der einzelnen Sprechhandlung im dazugehörigen Handlungsmuster ist ihre Handlungsqualität nicht ausreichend bestimmbar und damit lässt sich eigentlich erst sinnvoll rekonstruieren, wie einzelne Sprechhandlungen im Text verkettet werden, ohne nur auf “indem”- und “und dann”-Relationen1 zurückgreifen zu müssen. Das möchte ich im Folgenden aber nicht weiter ausführen.
Vielmehr möchte ich noch einen kurzen Blick auf das obige Zitat werfen. Wie wir gesehen haben, wir ein zentrales Problem aufgeworfen, mit dem eine Untersuchung der Handlungsqualität von Texten befasst sein muss, ja mindestens eine Position begründet beziehen muss, um davon ausgehend gewissermaßen erst starten zu können. Schröder geht dabei – wie ich finde – einen recht eigenwilligen Weg. Er problematisiert diesen forschungspraktischen Entscheidungsknoten sehr stark, indem er ihn als “heftig umstritten” kennzeichnet. Ebenso weist er auf “mögliche Probleme” hin, “die mit einer solchen Parallelsetzung von Sätzen und einfachen Handlungen verbunden sind”, um sie gleich darauf “bewußt auszuklammer[n]“.
Schauen wir uns dazu den Kontext (hier kursiviert) des Zitates an:
“Im Mittelpunkt der Handlungsstrukturbeschreibung steht somit der Zerlegungszusammenhang, der zwischen der Texthandlung und ihren Bestandteilen, den Teil-Handlungen, besteht. Als kleinste Einheiten werden dabei die einfachen sprachlichen Handlungen gesehen, denen auf der Äußerungsebene in der Regel die Einheit des Satzes entspricht. Äußerungs- und Handlungsebene werden also parallel betrachtet: Genauso wie ein Text als Äußerungseinheit ein Produkt aus Sätzen ist, wird auch die Texthandlung als ein Produkt aus „Satzhandlungen“ gesehen. Die möglichen Probleme, die mit einer solchen Parallelsetzung von Sätzen und einfachen Handlungen verbunden sind, werden an dieser Stelle bewußt ausgeklammert. Beide Kategorien, erst recht aber ihr Verhältnis, sind heftig umstritten. Diese Diskussion hier aufzunehmen, würde allzu weit vom Hauptgegenstand der Untersuchung wegführen. „Satzhandlungen“ werden deshalb im folgenden ohne weitere Problematisierung als kleinste Bausteine der Handlungsstruktur aufgefaßt (vgl. dazu beispielsweise Motsch/Viehweger 1981, 131 ff. bzw. Motsch 1983 oder, aus anderer Perspektive, Fritz/Muckenhaupt 1981, 17 ff.)” (Schröder 2003, 35f.)
Wie jetzt ersichtlich wird, hat Schröder die Problematisierung des Verhältnisses von Oberfläche und Tiefe eingebettet in die analysepraktische Frage des Zerlegens eines Textes bzw. einer Texthandlung in Einzelhandlungen, deren Zusammenwirken dann als “Handlungsstruktur von Texten” beschrieben werden kann. Die – geradezu schon mechanistisch metaphorisierte – Analysearbeit (‘das Zerlegen’) und ihre Begründung soll bei Schröder nicht weiter diskutiert werden, zu weit führe sie “vom Hauptgegenstand der Untersuchung” weg. Das ist ein legitimer und oft anzutreffender rhetorischer Zug. Ebenso verhält es sich mit dem, was Schopenhauer (1830/2009, 71) vielleicht ein “argumentum ad verecundiam” nennen würde. Das ‘Appellieren an die Ehrfurcht’; hier: vor den früheren Leistungen von Autoritäten. Wobei gerade in dieser gesammelten Platzierung der Literaturverweise an das Ende das Absatzes ihre Rolle innerhalb des Handlungsmusters, dessen Niederschlag sie bilden, veruneindeutigt wird. Dienen Motsch & Co hier dazu, die Lösung des Problems darzustellen, an die er “ohne weitere Problematisierungen” anschließen kann? Oder haben Motsch & Co sich auch ‘nur’ für eine “Parallelsetzung” von Oberfläche und Tiefe entschieden?
Die ambige Setzung der Literaturverweise und die Einbettung einer Problematisierung in eine analysepraktische Entscheidung, ist hörerseitig ganz unterschiedlich zu verstehen – je nach Kenntnis von Motsch & Co. Die musterbezogene Rolle von Motsch & Co variiert dadurch hier zwischen ‘Lösungsversuch’ innerhalb eins Problematisieren-Problemlösen-Musters (vgl. Ehlich/Rehbein 1986, Kap. 2; Wiesmann 2003; Petkova-Kessanlis 2009) und ‘Begründungsversuch’ innerhalb eines Begründen-Musters (vgl. Trautmann 2004; Tzilinis 2011), das zur Anwendung kam, weil (besonders nach diesem Absatz) hörerseitig antizipierbare Einwände zu bearbeiten waren.2
So wird auch hierin noch einmal deutlich, in welcher Weise die Bestimmung illokutiver Qualität von Sprechhandlungen in Texten hochgradig abhängig ist von ihrer Musterbezogenheit und dem vorhandenen Muster- wie Sachwissen.3 Im vorliegenden Fall kann die Vereindeutigung der möglichen Musterposition von Motsch & Co4 darüber geleistet werden, indem man sich diese Forschungsliteratur anschaut und dann einschätzt, zu welcher Musterposition die angegebenen Stellen taugen.
Die besprochene Passage erweist sich mithin als interessanter und äußerst komplexer Fall wissenschaftlichen Streits, der immer auch das Beziehen einer Position bedeutet und dessen Rekonstruktion sich nicht nur im Beschreiben der linearen Oberflächenstrukturen erschöpft.
Literatur
Brinker, Klaus (2000): Textfunktionale Analyse. In: Brinker, Klaus/Antos, Gerd/Heinemann, Wolfgang/Sager, Sven F. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Linguistics of Text and Conversation. Berlin, New York: De Gruyter (HSK, 16.1), S. 175–186.
Ehlich, Konrad (1991): Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse. Ziele und Verfahren. In: Flader, Dieter (Hg.): Verbale Interaktion. Studien zur Empirie und Methodologie der Pragmatik. Stuttgart: Metzler, S. 127–143.
Ehlich, Konrad (2007a): Funktionale Pragmatik – Terme, Themen und Methoden. Jochen Rehbein sexangenario. Erstveröffentlichung in: Deutschunterricht in Japan 4 (1999), S. 4-24. In: Konrad Ehlich: Sprache und sprachliches Handeln. Band 1: Pragmatik und Sprachtheorie. Berlin, New York: De Gruyter, S. 29–46.
Ehlich, Konrad (2007b): Sprachmittel und Sprachzwecke. In: Konrad Ehlich: Sprache und sprachliches Handeln. Band 1: Pragmatik und Sprachtheorie. Berlin, New York: De Gruyter, S. 55–80.
Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1979): Sprachliche Handlungsmuster. In: Soeffner, Hans-Georg (Hg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: Metzler, S. 243–274.
Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1986): Muster und Institution. Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen: Narr.
Petkova-Kessanlis, Mikaela (2009): Musterhaftigkeit und Varianz in linguistischen Zeitschriftenaufsätzen. Sprachhandlungs-, Formulierungs-, Stilmuster und ihre Realisierung in zwei Teiltexten. Frankfurt a.M. etc.: Lang.
Redder, Angelika (1998): Sprachbewusstsein als handlungspraktisches Bewusstsein – eine funktional-pragmatische Diskussion. In: Didaktik Deutsch 3 (5), S. 60–76.
Rehbein, Jochen (2001): Das Konzept der Diskursanalyse. In: Brinker, Klaus/Antos, Gerd/Heinemann, Wolfgang/Sager, Sven F. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Linguistics of Text and Conversation. Berlin, New York: De Gruyter (HSK, 16.2), S. 927–945.
Schopenhauer, Arthur (1830/2009): Die Kunst, Recht zu behalten. Hamburg: Nikol.
Schröder, Thomas (2003): Die Handlungsstruktur von Texten. Ein integrativer Beitrag zur Texttheorie. Tübingen: Narr.
Trautmann, Caroline (2004): Argumentieren. Funktional-pragmatische Analysen praktischer und wissenschaftlicher Diskurse. Frankfurt a.M. etc.: Lang.
Tzilinis, Anastasia (2011): Sprachliches Handeln im neugriechischen Wissenschaftlichen Artikel. Ein Beitrag zur Komparatistik der Wissenschaftssprachen. Heidelberg: Synchron.
Wiesmann, Bettina (2003): Problemlösen, Kategorisieren, Einschätzen – Zur Konzeptualisierung von Wissenschaft in deutsch- und spanischsprachigen Texten. In: Ehlich, Konrad/Steets, Angelika (Hg.): Wissenschaftlich schreiben – lehren und lernen. Berlin, New York: De Gruyter, S. 289–304.
- Diese Relationen spezifiziert Schröder (2003, 42-49) freilich noch und macht – was ich für sehr wichtig halte – Maximen deutlich, auf deren Basis es zu illokutionären Interrelationen kommt. Dass diese Maximen aber weitestgehend aus einem interaktionalen Zusammenspiel zwischen Sprecher und disloziertem Hörer sich ergeben, bleibt bei ihm nur angedeutet.
- Deutlich wird hier ebenso, dass Illokutions- und thematische Struktur nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können, wie Brinker (2000) das macht, wenn er eine Illokutionsstruktur von Texten ganz verneint.
- Natürlich liegen im ausgewählten Abschnitt auch noch andere und kleinräumigere Muster und den dazugehörigen Illokutionen vor, deren Verhältnis zu den übergeordneten ebenso beschrieben werde muss.
- Was ebenso deutlich wird, ist, dass die Einheit ‘Satz’ keineswegs als die kleinste illokutionstragende Einheit verstanden werden kann. Vielmehr scheint es domänenspezifisch ganz unterschiedliche zu sein, welche sprachlichen Mittel Illokutionen unterschiedlichster Art zum Ausdruck bringen können.
Boah! Das ist so off-topic!! oder: Zu einer Interjektion zwischen Lenkfeld und Malfeld?
Ich möchte das Wochenende nutzen, um über etwas nachzudenken, auf das ich durch zwei Sitzungen unseres Forschungskolloquiums gestoßen bin. Die Interjektion BOAH. Eine Beschäftigung damit regte zuerst Ilham Messaoudis Diskussionspapier an. Sie untersucht sprachvergleichend deutsches und türkisches Erzählen – wie es so schön heißt: mulimodal. In ihrem Gesprächsausschnitt, dessen Analyse wir diskutiert haben, kam BOAH auffallend häufig und an einigen wichtigen Stellen vor: sowohl äußerungsinitial als auch responsiv. Ebenso äußerungsinitial präsentierte sich BOAH in einem Tweet, den Johannes Paßmann in einem Diskussionspapier präsentierte. Dieser ist glücklicherweise öffentlich einsehbar:
Mir stellte sich nun besonders die Frage, was diese Interjektion interaktional leistet, was ihr spezifischer kommunikativer Zweck ist. Dafür kann man als erstes fragen, was Interjektionen eigentlich sind; gleichwohl kann und sollte vielleicht sogar die Fragerichtung umgekehrt sein oder noch besser: wechselhaft, dialektisch… der Ordnung halber mache ich es jetzt hier recht linear, wenngleich wir sehen werden, dass wir damit an eine Grenze stoßen werden.
In seiner Habilitation hat Ehlich (1986) eine systematische Rekonstruktion von Interjektionen im Ansatz der Funktionalen Pragmatik vorgenommen. Das ist ein verhältnismäßig altes Buch und so ist dort funktional-pragmatische Konzeptarbeit erster Stunde noch zu beobachten. Eine knappe und aktuellere Übersicht seiner Erkenntnisse findet sich in Ehlich (2009) im “Handbuch der deutschen Wortarten” (hrsg. von Ludger Hoffmann) – einem Buch, das eigentlich stark an der Dekonstruktion der Wortartenkategorie arbeitet, um sich des Erbes griechisch-lateinischer Grammatikschreibung zu entledigen; einem Erbe, das gerade für Fälle wie die Deixeis (vgl. Ehlich 1979) und die Interjektionen keine passende Antwort parat hatte und diese sprachlichen Mittel einer linguistischen Analyse lange Zeit kaum oder nur unter begrifflicher Verlegenheit zugänglich machte. Diese beiden ‘alten’ Bücher Konrad Ehlichs sind allein schon deshalb heute noch außerordentlich aufschlussreich, weil sie die Geschichte der Sprachwissenschaft derart durchsichtig machen, das nachvollziehbar wird, wie heute noch zentrale grammatische Kategorien sich einer Jahrtausende alten philosophischen Tradition verdanken, die Erkenntnisse über Sprache erst einmal gar nicht zum Ziel hatte (vgl. Ehlich 1979, 152) und in ihrer Folge wesentliche Strukturkennzeichen von Sprache in der überkommenen Grammatik verdeckt werden: zuforderst ihre Handlungsqualität.
Aber zurück zu den Interjektionen: Erst in der lateinischen Grammatikschreibung zur Wortart erhoben (interiectio – Dazwischenwerfen; vorher, d.h. bei den Griechen waren sie Adverbien), sind sie lange Zeit eng verknüpft mit Emotionalität (vgl. Ehlich 2009, 424f.). Deswegen und auch aufgrund der formalen Andersartigkeit und der syntaktischen Unberechenbarkeit dieser “Hertzwörtgen” (Longolius 1715, 33) war ihre Bestimmung lange alles andere als systematisch.
Im Theoriegebäude der Funktionalen Pragmatik werden die Interjektionen dem Lenkfeld zugeordnet, mit ihnen prozessiert man also expeditive Prozeduren. “Beim Lenkfeld geht es um die direkte, unmittelbare Einflussnahme in die Handlungsverläufe des je anderen.” (Ehlich 2009, 434) Über den kommunikativen Zweck von Interjektionen als Mittel des Lenkfeldes schreibt Ehlich (1986, 241) in seiner Habil:
“Den Interjektionen kommt also in ihren unterschiedlichen Ausprägungen (und dadurch mit unterschiedlicher Verteilung der Gewichte im einzelnen) die gemeinsame Funktion zu, eine unmittelbare Beziehung zwischen Sprecher und Hörer im Diskurs herzustellen und zu unterhalten. Diese direkte Beziehung ermöglicht es, eine elementare interaktionale Übereinstimmung hinsichtlich des Kontakts überhaupt, hinsichtlich der emotionalen Befindlichkeit, hinsichtlich der diskursiven und mentalen Wissensverarbeitung und hinsichtlich des weiteren Handlungsverlaufs zu gewährleisten.“
Die Interjektionen eint also mit den Bestimmungen der expeditiven Prozeduren, wie der Vokativ und der Imperativ sie ebenso darstellen, eine direkte, ‘unmittelbare’ Einflussnahme auf “das hörerseitige Handeln” (Redder 1998, 67). Daneben bearbeiten sie eine Reihe ganz unterschiedlicher Zwecke die “interaktionale Übereinstimmung” (Ehlich 1986, 241) betreffend: Kontakt, Befindlichkeit, Wissensverarbeitung, Handlungsverlauf. Gerade die emotionale Befindlichkeit ist es, die uns später wieder begegnen wird, wenn wir zu BOAH kommen und sie wird begrifflich einige Probleme machen.
Interjektionen haben nun aufgrund ihrer äußerst ökonomischen Form nur einen geringen Skopus, innerhalb dessen sie interaktional wirksam werden können: Den Punkt, von dem aus sie ihre Wirksamkeit entfalten und den die Interjektierenden mit ihrer Äußerung setzen, hat Ehlich (ebd., 215) für die Untersuchung von HM “diskursive origo” genannt. Die Interjektion scheidet so “Vordiskurs und Folgediskurs” voneinander (ebd., 216). Systematisch ist dieser, wie jeder andere Punkt im Kommunikationsverlauf von “Erwartungen” und “Entwürfen” geprägt (sowohl sprecher- wie hörerseitig), wie es denn weitergehen werde: Interjektionen bearbeiten nun die “Verständigungstätigkeit zwischen den Interaktanten“, indem sie einen abgleichenden Einblick in die Erwartungen, Entwürfe und auch “Risiken” gewähren, die sich ausbilden, sich entwickeln und die drohen können, das Verstehen zu beeinträchtigen (ebd.). Am Punkt der diskursiven Origo wird also durch die Interjektion ein Einblick in die mentale Sphäre des Äußernden gewährt; dieser Einblick ist nun je nach Interjektion je unterschiedlich qualifiziert (siehe die Aufzählung oben). Aber es ist eigentlich leicht verfälschend, von einem Einblick zu sprechen, denn das spräche für eine passive Position des Äußernden, der nur reinschauen lässt, aber nicht quasi durch das offene Fenster greifend, ja lenkend Einfluss nimmt auf den, dem die Interjektion gewidmet ist.
Nun zu BOAH. Zuerst fällt am oben eingeschobenen Tweet auf, dass Interjektionen doch kein “rein diskursives Phänomen” zu sein scheinen (Ehlich 2009, 428). Aber an Kommunikationsformen wie Twitter oder auch z.B. den Facebook-Kommunikationsformen, in denen mir in den letzten Tagen wieder viele BOAHs aufgefallen sind, zeigt sich, dass sich die Dichotomie von Diskurs und Text nicht nur dem Phänomen nach, sondern auch begrifflich auflöst (vgl. Meiler 2013, 64, 90). Wie wäre beim obigen Tweet bei aller öffentlichen Verdauerung und Monologizität und der nur sekundären Möglichkeit von Bidirektionalität hier noch sinnvoll von Diskurs zu sprechen (oder von Text)? Wie dem auch sei; dieses sehr komplexe Problem möchte ich hier heute nicht diskutieren.
Schaut man in die Forschungsliteratur zur BOAH, so tut sich nicht so schnell etwas auf. (Ehrlich gesagt, habe ich das aber auch nicht systematisch betrieben – es ist ja nur ein Wochenendausflug in einen anderen Gegenstand – off-topic eben. Aber getrieben von Google Scholar hat sich dann das ein oder andere aufgetan. Es mag noch mehr zu heben sein!) Die Spur, die ich fand, versteht/verstand BOAH als eine Interjektion der Jugendsprache. Dürscheid (2008, 148) listet BOAH als jugendsprachliche “Routineformel” und verweist in ihrer aufzählenden Darstellung lobend auf die Dissertation von Jannis Androutsopoulos, die sie als anerkanntes “Grundlagenwerk” (ebd.) ausweist, indem sie sagt, dass es als solches “gilt”. Nun, bei Androutsopoulos (1998) findet man BOAH keineswegs als Routineformel behandelt, sondern als Interjektion in der Funktion eines Hörer- und Gliederungssignal (vgl. ebd., 488f., 496f.; u.a. im Anschluss an Weinrich 1993/2003). Weinrich (vgl. 1993/2003, 857-861) unterscheidet situative und expressive Interjektionen, BOAH findet sich bei ihm nicht. Bei Androutsopoulos führt die Spur aber weiter zu Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993), einer Monografie zur “Jugendsprache” mit dem Untertitel: “Fiktion und Wirklichkeit”. Und es zeigt sich z.B. an BOAH, was für ein schwieriges Forschungsfeld die ‘Jugendsprache’ ist, so veränderlich und unein- oder besser unausgrenzbar es ist. Ob BOAH heute noch zur Jugendsprache zu rechnen ist oder jemals zu rechnen war, bezweifelten schon Schlobinski/Kohl/Ludewigt (vgl. 1993, 33). BOAH hat sich heute wohl noch stärker verbreitet und in seiner Bedeutung eine Verallgemeinerung erfahren und damit seinen konnotativen Ballast verloren.
Schlobinski/Kohl/Ludewigt (ebd.) führen das häufige Vorkommen von BOAH in ihrem Korpus (immerhin 11 mal) “eindeutig auf einen medialen Einfluß” zurück: Die um die 1990er “kursierenden Manta-Witze”1, ferner Werner-Comics und der Kabarettist Tom Gerhard gehören demnach zu den Distribuenten von BOAH, die diese Interjektion bis in die Alltagssprache trugen. “Inwieweit das Lautwort durch Comics vorstrukturiert ist, wäre zu prüfen” (ebd.); ebenso, wie zu prüfen wäre, ob es sich dabei früher nicht um eine regional begrenzte Interjektion handelte, die aufgrund der massenmedialen Verarbeitung nun weitere Verbreitung gefunden hat.
Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993, 33) sprechen davon, BOAH habe “spezifische Funktionen” in Manta-Witzen. Welche das sein könnten, führen sie nicht aus. Vielleicht lässt sich dem und damit auch der heutigen Verwendung von BOAH nahekommen, wenn man sich mal einen solchen, wahllos ergoogelten Witz anschaut:
Manta-Fahrer in der Wüste: Kommt ‘ne Fee vorbei und sagt: “Zwei Wünsche hast Du frei!” – “Boah, ey! Echt, ey? Goil ey!” – “Ja wat denn nu?” – “Ne Flasch Bier, die nie leer wird!” Manta-Fahrer hat die Flasche Bier plötzlich in der Hand und trinkt und trinkt und trinkt. “Boah, geil ey! Noch so eine, bitte!” (Quelle)
Auf die Stereotypisierung des Manta-Fahrers muss an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Deutlich wird die enge Verbindung zu EY, die Schlobinski/Kohl/Ludewigt (vgl. 1993, 141) und auch Androutsopoulos (vgl. 1993, 497) noch beobachten, die sich aber heute mittlerweile aufgelöst oder zumindest gelockert zu haben scheint. (Das meint auch der Duden.)
Der Witz inszeniert eine Dialogsituation zwischen dem Manta-Fahrer und einer Fee. BOAH taucht hier gewissermaßen immer responsiv auf – als Reaktion auf etwas: Zuerst als Reaktion auf die zwei Wünsche und dann in Reaktion auf den erfüllten, ersten Wunsch. Nun nimmt die fehlende Intonation – die gerade für die Interjektionen besonders wichtig ist, da sie ein Subsystem im Deutschen bilden, das tonal differenziert ist (vgl. Ehlich 2009, 429) – der Analyse gewissermaßen die Komplexität. Analysen von Youtube-Videos mit dem Tom Gerhard der 1990er könnten da vielleicht Abhilfe schaffen. Doch zeigt sich in ihnen auch eine starke Inszenierung, die mit der heutigen Verwendungsweise nicht mehr viel gemein hat. Nichtsdestotrotz sollten tonale Untersuchungen von BOAH in unterschiedlichen Positionen vorgenommen werden, um zu prüfen, ob sich auch dort eine Ausdifferenzierung eingestellt hat, die eine Grundbedeutung je nach Verwendungsweise modifiziert.
Hier jedenfalls begnügen wir uns mit der verschrifteten Form und also mit der interaktiven Positionierung. Günstig erscheint es, dass BOAH hier nie als vollkommen “selbstsuffiziente Prozedur” (ebd.) erscheint, sondern immer in Reihung bzw. Durchkopplung mit EY quasi semantisch expliziert wird: vor allem durch geil (das der Duden auch noch als jugendsprachlich führt, was m.E. mittlerweile auch zu revidieren wäre). Das responsive oder gar reaktive BOAH scheint in beiden Fällen etwas vorgängiges positiv zu evaluieren. Hier wird also eine diskursive Origo im oben beschriebenen Sinne gesetzt und mit BOAH retrograd auf den Vordiskurs Bezug genommen, indem er evaluiert, bewertet, eingeschätzt wird. Diese Evaluation, die beim Manta-Fahrer immer eine überzeichnet extreme ist, wird damit der Fee unmittelbar zugänglich gemacht, noch bevor sie durch geil auch in einer symbolischen Prozedur zum Ausdruck gebracht wird. Es ist beinahe so, als müsste eine somatische Reaktion nachträglich, transkribierenden vereindeutigt werden (vgl. Jäger 2008). Diese nachträglich transkribierte Verwendung von BOAH zeigt sich aber nicht in allen Manta-Witzen der oben angegeben Quelle.
Mit Echt, ey? findet im obigen Beispiel noch eine andere Explizierung der BOAH-Bedeutung statt. Die Nachfrage verweist auf einen Bruch im Erwarteten, auf eine Überraschung. Zu dieser Einschätzung kommt auch Androutsopoulos (1998, 496): BOAHs “Grundbedeutung ist der Ausdruck von Überraschung, je nach Ko-Text Begeisterung, Bewunderung, Ratlosigkeit oder Überdruß.” “Sowohl von der Bedeutung als auch von der Lautstruktur her”, so Androutsopoulos (ebd.) etwas weiter oben, sei BOAH mit OH verwandt. Er verweist dabei auf die Analyse von Ehlich (1986, 78f.).
Als Grundbedeutung von OH gibt Ehlich (ebd., 78) die “Bezeichnung von emotiven Zuständen des Sprechers” an. Dem Lautlichen nach steht es “dem Stöhnen nahe”, ist aufgrund seiner tonalen Differenzierung aber sprachlich überformt und “als solches kommunikativ einsetzbar” (ebd., 78f.). Als “Ausdruck des Klagens” verweist es auf eine Verletzung der “Integritätszone des Sprechers” (ebd., 79). Je nach tonaler Differenzierung wird eine “positiv eingeschätzte” oder eine “negative eingeschätzte Betroffenheit” zum Ausdruck gebracht (ebd.). Es scheint damit dem System von AH nahezustehen, das es mit der “Verarbeitung im Erwartungsmechanismus” zu tun hat, während OH eher die “emotionale Betroffenheit” ausdrückt (ebd.).
Allein die vergleichsweise formale Komplexität, die BOAH in seiner lautlichen Kombinatorik aufweist, spricht für eine Vermischung beider Funktionen. Wie das ‘B’ dabei zu erklären ist, wäre noch zu eruieren.
“In äußerungsinitialer Position verweist boah den Hörer auf einen visuellen oder akustischen Reiz oder kündigt an, daß der Sprecher gleich etwas (für ihn) Wichtiges, (möglicherweise) Beeindruckendes sagen wird.” (Androutsopoulos 1998, 496) In einer solchen Position finden wir BOAH auch im obigen Tweet; und auch in Ilham Messaoudis Daten war eine solche Verwendung zu finden. Ich bin aber der Meinung, dass man Androutsopoulos Charakterisierung verallgemeinern müsste, um allen Verwendungen gerecht zu werden. Dabei zeigt der Tweet mit der Konversion von ‘Hitler’ zum Adjektiv ‘hitler’ (was der Konversion von ‘Scheiße’ zum nicht-flektierbaren Adjektiv ‘scheiße’ nahe steht) auf diese notwendige Verallgemeinerung: So wie der adjektivische Symbolfeldausdruck ‘hitler’ semantisch nahezu entleert ist zu so etwas wie ‘im extremen Maße negativ’,2 scheint BOAH in äußerungsinitialer Position nicht unbedingt etwas Wichtiges oder Beeindruckendes anzukündigen, sondern allgemein etwas ‘im besonderem Maße zu evaluierendes/evaluiertes’ vorab zu rahmen. Das zeigt sich auch im Manta-Witz, wo es ja um eine besonders positive Evaluierung geht. Dem Hörer wird von dieser diskursiven Origo aus also kenntlich gemacht, dass etwas kommen wird, das in seiner Qualität neben allem anderen vor allem eines ist: besonders extrem. Darin scheint sich wohl auch in der heutigen Gebrauchsweise der stilisierte Menta-Fahrers und die inszenierte Figur ‘Tom Gerhard’ niedergeschlagen zu haben.
In dem was Ehlich (1986, 79) “die emotionale Betroffenheit” nannte, scheint nun ein kategoriales Problem auf. Der Zweck von BOAH und vielleicht auch der von OH scheint nicht ausschließlich im Lenkfeld aufzugehen. Nun war das Malfeld und die ihm zugehörige expressive Prozedur 1986 begrifflich noch nicht aus der Taufe gehoben. Generell ist es bis heute wenig bearbeitet worden, was seinen schillernden und ungreifbaren Status auszumachen scheint. Der Zweck, den das Malfeld bearbeitet, wird manchmal als “Abgleichung der S+H-Einschätzungen” (Ehlich 2009, 435) charakterisiert, manchmal als “expressiv[e] Verbalisierung von Atmosphärischem und Emotionen, was im Deutschen vor allem durch intonatorische Modulation, kaum durch einzelne Wörter geschieht” (Redder 1998, 67).3
Ein Problem mit dem Malfeld habe ich insofern, als dass ich die Untersuchung von Einschätzungen, von Emotionalität nicht nur im Intonatorischen sehe; vielmehr ist wohl anzunehmen, dass dieser Zweckbereich auch im Symbolfeld omnipräsent ist. Gerade Differenzierungen der Wortwahl – nicht nur im Schriftlichen – können meiner Erachtens dafür genutzt werden, die eigene emotionale Gestimmtheit bezüglich eines Sachverhalts (wohl paramalend) zum Ausdruck bringen. Diesem aber habhaft zu werden, wird sich als besonders schwierig herausstellen.
Aber zurück zur Interjektion BOAH: Wie sich andeuten ließ, sind mindestens zwei Verwendungsweisen von BOAH zu differenzieren, solange eine Untersuchung tonaler Differenzen noch nicht geleistet wurde: die äußerungsinitiale, also vom Sprecher gesetzte Interjektion und die responsive, also vom Hörer gesetzte Interjektion. Beide leisten m.E. eine Evaluation der zugehörigen Sachverhalte: einmal antizipierend in Bezug auf den Folgediskurs, das andere Mal den Vordiskurs retrograd evaluierend. Beide Male geht es dabei um etwas Extremes: einmal wird dabei dem Hörer angekündigt, dass er sich auf etwas Extremes vorbereiten kann, seine Erwartungsstruktur wird bearbeitet. Das andere Mal gibt der Hörer zu erkennen, dass seine Erwartungsstruktur auf extreme Weise gebrochen wurde.
Zusätzlich aber, so denke ich, geht es bei BOAH nicht nur um den Überraschungseffekt, sondern ebenso um die emotionale Betroffenheit von Sprecher oder Hörer, wie dies Ehlich (1986, 79) für die Nähe zwischen OH und AH beschrieb. Und diese Form der Betroffenheit zu kommunizieren, ist nun eigentlich ein Zweckbereich des Malfeldes, das 1986, wie gesagt, begrifflich noch nicht gefasst war. Es wird mit BOAH also nicht nur interaktional Eingriff auf den jeweils Adressierten genommen und ihm kenntlich gemacht, dass die Erwartungstruktur bearbeitet wird oder wurde. Sondern ebenso wird damit dem jeweils Adressierten kenntlich gemacht, welche emotionale Haltung der Äußernde dazu einnimmt, in welcher Weise also die extreme Evaluation eingeschätzt wird: positiv oder negativ.
Weitere Untersuchungen – vielleicht ja von Ilham Messaoudi – müssten jetzt anschließen, um zu klären, ob es in der gesprochenen Sprache tonale Differenzierungen gibt, die diese expressive Prozedur über dem grundsätzlich expeditiven BOAH operieren lassen und sie somit zu einer biprozeduralen Interjektion machen. Folglich ließe sich dann klären, ob es nur eine Konsequenz der Schriftlichkeit ist, dass diese Biprozeduralität sich auf eine expeditive reduziert, da die Intonation wegfällt, und der expressive Anteil dann kontextuell erschlossen werden muss.
*Boah! Ist jetzt doch ganz schön viel geworden! ![]() Aber ich beginne, Gefallen zu finden, am Komplex der Interjektionen.
Aber ich beginne, Gefallen zu finden, am Komplex der Interjektionen.
Literatur
Androutsopoulos, Jannis K. (1998): Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Frankfurt a.M. etc.: Lang.
Dürscheid, Christa (2008): Welchen Stellenwert hat Jugendsprache im Unterricht? In: Denkler, Markus/Günthner, Susanne/Imo, Wolfgang/Macha, Jürgen/Meer, Dorothee/Stoltenburg, Benjamin/Topalović, Elvira (Hg.): Frischwärts und unkaputtbar. Sprachverfall oder Sprachwandel im Deutschen. Münster: Aschendorff.
Ehlich, Konrad (1979): Verwendungen der Deixis beim sprachlichen Handeln. Linguistisch-philologische Untersuchung zum hebräischen deiktischen System. 2 Bände. Frankfurt a.M., Bern, Las Vegas: Lang (Forum linguisticum, 24).
Ehlich, Konrad (1986): Interjektionen. Tübingen: Niemeyer.
Ehlich, Konrad (2009): Interjektion und Responsiv. In: Hoffmann, Ludger (Hg.): Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin, New York: De Gruyter, S. 423–444.
Jäger, Ludwig (2008): Transkriptive Verhältnisse. Zur Logik intra- und intermedialer Bezugnahmen in ästhetischen Diskursen. In: Buschmeier, Gabriele/Konrad, Ulrich/Riethmüller, Albrecht (Hg.): Transkription und Fassung in der Musik des 20. Jahrhunderts. Beiträge des Kolloquiums in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, vom 5. bis 6. März 2004. Stuttgart: Franz Steiner, S. 103–134.
Longolius, Johann Daniel (1715): Einleitung zu gründlicher Erkaenntniß einer ieden/insonderheit aber Der Teutschen Sprache/Welcher man sich Zu accurater Untersuchung jeder Sprache/und Besitzung einer untadelhafften Beredsamkeit in gebundenen und ungebundenen Reden/Wie auch besonders In Teutschen für allerley Condition, Alter und Geschlechte/Zu einem deutlichen und nuetzlichen Begriff der Mutter=Sprache/bedienen kan. Kein Verlagsort: David Richter.
Meiler, Matthias (2013): Kommunikationsformenadressen oder: Prozeduren des Situationsvollzugs am Beispiel von Weblogs. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 59 (1), S. 51–106.
Redder, Angelika (1994): “Bergungsunternehmen” – Prozeduren des Malfeldes beim Erzählen. In: Brünner, Gisela/Graefen, Gabriele (Hg.): Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der funktionalen Pragmatik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 238–264.
Redder, Angelika (1998): Sprachbewusstsein als handlungspraktisches Bewusstsein – eine funktional-pragmatische Diskussion. In: Didaktik Deutsch 3 (5), S. 60–76.
Schlobinski, Peter/Kohl, Gaby/Ludewigt, Irmgard (1993): Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Weinrich, Harald (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. 2., revidierte Auflage. Hildesheim, Zürich, New York: Olms.
- Zu diesen gibt es im übrigen eine Verschwörungstheorie, die der Spiegel kommentierte. Und auch Volkskundler haben sich damit beschäftigt und dabei vielleicht ein wenig über die Stränge geschlagen, wie die ZEIT meint.
- Was hier mit ‘hitler’ prädikativ charakterisiert wird, das Entfaven, müsste Johannes Paßmann explizieren.
- Redder (1994) konnte ich bisher noch nicht zur Kenntnis nehmen.
Mensch-Computer-Interaktion: zur Produktionsseite von Weblogs und ihrer Infrastrukturierung
Auf der GfM-Jahrestagung habe ich Anfang Oktober einen Vortrag gehalten. Dort habe ich Weblogs aus medienwissenschaftlicher Perspektive praxeologisch betrachtet. Mit dem Begriff der Infrastruktur (vgl. Star/Bowker 2002; Schabacher 2013) kann man sich so der ‘Kommunikationsform’ Weblog nähern, indem man sie als eine spezifisch verfestigte Auswahl und Kombination von Infrastrukturschicht(ausschnitt)en begreift. In dieser Weise erscheinen die list- und systematisierbaren Eigenschaften von Kommunikationsformen (vgl. Holly 2011, Meiler 2013a) dann als Effekte und Zwecke ihrer Infrastrukturierung. Mein Vortrag hat also einen Gedanken herausgearbeitet, der im Navigationen-Artikel (vgl. Meiler 2013b, auf dem der Vortrag eigentlich basieren sollte) nur angedeutet wurde.

Infrastrukturierung von Weblogs als Selektion und Kombination von Internet-Infrastruktur-Schichten
Eine der Infrastruktur-schichten ist die Weblog-Software selber. Häufig, wie auch hier auf hypotheses.org, ist das WordPress. Die Produktionsseite von Weblogs betreffend stellt sich diese Schicht dann als eine Form der Mensch-Computer-Interaktion dar, wie sie aus sprachwissenschaftlicher Perspektive Jörg Wagner (2002) in seiner Dissertation anhand von MS Word untersucht hat. Einige Gedanken zu diesem Buch und diesem Komplex, der auch für die Analyse von Weblogs eine Rolle spielt, möchte ich im Folgenden festhalten.
Wagner (2002, 22ff.) gibt in seiner Monografie eine umfangreiche Übersicht über all die kommunikativen Ereignisse und Anlässe, die bei der Nutzung von Software möglich sind. Ebenso gibt er auch eine Sichtung darüber, welche “Instanzen der Mensch-Computer-Interaktion” über den Entwicklungsprozess der Software durch die Hardware mit dem Nutzer in einer Verbindung stehen (ebd., 37; hier listend, d.h. stark vereinfacht wiedergegeben):
| Programmierer, Designer, Manager |
→ | Computer-System (Hardware, Docuware, Software) mit den entsprechenden Interfaces |
← | Benutzer |
Trotz der sichtenden Systematisierung lässt Wagner (vgl. ebd., 36f.) aber diesen komplexen Vermittlungszusammenhang für die Analyse nicht wirksam werden. Als analyseleitend fasst er vielmehr die “Metapher des Dialogs zwischen Mensch und Maschine” (ebd., 31) und die Beobachtung, dass die Nutzer selber ihre Auseinandersetzung mit dem Computer als eine Erfahrung modellieren, die im Computer keine Medialisierung der Softwareentwickler erblickt, sondern den Computer bzw. das jeweilige Programm selber als interaktives Gegenüber konzeptualisiert. Für die empirische Analyse hat das nachhaltige Folgen. Wagner arbeitet sich nämlich im Kapitel 4 in nicht unerheblichen Maßen an Erkenntnissen der Gesprochenen-Sprache-Forschung ab (u.a. der Konversationsanalyse, den Griceschen Maximen und auch der weithin bekannten und für sinnvoll erachteten Unterscheidung von medialer und konzeptueller Mündlichkeit/Schriftlichkeit). Selbstverständlich ist es nicht falsch, ganz im Gegenteil: sogar fruchtbar die Verschiebungen und Ableitungen im Blick zu haben, die hinsichtlich sprachlicher Handlungen zwischen Kommunikationsituationen unter Kopräsenz der Interaktanten und Kommunikationsituationen unter deren Depräsenz (Verdauerung) stattfinden. Dabei aber den Computer bzw. die Software selbst als sprechendes Subjekt zu begreifen, wird der beobachtbaren sprachlichen Charakteristik nicht gerecht.1
Bevor also Charakteristika von Gesprächen an die sprachliche Front-End-Gestalt von Software herangetragen werden, müsste einerseits die Präferenzorganisation der semiologischen Oberfläche der Software selbst in den Blick kommen. Dafür hat man auch schon in der KA Arbeiten vorgelegt, die die Präferenzorganisation von Texten analysieren (vgl. z.B. Knauth/Wolff 1991).2 Andererseits müsste die Kommunikationssituation, die mit den sprachlichen und anderen kommunikativen Mitteln der Software zugänglich wird, selbst systematisch rekonstruiert werden. Damit wären verschiedene Vagheiten, Irrläufer und inadäquate Meldungen nicht als defizitäre Kommunikation zu betrachten, sondern als wohl unausweichliche Randerscheinungen, die sich aus der Charakteristik der Kommunikationssituation ergeben: Die mannigfaltigen Arten und Weisen der Nutzung und die damit möglich werdenden Probleme bei der Nutzung einer Software durch unterschiedlich versierte Nutzer muss und kann weitgehend nur antizipiert werden. Diese Probleme kann auch ein Participatory-Design-Prozess nicht vollkommen ausräumen (vgl. Pipek/Wulf 2009, 9).3
Eine Software wie WordPress stellt nun den Endpunkt eines soziotechnischen Verfestigungsprozesses dar. Die unterschiedlichen, historischen Vorläufer und Frühformen von Weblogs haben entsprechend dieser Prägung Eingang in die Struktur der Software gefunden, da sich im Verlauf ihrer (Aus-)Formung bestimmte Aspekte als vorteilig, bestimmte andere Aspekte als nachteilig bei der Bearbeitung der entsprechenden Kommunikationsbedürfnisse erwiesen haben, für die die entsprechende (Interims-)Form genutzt wurde (vgl. Holly 1996). Das, was wir heute als Weblogsoftware WordPress vorfinden, ist also Resultat eines langen Verfestigungs- oder medienwissenschaftlich präziser: Infrastrukturierungsprozesses. Sie macht es möglich vornehmlich bereits verfestigte gesellschaftliche Bedürfnisse bezüglich des Bloggens zu bearbeiten und leistet damit der Stabilisierung (d.h. sowohl Standardisierung wie auch Konventionalisierung) des Bloggens Vorschub, indem sie den Spielraum für Veränderungen durch die gegebene Struktur einschränkt.4
In diesem Lichte ist es dann auch sinnvoll von einem Affordanz-Charakter einer Kommunikationsform zu sprechen (vgl. Pentzold/Fraas/Meier 2013): Bestimmte Nutzungsweisen werden von der Weblog-Software nahegelegt, da ein gesellschaftlich mehr oder weniger stabilisiertes Wissen um die stereotype Nutzungsweise von Weblogs aufgebaut wurde/sich herausgebildet hat. Dieses Wissen prägt auch die kommunikative Oberfläche der Software, die in der produktionsseitigen Mensch-Software-Interaktion beim Bloggen notwendig zu ‘nutzen’ ist.
Diese Nutzung kann als vorstrukturierte Kommunikation betrachtet werden. Ihre historischen Vorbilder findet sie wohl in Formularen – einer Form des zerdehnt-dialogischen Modus der Themenentfaltung qua sequenziertem Frage-Antwort-Muster (vgl. Ehlich/Rehbein 1979). Und diese Form ist älter, als man auf den ersten Blick vermuten würde, wie das Marculfi Formulae, ein ‘Formularbuch’ aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, zeigt.
Für Weblogs ist kennzeichnend, dass ein Großteil dieses Formularcharakters produktionsseitig und rezeptionsseitig nur asymmetrisch zugänglich ist (im Vergleich etwa zu Social Network Systems wie Facebook, bei denen Nutzer zwangsläufig die Produktions- und Rezeptionsbedingungen kennen). Rezipienten ist – sofern sie nicht selber Bloggen – nur die Kommentarfunktion und dessen Formular zugänglich. Dem Blogger selber hingegen steht mit dem sog. Dashboard eine umfangreiche Schnittstelle zur Softwareinfrastruktur seines Blogs zur Verfügung, mit dem er einen Großteil der Einstellungen vornehmen kann, die die Front-End-Gestalt seines Blogs, also seiner Kommunikationen betreffen.
Wird der Blog auf einem eigenen Webspace betrieben, kommt mit dem nötigen FTP-Programm eine weitere Schnittstelle zu einer weiteren Infrastruktur-Schicht hinzu, mit dem WordPress auf dem Webspace installiert werden muss, bevor es (wiederum als Infrastruktur) nutzbar werden kann. Um den Webspace selber – also den physikalischen Speicherplatz – für WordPress operational zugänglich zu machen, bedarf es weiterer Schichtungen: die Webserver-Software (z.B. Apache); die Skriptsprache PHP, die on demand HTML-Seiten generiert sowie eine MySQL-Datenbank, auf die WordPress zugreifen kann. Das Ineinandergreifen dieser Infrastrukturen in ihrer spezifischen Kombination macht die Infrastrukturierung von Weblogs aus und bildet die Möglichkeitsbedingung für Kommunikation mit der Kommunikationsform ‘Weblog’.5
Die Navigationsleiste eröffnet den Zugang zu den einzelnen formularisch bearbeitbaren Optionen: Artikel (Blogeinträge), Mediathek (Datenbank eingebundener Bilder), Links (Blogroll), Seiten (Reiter des Weblogs), Kommentare, Design, Benutzer(verwaltung), Einstellungen und anderes mehr. Diese Bearbeitungskomplexe werden – nach meiner eigener Erfahrung – je nach Bedarf und Kompetenz handlungspraktisch relevant und müssen keineswegs alle erschlossen werden, um den Blog funktionabel zu machen. Standardisierte Voreinstellungen gewährleisten vor allem für WordPress-Unerfahrene ein unkompliziertes Handling und einen schnellen Start. Die spezifische Infrastrukturierung ist damit nicht mehr notwendigerweise eine individuell zu leistende Aufgabe, sondern eine gesellschaftlich verfestigte Problemlösung, um die Möglichkeitsbedingungen für einen Kommunikationsstart zu gewährleisten (vgl. Meiler 2013a). Plattformen wie hypotheses.org leisten dem – für das wissenschaftliche Bloggen – besonderen Vorschub und bilden für die spezifische Domäne der Wissenschaft eine spezifische Lösung, wie z.B. die Google-Anwendung blogger.com eine allgemeine und noch einfachere Lösung ohne Domänenspezifik darstellt.
Deppermann, Arnulf (2013): Analytikerwissen, Teilnehmerwissen und soziale Wirklichkeit in der ethnographischen Gesprächsanalyse. In: Hartung, Martin/Deppermann, Arnulf (Hg.): Gesprochenes und Geschriebenes im Wandel der Zeit. Festschrift für Johannes Schwitalla. Verlag für Gesprächsforschung. S. 32-59.
Ehlich, Konrad (1984): Zum Textbegriff. In: Rothkegel, Annely/Sandig, Barbara (Hg.): Text – Textsorten – Semantik. Buske. S. 9-25.
Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1979): Sprachliche Handlungsmuster. In: Soeffner, Hans-Georg (Hg.): Interpretative Verfahren in den Text- und Sozialwissenschaften. Metzler, S. 243-274.
Holly, Werner (1996): Alte und neue Medien. Zur inneren Logik der Mediengeschichte. In: Rüschoff, Bernd/Schmitz, Ulrich (Hrsg.): Kommunikation und Lernen mit alten und neuen Medien Lang, S. 9-16.
Holly, Werner (2011): Medien, Kommunikationsformen, Textsortenfamilien. In: Habscheid, Stephan (Hrsg.): Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen. Linguistische Typologien der Kommunikation. de Gruyter, S. 144-163.
Knauth, Bettina/Wolff, Stephan (1991): Zur Fruchtbarkeit der Konversationsanalyse für die Untersuchung schriftlicher Texte – dargestellt am Fall der Präferenzorganisation in psychiatrischen “Obergutachten”. In: Zeitschrift für Soziologie 20/1, S. 36-49.
Meiler, Matthias (2013a/i.Dr.): Kommunikationsformenadressen oder: Prozeduren des Situationsvollzugs am Beispiel von Weblogs. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 2, S. 51-106.
Meiler, Matthias (2013): Geoberg.de – ein wissenschaftlicher Weblog. Kommunikationsform und institutionelle Position. In: Navigationen. Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften 2. S. 87-99.
Paßmann, Johannes/Gerlitz, Caroline (2013/i.Dr.): ‚Good‘ platform-political reasons for ‚bad‘ platform-data. Zur sozio-technischen Geschichte der Plattformaktivitäten Fav, Retweet und Like. In: Mediale Kontrolle unter Beobachtung. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die strittige Gestaltung unserer Kommunikation. Dez. 2013.
Pentzold, Christian/Fraas, Claudia/Meier, Stefan (2013): Online-mediale Texte. Kommunikationsformen, Affordanzen, Interfaces. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik, 41(1), S. 81-101.
Pipek, Volkmar/Wulf, Volker (2009): Infrastructuring: Towards an Integrated Perspective on the Design and Use of Information Technology. In: Journal of the Association of Information Systems 10/5, S. 306-332 [zitiert nach dem PDF: 1-54].
Schabacher, Gabriele (2013): Mobilizing Transport. Media, Actor-Worlds, and Infrastructures. In: Transfers. International Journal of Mobility Studies 3 (1), S. 75-95.
Star, Susan Leigh/Bowker, Geoffrey C. (2002): How to Infrastructure. In: Lievrouw, Leah A./Livingstone, Sonia (Hg.): Handbook of New Media. Social Shaping and Consequences of ICTs. London et al., S. 151-162.
Wagner, Jörg (2002): Mensch-Computer-Interaktion. Sprachwissenschaftliche Aspekte. Lang.
- Die ethnografische Prämisse “Follow the natives!” erweist sich hier also als analytischer und vor allem konzeptueller Holzweg. Ethnokategorien und -methoden können den Blick für die beobachtbaren Sachverhalte auch verstellen.
- Wenngleich die analytischen Prämissen der KA gerade der Institutionsspezifik von Kommunikation aus dem Blick zu verlieren drohen (vgl. Deppermann 2013, 47).
- Im Übrigen sprechen gerade solche Ansätze der Sozioinformatik für eine Konzeptualisierung der Softwarenutzung als spezifisch zerdehnte Kommunikationssituation (vgl. Ehlich 1984) zwischen Entwicklern und Nutzern und nicht als Kommunikation zwischen Software und Nutzer.
- Dieser dispositive Charakter schließt selbstverständlich Veränderungen, die bottom up angeregt werden, nicht aus. Gerade Internetkommunikationsformen sind aufgrund ihrer Digitalität für solche Veränderungen besonders empfänglich. Eine bottom-up-Unidirektionalität trifft aber diese komplexen (dispositiven) Wirkzusammenhänge nicht zwangsläufig (vgl. Paßmann/Gerlitz 2013).
- Selbstverständlich stellen Browser, Betriebssystem und unterschiedliche Front-End-Devices weitere Infrastrukturschichten dar, die standardisiert ineinander greifen können müssen.
Was ist eigentlich (alles) Eristik? oder: Weblogs as Academic Communication Practices
Am 18.07.2013 habe ich im Rahmen der internationalen Summer School Situating Media. Ethnographic Inquiries into Mediation (15.-19. Juli 2013) von Locating Media mein Dissertationsprojekt vorgestellt (Vortragstext und PPP auf Seite 2). Die anschließende Diskussion stieß einige Überlegungen zu meinem zentralen Untersuchungsgegenstand, den eristischen Kommunikationshandlungen, an. Die grundlegende Frage ist: Was ist eigentlich (alles) Eristik?
Schaut man in die funktional-pragmatische Literatur hinein, findet man da – so weit ich das zur Zeit überblicken kann – nur bedingt die Präzision, die man sonst gewohnt ist. Die konzeptuelle Gründungsurkunde zur ‘Eristik’ wissenschaftlicher Kommunikation wurde 1993 von Konrad Ehlich vorgelegt: Was er darin in ersten wenngleich fundamentalen Überlegungen durchsichtig macht, ist die Komplexität wissenschaftlicher Text, die nicht als bloße Assertionsverkettungen verstanden werden können. Zwei Aspekte sind dabei wesentlich: (1) – und das gilt nicht nur für wissenschaftliche Texte – sind Texte in ihrer Abgeleitetheit von Gesprächen zu rekonstruieren. (2) sind wissenschaftliche Texte von spezifischen Gesprächen abgeleitet, die ihr Gepräge vom – wenn man so sagen will – Funktionssystem der Wissenschaft bekommen und damit zu spezifischem verdauerndem/tem Kommunikationshandeln führen.
Ehlichs Beobachtungen gehen dabei aus von einer Auffälligkeit sprachlicher Mittel in wissenschaftlichen Texten und er bindet diese Auffälligkeit zurück an eine allgemeine Zweckbestimmung wissenschaftlicher Kommunikation nämlich der Einbringung eines (neuen) Wissens in den wissenschaftlichen Diskurs (im Foucaultschen Sinne). Ausgehend von der damals vorherrschenden Auffassung, Wissenschaftskommunikation sei aufgrund der “Weltwiedergabe-Funktion” von Assertionen/Aussagen (in Form von Aussagesätzen) durch Assertionsverkettung gekennzeichnet, die eine “Weitergabe von Wissen bzw. [...] dessen Expansion zu neuem Wissen” ermöglichten (Ehlich 1993, 24), macht er in exemplarischen wissenschaftlichen Texten eine Reihe von sprachlichen Mitteln aus, die die vermeintlichen Aussagesätze illokutiv modifizieren. Eines seiner Beispiele ist folgendes:
“Die Oberrheinische Tiefebene ist streng genommen nur teilweise eine Ebene.” (aus: Semmel, Arno: Geomorphologie der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: Steiner 1972, 38; zitiert nach Ehlich 1993, 36; Typografie von mir)
“Dieses ‘strenggenommen’ ist [...] kein Teil einer einfachen Assertion, die dadurch illokutiv einen ganz anderen Stellenwert erhält, eine andere Charakterisierung bekommt.” (ebd., 26) Es handelt sich vielmehr um eine Modalisierung, deren Funktionalität nicht im Rahmen einer ‘bloßen’ Aussage erklärt werden kann, da diese Modalisierung ein spezifisches Wissen des wissenschaftlichen Diskurses und damit Auffassungen anderer Wissenschaftler der entsprechenden Provenienz fokussiert und eine differenziertere Haltung dazu einnimmt bzw. ankündigt, als das bisher offenbar der Fall war.
Und selbst für die Assertion im Allgemeinen stellt sich schon die Frage, wie sie in Texten – und das heißt für Ehlich (z.B. 1984) in verdauerter/gespeicherter, Raum und Zeit überwindender Kommunikation – prozessiert werden kann. Ist die Assertion doch aufs engste mit dem Handlungsmuster Frage-Antwort verknüpft.
“Aufgrund der engen Verknüpfung von A s s e r t i o n und F r a g e als über ihre Zwecke miteinander wesentlich verkoppelten Sprechhandlungen stellt sich für die illokutive Qualifizierung von Wissenschaftstexten die Frage nach dem interaktionalen Verbleib dieser F r a g e n.” (Ehlich 1993, 24)
Ein anderes Beispiel aus dem oben schon zitierten geomorphologischen Fachbuch:
“Die Rheinaue soll vom holozänen Rhein in das Hochgestade eingeschnitten worden sein (so z.B. STÄBLEIN 1968, 11).” (zitiert nach Ehlich 1993, 36; Typografie von mir)
Auch hier wieder eine Modalisierung und eine direkte Adressierung/Adresse dieser Modalisierung. Die sprachlichen Mittel, die hier an der kommunikativen Oberfläche sichtbar werden, sind
“Teil eines komplexen Prozesses, der in der sprachlichen Formulierung aufscheint, und zwar eines Komplexes der Urteilsbildung in bezug auf Gewährsleute, die aber sozusagen gerade keine Authentizität und Verläßlichkeit haben.” (ebd., 26)
“Es finden sich immer wieder Passagen, in denen der Autor in einen imaginären Diskurs [= Gespräch; MM.] eintritt mit anderen Autoren, also zum Beispiel in der Qualifizierung als ‘zunächst’, in der Bestimmung des ‘gilt nur’ oder des ‘bietet sich dazu an’.” (ebd., 28)
Ehlich resümiert aus den oben angedeuteten und anderen Beobachtungen wie folgt:
“Wir finden also als illokutive Qualität neben der a s s e r t i v e n Struktur eine weitere Grundstruktur, nämlich eine Struktur der E r i s t i k.” (ebd., 29)
Um die Frage nocheinmal zu stellen: Was ist nun eigentlich (alles) Eristik? Das letzte Zitat fährt wie folgt fort (für das Verständnis sind die hervorgehobenen Passagen ausreichend):
“Wenn dem aber so ist, dann sind wissenschaftliche Texte selbst gleichsam immer auch Ausdruck einer Streitkultur. Ich verwende den Ausdruck ‘Streit’ dabei in einem durchaus positiven Sinn. Streit hat nichts mit Gezänk zu tun, sondern Streit ist, wie es in verschiedenen wissenschaftstheoretischen Positionen, etwa bei Popper, sehr explizit ausgearbeitet wurde, für den Wissenschaftsbetrieb als eine wissenschaftssoziologisch erfaßbare Größe insgesamt gekennzeichnet. Dies gilt bereits für die Wissenschaft vor der neuzeitlichen, wenn auch dort in einer ganz anderen Weise hinsichtlich dessen, was die Entscheidungsgründe für den Streit ausmachte. Diese Streitkultur als diskursive Struktur findet sich keineswegs nur in Texten, die den sozialen Wissenschaften nahestehen, sie findet sich ganz genauso in Texten der Naturwissenschaften oder der Mathematik. [...]
Wenn wissenschaftliche Texte also in diesem Sinne Kombinationen von einerseits Sachverhaltswiedergaben in der Familie der a s s e r t i v e n illokutiven Typen, andererseits ein Niederschlag von jeweils wissenschaftshistorisch und wissenschaftstheoretisch spezifisch geprägten und ausgeprägten Streitkulturen sind, dann, denke ich, erweisen sich diese Texte als außerordentlich komplexe Einheiten, Einheiten, die praktisch das schwierige Verhältnis von Diskurs [= Gespräch; MM.] und Text in der textuellen Oberfläche abbilden [...].
Wir sehen in diesen Texten also weit mehr als das einfache ‘mapping’ von Wirklichkeit über mentale Verarbeitung hinein in ein Stück Sprache. Wir erleben in den sprachlichen Formen den Prozeß der Diskussion der Wissenschaft selbst. In den Texten ist die diskursive Qualität des Wissenschaftsprozesses als eines Prozesses der streitenden Auseinandersetzung eingeschrieben. Mit anderen Worten: Der Wissenschaftsprozeß schlägt sich in der Textstruktur in einer illokutiven Vielfalt nieder, die eine Einschränkung auf Assertionsqualität illokutiv weder sinnvoll noch möglich macht. Vielmehr tragen die wissenschaftlichen Texte als ein wesentliches Strukturkennzeichen in sich ihren diskursiven Charakter, der durch die Textualität verfremdet worden ist. Die wissenschaftlichen Texte sind sozusagen Residuen und Petrefakte von diskursiven, insbesondere von eristischen Strukturen, die in den textuellen Strukturen aufgehoben sind.” (ebd. 29f.; Herv. als fett von mir)
Diese doch etwas redundanten Passagen können pointiert zu den zwei Aspekten vom Anfang zusammengefasst werden: (1) die illokutive Qualität von Texten ist ein Schlüssel zum Verhältnis von Gespräch und Text im Allgemeinen und (2) für das Verhältnis von wissenschaftlichem Gespräch und wissenschaftlichem Text im Besonderen. Die sprachhandlungsorientierte Rekonstruktion von Ehlich, die hier referiert wurde, legt es nahe, ein Verhältnis des Abgeleitet-Seins oder des Hineinwirkens des Einen vom Anderen oder des Einen ins Andere anzunehmen. Für dieses Verhältnis von Gespräch und Text zueinander als Grundformen menschlicher Kommunikation verwendet Ehlich die folgenden Ausdrücke und Prädikationen:
Ausdruck sein, findet sich, Niederschlag, Verhältnis abbilden, eingeschrieben sein, schlägt sich nieder, tragen in sich, verfremdet sein, Residuen und Petrefakte sein, aufgehoben sein (dem letzten Zitat entnommen)
Wenngleich ich die Annahme des phylo- und ontogenetischen Primäts der gesprochenen Sprache für sinnvoll halte, stellt sich hier doch die Frage des präzisen Verhältnisses zwischen diesen Grundformen und damit unmittelbar die Frage, welchen Einfluss bei diesem Transpositionsprozess die spezifische Medialität von flüchtiger und verdauerter Kommunikation haben. Was die beiden Aspekte (1) und (2) unmittelbar miteinander verknüpft. Ich werde auf diesen Komplex unten zurückkommen.
Zuvor soll die Frage der Extension und Intension des Eristikbegriffs angesprochen werden, womit wir wieder beim Ausgangsimpuls zu diesem Blogeintrag ankommen, der auf der eingangs erwähnten Summer School angestoßen wurde.
Zusammenfassend gesagt (und da ist die Wortbildung ‘Eristik’ irreführend) sind eristische Strukturen eine Menge von sprachlichen oder allgemeiner kommunikativen Mitteln, die für den Zweck gesellschaftlich erarbeitet wurden bzw. sich herausgebildet haben, ein (neues) Wissen in den bestehenden und aktuellen Diskurs (Foucault) einzubringen. Entsprechend dieser (sehr) allgemeinen und übergreifenden Zweckbestimmung wissenschaftlicher Kommunikation ist auch die Menge der Mittel, die diesen Zweck bearbeiten quasi (noch) nicht eingegrenzt, wie da Silva (2010)1 mit ihrem Konzeptualisierung eristischer Strukturen zeigt. Sie hat quasi (fast) alle genuin linguistische Analyseebenen im Blick (Morphem, Wort- und Phrasenebene, Satz und Satzfolge, Textabschnitte, Kapitel, ganze Texte, nicht aber Textverbünde), wenn sie die Funktionalität sprachlicher Mittel im Hinblick auf den ‘eristischen Zweck’2 mit den Faktoren “Gradualität”3 und vor allem “Komulativität” charakterisiert (ebd., 130ff.). Beim ersten Faktor geht es kurz gesagt um Perspikuität vs. Opazität, also um die “Erkennbarkeit auf der sprachlichen Oberfläche” von eristischen Handlungen (ebd., 130). Beim zweiten Faktor geht es um die Kombinatorik einzelner Mittel im ‘Verlauf’ der wissenschaftlichen Texte und wie diese den ‘eristischen Zweck’ zusammen/im Zusammenwirken/im Verbund: eben kombinatorisch und komulativ bearbeiten (vgl. ebd., 133f.). Die Sprachhandlungsqualität, also die Vermittelung zwischen Sprecher und Hörer/zwischen Produzent und Rezipient kommunikativer Handlungen ist in dieser Konzeptualisierung bzw. diesem Konzeptausbau nicht bzw. nur indirekt fokussiert. Die Differenzierung des Ehlichschen Begriffes trifft eher seinen strukturellen und weniger seinen pragmatischen Anteil.
Eine handlungs- bzw. handlungsmusterbezogene Differenzierung dessen was alles Eristik ist, fehlt – soweit ich das momentan überblicken kann, aber noch. Für eine Rekonstruktion des oben angesprochenen Verhältnisses zwischen Gespräch und Text wäre diese Differenzierung aber unerlässlich. Dafür könnte sich die Arbeit von Trautmann (2004) zum Argumentieren als äußerst fruchtbar erweisen. In ihrer Dissertation nimmt sie ausgehend vom Handlungsmuster Begründen (vgl. Ehlich/Rehbein 1986) eine empirisch angeleitete Bestimmung des Musters Argumentieren vor,4 das im Kontrast zum Begründungsmuster nicht von einem Nicht-Verstehen, sondern von einem divergierenden Verstehen konstitutiv abhängt.
Konstitutiv ist dabei für das Argumentieren – und Trautmann (vgl. 2004, 123ff., 187ff.) arbeitet das nicht nur für wissenschaftliche Gespräche heraus5, sondern nimmt auch erste Analysen für wissenschaftliche Texte vor -, dass aufrund eines divergierenden Verständnisses beider systematischer Interaktantenpositionen S und H bezüglich einer Sprechhandlung C von Sprecherseite (S) vorliegt. Dies setzt auf Hörerseite (H) einen mentalen Einschätzungsprozess voraus, der auf Basis hörerseitigem Wissen zu dem Schluss führt, dass eine Divergenz vorliegt, was wiederum H eine Äußerung (Prä-E) tun lässt, die diese Einschätzung verbalisiert, um eine Synchronisierug zwischen dem Wissen von S und H ermöglichen soll. Eine Einschätzung der Prä-E-Äußerung auf Sprecherseite löst dann Äußerungen (D) aus, die diesen Versuch der Wissens(um/neu)strukturierung durch H bearbeitet, indem weitere Wissenselemente von S geliefert werden, um C zu stützen oder auch die Einwände, Vorschläge, Zweifel etc. von H zu bearbeiten, zu bewerten, zu übernehmen und dergleichen mehr. Dies kann wieder zur Prä-E-Äußerungen führen und so weiter. Das Argumentieren in Texten ist durch die spezifische Medialität von verdauerter Distanzkommunikation nun durch spezifische Bedingungen geprägt.
“Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass Texte generell aus dem oben genannten Gründen für das Argumentieren eher schlecht geeignet sind: Es gibt – außer im Brief – meist keinen persönlich bekannten Adressaten; der Text ist eine in sich geschlossene Verkettung von Sprechhandlungen miteinander, in die der Leser nicht eingreifen kann – allenfalls kann er mit einem eigenen Text darauf antworten.” (Graefen 22003, 49)
Als “(protracted) dialogues” oder “quasi-dialogues” (Dascal 1989, 147), die als ”activity” dadurch charakterisiert sind, umgehen zu müssen mit “uncertainty regarding the opponent’s reactions”, machen wissenschaftliche Texte es notwendig “[to] anticipate [these reactions] to some extent” (Dascal 1998, Abs. 16). Und ‘some’ ist dabei noch eine zu schwache Formulierung – basiert doch jede Form zerdehnter Kommunikationssituationen (vgl. Ehlich 1984) konstitutiv auf der Antizipation von depräsenter Hörertätigkeit, um überhaupt eine verstehbare Handlungsverkettung möglich zu machen. Davon ist das wissenschaftliche Argumentieren in seiner dargestellten Musterhaftigkeit im selben Maße geprägt, wenn es “aus dem Bereich des persönlichen Streitens herausgenommen und zu öffentlich beachteten Vorgängen” wird (Graefen 22003, 50).
Hier wird nun auch – wie an manch anderen Stellen andeutungsweise (Ehlich/Graefen 2001, 369; kursiv von mir) – die Verbindung deutlich, die Eristik als “Praxis des wissenschaftlichen Argumentierens” ausweist und somit die Möglichkeit aufscheinen lässt, eristische Kommunikationshandlungen einerseits musterbezogen und illokutionsbezogen zu konzeptualisieren. Gerade durch das Fort- und Hineinwirken dialogischer Kommunikationsformen der Wissenschaft in ihre monologischen Kommunikationsformen, wie es oben mit Bezug auf Ehlich (1993) dargestellt wurde, muss die Annahme aber wohl korrigiert werden, es können zwei Arten des Argumentierens in Texten unterschieden werden (die für Trautmann (2004) analyseleitend gewesen sind): nämlich ein Argumentieren erster Stufe und ein Argumentieren zweiter Stufe (vgl. Graefen 22003, 50).
“Unterscheidungskriterium ist dabei die zugrundeliegende Aktantenstruktur, ob nämlich der Schreiber eine eigene Position bezieht, die er gegenüber einem Leser durchsetzen bzw. plausibel machen will, oder ob er die Position Dritter wiedergibt, die ihrerseits argumentieren.” (Trautmann 2004, 188)
In ihrer Analyse begeht Trautmann (vgl. 2004, 197ff.) dann meines Erachtens aber den Fehler, den Schreiber eines wissenschaftlichen Textes in der Sprecherposition halten zu wollen und somit zu unplausiblen Rekonstruktionen von Musterpositionen im analysierten Text kommt. Wird aber – wie in ihrem analysierten Beispiel auf S. 200 – ein Zitat eines anderen Wissenschaftlers argumentativ bearbeitet, begibt sich der Autor des Textes in Bezug auf das Handlungsmuster Argumentieren in die Hörerrolle und bringt Prä-Es bezüglich C (dem Zitat) vor. So stellt sich das Verhältnis von Gesprächsstrukturen und Textstrukturen im Falle des wissenschaftlichen Schreibens als (noch) komplexer heraus, als die Unterscheidung von Graefen (s.o.) es deutlich macht. Die allgemeine, kommunikationsstrukturelle Verteilung von S als Schreibenden und H als depräsenten Lesenden wird – so ist wohl anzunehmen und empirisch zu prüfen – durch die allgemeine Verfahrensweise kooperativer und gleichsam konkurrenzieller dialogischer Wissensproduktion der neuzeitlichen Wissenschaft überlagert von musterbezogen (stellenweise) vertauschten S-H-Positionen, die “sozusagen Residuen und Petrefakte” des dialogischen Streitprozesses im monologischen Text darstellen.
Wenn eristisches Kommunikationshandeln also vom Muster des Argumentierens wesentlich bestimmt ist, stellt sich die Frage, welche Illokutionen (typischerweise) für die Prä-E- und die D-Äußerungen getätigt werden, um ein (neues) Wissen in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Gefragt werden könnte dann, ob diese gruppierbar sind in z.B. offensive und defensive Züge des streitenden Positionierens eines Wissens im Diskurs. Damit könnte die ‘Eristik’ in ihrer Funktionalität und Qualität detaillierter herausgearbeitet werden.
Durch die angesprochene Verschränkung von kommunikationsstruktureller Beteiligungsstruktur (1:n) und musterbezogener Beteiligungsstruktur (S:H) im wissenschaftlichen Text kommt man nun nicht umhin sich differenzierter mit den Medialitäten der Kommunikationsformen (vgl. Holly 2011, Meiler 2013) der Wissenschaft auseinanderzusetzen. Und da scheint mir die einzige von Ehlich (1984) in seinem Textbegriff angelegte Unterscheidungskategorie Ko/Depräsenz als Einfluss nehmend auf den (wissenschaftlichen) Kommunikationsprozess zu kurz zu greifen.
Ebenso wie der Kommunikationsformenbegriff hebt auch Ehlichs (1984) Bestimmung von Text und Diskurs auf die Möglichkeitsbedingungen von Kommunikation ab, wobei sein Erkenntnisinteresse ausschließlich auf sprachliche Kommunikation beschränkt ist. Die Kommunikationsformenkategorie wendet sich dieser Analyseebene umfassender zu (zuerst Ermert 1979, später Holly 1996, aktuell Domke z.B. 2013), indem sie die unterschiedlichen Möglichkeitsbedingungen jeglicher Kommunikation als Kontinua begreift, die für die einzelnen Ausformungen (wie etwa F2f-Gespräch, Veranstaltung (wie Seminar und Vorlesung), Brief, Buch, Zeitschrift, graue Literatur, Weblog, …) in ihrer kommunikationsprägenden Spezifik charakterisierbar sind. Ich habe an anderer Stelle den Versuch unternommen die bisher noch weitgehend statisch und strukturell konzeptualisierte Kategorie pragmatisch/praxeologisch zu rekonzeptualisieren (vgl. Meiler 2013). Dabei habe ich drei Prozedurengruppen (durchaus im funktional-pragmatischen Sinne) unterschieden:
- semiologische Prozeduren unterschiedlicher kommunikative Zeichenarten (bearbeitende, nennende, zeigende, lenkende, malende Prozeduren),
- mediale Prozeduren (linien-, flächen-, und raumbezogene Herstellung von Wahrnehmbarkeit der Kommunikation),
- adressierende Prozeduren (Temporalisierung, Lokalisierung und Identifizierung der Adressanten und Adressaten durch die Origo des Kommunikats).
Dabei sind es nicht unbedingt nur die Medialitätsspezifika im engeren Sinne
- technische Medien mit ihrer speichernden, übertragenden, verstärkenden Funktionsweise
- sowie Kommunikationsrichtung und Beteiligungsstruktur,
- Wahrnehmungsmodalität, Materialität, Zeichen- und Transkriptionspotenzial,
- Raum-, Zeit- und Ortsgebundenheit (vgl. Domke 2010),
die systematischen Einfluss auf das Sprachhandeln in diesen Kommunikationsformen haben, sondern gerade die Aspekte
- des sozialen Status (öffentlich vs. nicht-öffentlich) und
- der Institutionalisierung und Organisation (Infrastrukturen) der Kommunikationsformen in einzelnen Domänen wie der Wissenschaft,
die von prägendem Einfluss auf die Spezifik der darin vollzogenen Kommunikationshandlungen, Handlungsmuster und Gattungen haben.6
Nimmt man nun das oben angesprochenen Verhältnis der Kommunikationsformen Gespräch und Text im Hinblick auf die Verschiebungen in den Blick, die vom (phylo- und ontogenetischen) Wechsel des Sprachhandelns von einer in die andere Kommunikationsform wirksam werden, darf die Frage nach diesem Verhältnis nicht mehr dichotomisch (im Ehlichschen Sinne Diskurs vs. Text) gestellt werden, sondern im Hinblick auf die Vielfalt von Kommunikationsformen entsprechend der verfestigten Ausprägungen der Kontinua von Möglichkeitsbedingungen für Kommunikation.
Wissenschaftliche Weblogs, wie ich sie untersuche, scheinen wesentlich davon bestimmt zu sein, noch keine feste institutionalisierte und organisationale Position im Wissenschaftsbetrieb gefunden zu haben. Andererseits stehen sie aufgrund der Internetmedialität dem Open-Access-Paradigma nahe und erleben dadurch einen gewissen Aufschwung nicht nur in den Natur-, sondern auch den Kulturwissenschaften. Als Kommunikationsform der internen Wissenschaftskommunikation erfreuen sie sich einer gewissen Popularität (nicht nur) unter den Nachwuchswissenschaftlern, die sich auch versprechen mit einer solchen Internetpräsenz größere Aufmerksamkeit im wissenschaftlichen Diskurs zu erlangen. Der Interimszustand, in dem sich (wissenschaftliche) Weblogs und die Gattungen, die in ihnen kommuniziert werden, zweifelsfrei noch befinden, zieht – so ist zu erwarten – eine veränderte Art innerwissenschaftlich zu kommunizieren nach sich.
Welche Maßstäbe gelten für Blogs? Wie präzise muss zitiert werden? Sollten wissenschaftliche Weblogs zitierfähig sein? Welches Wissen kann bei den Lesern vorausgesetzt werden? Wie ‘fertig’ sollten die Texte sein? Wird es als Work-in-progress-Plattform verwendet? Als Arbeits- und Schreibwerkzeug? Für wissenschaftliche Kleinformen? Als Diskussionsplattform?
Diese und andere Fragen, die sich unweigerlich – auch aus meiner eigenen Perspektive – stellen und die Tatsache, das das doch nicht zeitunaufwändige Bloggen quasi neben dem ‘normalen’ Wissenschaftsbetrieb unternommen wird, wirken direkt hinein in das eristische Handeln also in die Art und Weise, wie mit anderen und dem eigenen Standpunkt und dem darauf bezogenen (neuem) Wissen in den Weblogtexten umgegangen wird.
Neben der breiteren und erleichterten Sichtbarkeit und Findbarkeit und den kurzen Zeiträumen, die zur Publikation führen (per Klick), stellt die viel beschworene Kommentarmöglichkeit ebenso einen interessanten Untersuchungsapekt dar, der eristisches Argumentieren in einen ‘neuen’ kommunikativen Aggregatzustand überführt, der als Hybrid zwischen Text und Gespräch nur unzureichend charakterisiert ist.
Allgemeiner sollten folgende Fragen für die empirische Untersuchung vorgehalten werden: Wie wird – entsprechend der dargestellten Musterpositionen des Argumentierens – mit C-, Prä-E- und D-Äußerungen umgegangen? Wie sind sie positioniert? Was für eine propositionale Reichweite haben sie? Welche Illokutionen realisieren diese Musterpositionen? Wie verschiebt oder verändert sich das Muster in verdauerter Dialogizität unbestimmter zeitlicher Zerdehnung (wie sie in der Kommentarfunktion gegeben ist)?
In diesem Licht bekommen Ehlichs (1993, 31; kursiv von mir) Ausführungen noch eine weitere Ebene, die als vinculum alle anderen Ebenen zusammenhält…
“Der Zusammenhang zwischen Wissenschaftstext, wissenschaftlichem Diskurs [= Gespräch?; MM.], Wissenschaftssprache und den Grundlagen des wissenschaftlichen Handelns als einer spezifischen Form gesellschaftlicher Praxis ist intensiver und deutlicher miteinander vermittelt, als üblicherweise angenommen wird.”
… die Ebene der kommunikationsermöglichenden Medialität.
Dascal, Marcelo (1989): Controversies as Quasi-Dialogues. In: Weigand, Edda/Hundsnurscher, Franz (Hg.): Dialoganalyse II, Bd 1. Tübingen: Niemeyer. S. 147-159.
Dascal, Marcelo (1998): Types of Polemics and Types of Polemical Moves. In: Cmejrkova, S./Hoffmannova, J./Mullerova, O. /Svetla, J. (eds.): Dialogue Analysis VI, Bd. 1. Tubingen: Niemeyer, S. 15-33. (zitiert nach der Online-Fassung, gezählt nach Absätzen)
Domke, Christine (2010): Texte im öffentlichen Raum: Formen medienvermittelter Kommunikation auf Bahnhöfen. In: Bucher, Hans-Jürgen/Gloning, Thomas/Lehnen, Katrin (Hg.): Neue Medien – neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation. Frankfurt a.M., New York: Campus. S. 256–281.
Domke, Christine (2013): Ortsgebundenheit als distinktives Merkmal in der Textanalyse. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 41/1, S. 102-126.
Ehlich, Konrad (1984): Zum Textbegriff. In: Rothkegel, Annely/Sandig, Barbara (Hg.): Text – Textsorten – Semantik. Hamburg: Buske. S. 9–25.
Ehlich, Konrad (1993): Deutsch als fremde Wissenschaftssprache. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 19. S. 13–42.
Ehlich, Konrad/Graefen, Gabriele (2001): Sprachliches Handeln als Medium diskursiven Denkens. Überlegungen zur sukkursiven Einübung in die deutsche Wissenschaftskommunikation. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 27, S. 351-378.
Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1986): Muster und Institution. Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen: Narr.
Ermert, Karl (1979): Briefsorten. Untersuchungen zu Theorie und Empirie der Textklassifikation. Tübingen: Niemeyer.
Graefen, Gabriele (22003): Schreiben und Argumentieren. Konnektoren als Spuren des Denkens. In: Perrin, Daniel/Böttcher, Ingrid/Kruse, Otto/Worbel, Arne (Hg.): Schreiben. Von intuitiven zu professionellen Schreibstrategien. 2., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 47-62.
Holly, Werner (1996): Alte und neue Medien. Zur inneren Logik der Mediengeschichte. In: Rüschoff, Bernd/Schmitz, Ulrich (Hg.): Kommunikation und Lernen mit alten und neuen Medien. Beiträge zum Rahmenthema „Schlagwort Kommunikationsgesellschaft“ der 26. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.V. Frankfurt a. M. et al.: Lang. S. 9–16.
Holly, Werner (2011): Medien, Kommunikationsformen, Textsortenfamilien. In: Habscheid, Stephan (Hg.): Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen. Linguistische Typologien der Kommunikation. Berlin, New York: de Gruyter. S. 144–163.
Meiler, Matthias (2013): Kommunikationsformenadressen oder: Prozeduren des Situationsvollzugs am Beispiel von Weblogs. In: Zeitschrift für Angewandt Linguistik 59/2. S. 51-106.
da Silva, Ana (2010): Überlegungen zum Stellenwert und zur Konzeptualisierung eristischer Strukturen in wissenschaftlichen Texten. In: Heller, Dorothee (Hg.): Deutsch, Italienisch und andere Wissenschaftssprachen – Schnittstellen ihrer Analyse. Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang. S. 125–136.
Trautmann, Caroline (2004): Argumentieren. Funktional-pragmatische Analysen praktischer und wissenschaftlicher Diskurse. Frankfurt a.M. et al.: Lang.
- Ich freue mich sehr auch ihre hoffentlich bald erscheinende Dissertation.
- Hier ad hoc gebildete Phrase, die den gesellschaftlichen Zweck komprimiert benennen soll, ein (neues) Wissen in den bestehenden und aktuellen Diskurs (Foucault) einzubringen.
- An einer Stelle ‚übersetzt‘ sie Gradualität als „Körnigkeit“ (da Silva 2010, 132), was Granularität besser getroffen hätte. Für die Beschreibung, dass eristische Strukturen „unterschiedlich deutlich erkennbar“ seien, trifft eine Terminologie, die auf Grade und graduelle Abstufungen abhebt freilich schon.
- Ob Argumentieren aufgrund häufiger Musterdurchläufe und -rekursionen aber systematisch nicht als Muster sondern als Verfahren zu bezeichnen ist, bin ich mir nicht sicher.
- Bezüglich der gesprochenen Sprache untersucht Trautmann (vgl. 2004, 65ff.) auch nicht-wissenschaftliche Kommunikation.
- Auf prozeduraler Ebene ist scheinen vor allem, was Weblogs betrifft, die Digitalität und die Hypertextualität unmittelbare Verschiebungen der semiologischen Prozeduren vorzunehmen, was z.B. Phorik und Textdeixis betrifft (am Beispiel des Links Meiler 2013, 77).