
Der Blogger und Kulturwissenschaftler Michael Seemann hat ein Buch geschrieben, in dem er Erklärungen und Strategien liefert für gesellschafts-politische Veränderungen, die wir im Zuge der Digitalisierung gegenwärtig erleben. Im Kontrollverlust erkennt er dabei das Paradigma dieses Jahrzehnts. Wir reden über seine Theorie des Kontrollverlusts, die Regeln des neuen Spiels, Meinungsfreiheit und darüber, was Plattformen mit dem Kontrollverlust zu tun haben. Außerdem erzählt er, wie es zur Crowdfunding-Kampagne kam, durch 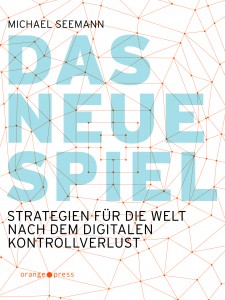 die das Projekt finanziert wurde, und wie er das Schreiben des Buchs organisiert hat.
die das Projekt finanziert wurde, und wie er das Schreiben des Buchs organisiert hat.
Linkliste: Michael Seemann (Blog, Twitter), Das neue Spiel, Leuphana Universität Lüneburg, HyperKult, #feierabend, Crowdfunding auf Startnext, Dirk von Gehlen, VG Wort, Frank Rieger/Rop Gonggrijp: We lost the War, Transaktionskostentheorie (Wikipedia), Postdemokratie (Wikipedia), AK Vorrat, Moore’s Law (Wikipedia), Sousveillance, GitHub, Markdown (Wikipedia)
Update 13.10.2014: Das Buch ist inzwischen erschienen und kann hier bezogen werden.
[...]

 Wer das Wort “Wirklichkeit” in einer kulturwissenschaftlichen Debatte verwendet, ist stets darum bemüht, Anführungszeichen zumindest anzudeuten, um sich nicht verdächtig zu machen, mit einem naiven Realitätsbegriff zu hantieren. Helmut Lethen, Direktor des IFK, ist diese Diskussion inzwischen leid, weshalb er sein Buch “Der Schatten des Fotografen” der Frage widmet, in welchem Verhältnis Bilder und Fotografien zur Wirklichkeit stehen. Im Gespräch folgen wir n
Wer das Wort “Wirklichkeit” in einer kulturwissenschaftlichen Debatte verwendet, ist stets darum bemüht, Anführungszeichen zumindest anzudeuten, um sich nicht verdächtig zu machen, mit einem naiven Realitätsbegriff zu hantieren. Helmut Lethen, Direktor des IFK, ist diese Diskussion inzwischen leid, weshalb er sein Buch “Der Schatten des Fotografen” der Frage widmet, in welchem Verhältnis Bilder und Fotografien zur Wirklichkeit stehen. Im Gespräch folgen wir n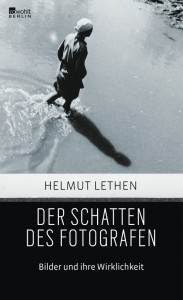 icht nur einigen Beispielen und theoretischen Bezügen, die im Buch besprochen werden – wie zum Beispiel die scheinbar idyllische Szene auf dem Coverfoto –, sondern reden auch über die Entstehung und den Schreibprozess. Für das Buch erhielt Helmut Lethen 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. Unterstützt werde ich in dieser Episode von dem Philosophen Jakob Moser.
icht nur einigen Beispielen und theoretischen Bezügen, die im Buch besprochen werden – wie zum Beispiel die scheinbar idyllische Szene auf dem Coverfoto –, sondern reden auch über die Entstehung und den Schreibprozess. Für das Buch erhielt Helmut Lethen 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. Unterstützt werde ich in dieser Episode von dem Philosophen Jakob Moser. Ende des 19. Jahrhunderts erschien einigen Ingenieuren Pneumatik als Beförderungs- und Kommunikationstechnik der Zukunft. Mit Hilfe von Luftdruck statt Elektrizität sollten etwa Menschen in atmosphärischen Eisenbahnen transportiert oder Briefe in Büchsen durch die Stadt geschossen werden. Der Kulturwissenschaftler Florian Bettel hat sich mit den Anfängen der (Wiener) Rohrpost auseinandergesetzt. Er erklärt unter anderem, warum der Plan eines pneumatischen Leichentransports zum Wiener Zentralfriedhof scheiterte und wie sich die Stadtrohrpost in einigen Großstädten wie Wien, Paris oder Berlin etablierte. Während es Rohrpostanlagen in vielen Gebäuden heute noch gibt, gilt die Rohrpost als Sinnbild für überbordende Bürokratie – oder für das
Ende des 19. Jahrhunderts erschien einigen Ingenieuren Pneumatik als Beförderungs- und Kommunikationstechnik der Zukunft. Mit Hilfe von Luftdruck statt Elektrizität sollten etwa Menschen in atmosphärischen Eisenbahnen transportiert oder Briefe in Büchsen durch die Stadt geschossen werden. Der Kulturwissenschaftler Florian Bettel hat sich mit den Anfängen der (Wiener) Rohrpost auseinandergesetzt. Er erklärt unter anderem, warum der Plan eines pneumatischen Leichentransports zum Wiener Zentralfriedhof scheiterte und wie sich die Stadtrohrpost in einigen Großstädten wie Wien, Paris oder Berlin etablierte. Während es Rohrpostanlagen in vielen Gebäuden heute noch gibt, gilt die Rohrpost als Sinnbild für überbordende Bürokratie – oder für das 

 Computerbasierte Simulationsmodelle haben einige Wissenschaften, wie die Atomphysik oder die Biologie, in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert. Denn Forschung basiert nun nicht mehr nur auf den erprobten Verfahren von Theorie und Experiment, sondern versucht, Zukunft quantifizierbar zu machen – etwa zur Berechnung eines
Computerbasierte Simulationsmodelle haben einige Wissenschaften, wie die Atomphysik oder die Biologie, in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert. Denn Forschung basiert nun nicht mehr nur auf den erprobten Verfahren von Theorie und Experiment, sondern versucht, Zukunft quantifizierbar zu machen – etwa zur Berechnung eines 