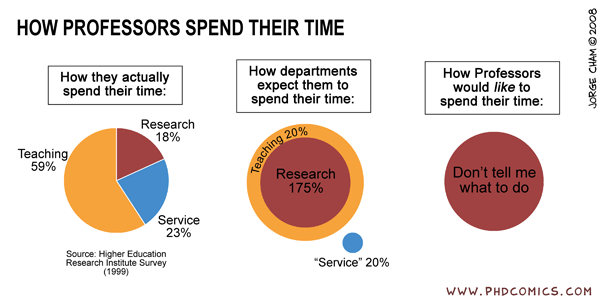0. Einleitung
Da steht sie unerwartet und plötzlich in uns: die Frage, ob ein ansprechend formulierter journalistischer Beitrag über eine Karaoke-Party in ein Universitätsblog gehört. „Tja nun“, sagen wir hinhaltend, drücken Kerben in den sich unruhig in unseren Händen windenden Bleistift und schnappen nach einer Atempause verstohlen nach Luft. „Ja nun, das war doch eine Party von Studenten“, entfährt es uns ganz altakademisch latinophil und genderindifferent! Wir erinnern uns an das Hochschulgesetz, das vorsieht, dass eine Universität von jungen Leuten bevölkert ist, die dort studieren. „Ja, studieren! Nicht Party feiern!“, raunt uns unser innerer Advocatus Diaboli zu. „Schluss jetzt!“, raunen wir zurück! Ist ein Universitätsblog allein auf Output aus der universitären Forschung und auf Beiträge aus der Lehre beschränkt? Gehört zur Universität nicht mehr und zu einem lebendigen Abbild erst recht? Wir wollen daher unseren Standpunkt zu dem, was wir uns unter einem Universitätsblog zu verstehen erlauben, ein wenig erläutern. Dabei handelt es sich einzig und allein um die persönliche subjektive Ansicht des Verfassers, der – biographiebedingt – einige Betrachtungen aus einer archivarischen Perspektive einflechten wird.
Gliederung:
- Erwartungshaltung gegenüber institutionellen Blogs
- Mandatsgemäßer Output oder Gleichberechtigung der Funktionen?
- Funktionen einer Universität
- Zusammenfassung: der Blog - ein repräsentatives Kaleidoskop
1. Erwartungen an institutionelle Blogs
Längst sind Blogs nicht mehr die Domäne von Einzelpersonen für ihre eigenen Beiträge, wenngleich solche Ein-Autoren-Blogs in der Gesamtzahl der Blogs, die das Internet bietet, weitaus die größte Zahl ausmachen dürften und auch künftig ausmachen werden.[1] Institutionelle Blogs sind neben den themenbezogenen Mehrautorenblogs zu einer dritten Komponente in der Welt der „seriösen Blogosphäre“ geworden. Wer sich beispielsweise die Liste der Blogs ansieht, die vom im Blog-Aggregator „Planet History“ abgegriffen werden, also von einem Aggregator für Blogs, die sich mit Geschichte befassen, bemerkt, dass diese Blogs eher themenbezogen als institutionsbezogen betitelt sind. Dort, wo sie nach Institutionen benannt sind, sind es Einrichtungen der Geschichtsvermittlung (z.B. Archive), die ihre Schätze und Ergebnisse präsentieren.
Spezielle Blogs von Universitäten findet man in großer Zahl. Sie sind nicht die klassischen institutionellen Blogs, etwa wie die von Archiven oder Museen. Sie sind inhaltlich nicht wie jene auf ein institutionelles Mandat ausgerichtet, das von eng abgrenzbaren Inhalten erfüllt ist. Das universitäre Mandat ist zwar durch die Hochschulgesetze klar definiert. Die sich daraus ergebenden Inhalte sind aber so weit gefächert, dass die Schere zwischen der Beziehung eines Blogs zur Institution und zu den aus ihr heraus entstehenden Sachthemen scheinbar zur schier unübersehbaren Kluft wird. Diese vermeintliche Kluft kann leicht zu Unklarheiten darüber führen, worüber denn in einem Universitätsblog geschrieben werden soll, darf, kann. Diese Frage wurde in der Praxis ebenso vielmals wie vielfach beantwortet. Die Technische Universität München (TUM) betreibt ein Blog namens „Forschung und Lehre an der Technischen Universität München“. Konzept und Umsetzung oblagen unter anderem dem Hochschulreferat Studium und Lehre, dem Medienzentrum und dem Konvent der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Dieses Blog soll als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform zu Themen rund um Studium und Lehre dienen und damit eine erkannte Lücke füllen. Veröffentlichen dürfen Lehrende und Studierende. Thematisch „sind keine engen Grenzen gesetzt: alle Fragen rund um Studium und Lehre können hier diskutiert werden – von der Vorstellung innovativer Lehrkonzepte und Praxisprojekte über Vorschläge zur Verbesserung der Studien- und Lehrqualität bis hin zu aktuellen hochschulpolitischen Themen.“[2] „Bye Bye Uni-Blog“ lautet die Überschrift des letzten Beitrags des Blogs der Universität Potsdam, das zu stark eventbezogen ausgerichtet war, um gegenüber einem erfolgten Relaunch der um neue redaktionelle Möglichkeiten erweiterten Universitätswebsite einen akzeptablen Mehrwert zu behalten.[3] Der „Campus Passau Blog“ dient zwar keineswegs nur, aber ausdrücklich als Sprachrohr für Studierende zur Universität: „Die Universität möchte vor allem den Studierenden mit dem Blog ein Forum geben, direkt mit der Uni in Kontakt zu treten und den offenen, konstruktiven Dialog miteinander aufzunehmen.“[4]
Eine eigene Gattung sind universitäre Blogportale, die die unterschiedlichen Blogs, die in einer Universität betrieben werden, sortieren und überschaubar zugänglich machen. Dies können echte Portale sein oder als Portale getarnte Blogs, die mit einem ausgeprägten Rubrikensystem arbeiten. Ein interessantes Beispiel ist das CEDIS-Portal für die Blogs an der Freien Universität Berlin. Hier wird jedem Mitarbeiter und Studierenden der FU die Möglichkeit zum Betrieb eines eigenen Blogs gegeben. Die Nutzerkompetenz und die daraus resultierenden Blogergebnisse erscheinen aber – trotz des guten Supportangebots von CEDIS – mehr als dürftig. Als gelungen darf wohl das Portal der Blogs von Mitarbeitern der University Oxford (http://www.ox.ac.uk/blogs.html) gelten, das auf Blogs von Einzelpersonen und auf kollaborative Blogs wie z.B. das der Voltaire Foundation führt. Beachtenswert ist die Gliederung des Oxforder Portals. Sie richtet sich nach den tatsächlich verlinkten Blogs und gibt kein starres Korsett vor. Das heißt, dass die einzelnen Blogbetreiber selbst bestimmen, was Inhalt eines universitären Blogs ist und somit sein darf. Über möglicherweise existierende Aufnahmevoraussetzungen für das Portal ist keine Information auf der Portalseite hinterlegt.
All diesen Beispielen ist gemein, dass der Bezug zu den Kernaufgaben Forschung und Lehre und die Beziehungen der Studierenden zur Institution Universität die roten Fäden sind, die den Beiträgern zur inhaltlichen Orientierung mehr oder weniger verbindlich vorgegeben werden. Weiterhin fällt auf, dass Veranstaltungen und insbesondere Veranstaltungsankündigungen große Akzeptanz eingeräumt wird; letzteren, obwohl sie eigentlich eher nicht in die Idee des Weblogs als nach Antwort suchendem „Logbuch“ für Reflexion und Betrachtung, als facettenreichem und keineswegs chronologisch gemeintem „Tagebuch“ passen.
Es drängt sich der Eindruck auf, als gebe es eine nebulöse Grauzone universitären Lebens, um deren Existenz man zwar weiß, bei der aber große Unsicherheit besteht, inwieweit sie in einen „seriösen“ Universitätsblog gehöre. Plakativ sei dafür nochmals die anfangs zitierte Karaoke-Party genannt.