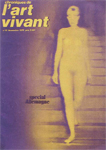Seit dem 27. September 2013 ist im Berliner Museum für Fotografie die Ausstellung Brasiliens Moderne 1940–1964 mit Arbeiten der Fotografen José Medeiros, Thomaz Farkas, Marcel Gautherot und Hans Gunter Flieg zu sehen.
Nun ist, etwas verspätet, auch der von Ludger Derenthal und Samuel Titan Jr. herausgegebene Katalog zur Ausstellung im Bielefelder Kerber-Verlag erschienen. Der Band dokumentiert einen Teil der in der Ausstellung gezeigten Fotografien, ergänzt durch einen einleitenden Beitrag, vier werkbiografische Texte über die vorgestellten Fotografen und einen Katalogteil.
Die vier in der Ausstellung vorgestellten Fotografen zeichnen sich auf den ersten Blick eher durch Unterschiede als durch Gemeinsamkeiten aus: Der gebürtige Brasilianer José Medeiros arbeitete überwiegend journalistisch, häufig für das führende brasilianische Magazin O Cruzeiro. Thomaz Farkas, Sohn ungarisch-jüdischer Einwanderer, die 1930 in Sao Paulo ein Fotogeschäft eröffneten, entwickelte sich zum Meister der Form und war ein starker Impulsgeber der fotografisch-ästhetischen Moderne in Brasilien. Marcel Gautherot fand seinen Zugang zur Fotografie in seinem Geburtsland Frankreich über die Architektur und die Ethnologie, bevor das Fernweh ihn nach Brasilien verschlug. Hans Gunter Flieg war ein deutscher Jude, der 1939 als 16-Jähriger – gleich nach einer Grundausbildung in Labortechnik bei Grete Karplus – seine Heimatstadt Berlin verließ und in Sao Paulo ein kommerzielles Fotostudio eröffnete.
All diesen Unterschieden zum Trotz verfolgten alle vier das Ziel, die Fotografie als genuin modernes Medium konzeptionell und ästhetisch weiterzuentwickeln. Sie distanzierten sich vom Piktorialismus des frühen 20. Jahrhunderts und entwickelten eine klare Formsprache, mit der sie die brasilianische Moderne zwischen 1940 und dem Beginn der Militärdiktatur 1964 auf eindrückliche Weise beschrieben. Einige Themen kehrten dabei immer wieder – vor allem Phänomene des Alltags wie Arbeit, Freizeit und Sport, aber auch der Aufbau der neuen Hauptstadt Brasília in den Jahren bis 1960. Manche Arbeiten wirken zeit- und ortlos, zeigen sie doch Elemente des Lebens, die die brasilianische Gesellschaft weder von anderen Gesellschaften noch von früheren oder späteren Dekaden unterscheidet. Dazu gehören zum Beispiel eine aus einem Hochhaus aufgenommene Fotografie des Strands von Copacabana (Medeiros, Abb. 07), ein Panorama des Fußballstadions von Brasília (Gautherot, Abb. 34) und Aufnahmen von Arbeitern in verschiedenen Industriebetrieben (Flieg, Abb. 96 und 101). Viele andere Bilder aber zeigen unverkennbar Brasilien und ebenso unverkennbar eine Zeit, in der Aushandlungsprozesse zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen der Bewahrung der Kultur der Ureinwohner und der Modernisierung durch Industrialisierung und technischen Fortschritt in vollem Gang waren. Die einzigartige Aufnahme einer Gruppe von Yalawapiti-Indianern, die ein Propellerflugzeug an der Tragfläche anschiebt, zeigt das Zusammentreffen der Regenwaldbewohner und einer von Mobilität und Technik faszinierten Moderne, die den Betrachter zwar über den historischen Moment informiert, ihn aber auch irritiert zurücklässt (Medeiros, Tafel 1). Welche Art von Begegnung mag diesem auf das Jahr 1949 datierten Moment vorangegangen sein?
Ähnlich verhält es sich mit einem Bild, das Thomaz Farkas am 21. April 1960, dem Tag der Einweihung der Hauptstadt Brasília, vor einem eben fertiggestellten Regierungsgebäude aufnahm. Im Vordergrund steht ein Lastwagen, rechts daneben unterhält sich eine Gruppe von schick im Stil der 1950er-Jahre gekleideten Frauen, die mit ihren sauberen Schuhen mitten im Dreck stehen; links daneben sind einige herumlaufende Männer zu sehen, die dem Gebäude keinerlei Beachtung schenken. An dem Lastwagen ist eine Art Vorzelt angebracht, unter dem sich leere Kisten stapeln. Das Bild fängt einen Moment ein, in dem die Schwierigkeiten des Aufbaus einer Kunststadt unübersehbar werden: Es gibt hier keine gewachsene, lokal verwurzelte Gesellschaft; hier gibt es ‚nur’ Individuen, die zwischen Autos herumlaufen. Die Stadt scheint so unfertig, dass der Betrachter sich kaum vorstellen kann, wie ein Land von der Größe Brasiliens von hier aus regiert werden soll. Konterkariert werden Aufnahmen dieser Art indes durch eine Fotografie, die Oscar Niemeyer mit drei Freunden in entspannter Atmosphäre in einer Bar oder einem Hinterzimmer zeigt und die den geistigen Vater der neuen Hauptstadt so greifbar macht, dass mittelbar auch die neue Hauptstadt ein vertrautes Gesicht bekommt.
Kritisch anzumerken ist, dass der Band nicht annähernd so viele Fotografien zeigt, wie in der Ausstellung zu sehen sind – was das Buch allerdings auch handhabbar und erschwinglich macht. Etwas umständlich wird das Betrachten der Bilder dadurch, dass die Bildunterschriften nicht neben den Tafeln, sondern nur im angehängten Katalogteil zu finden sind; dort sind immerhin auch Miniaturen der Bilder zu finden, die nur in der Ausstellung zu sehen waren – hier in der Reihenfolge der dortigen Hängung. Der Textteil eignet sich gut als Einführung in die jeweiligen Gesamtwerke der vier Fotografen, lässt aber Fragen zu den Arbeitsbedingungen, wirtschaftlichen Verhältnissen und auch zu den politischen Haltungen der Fotografen weitgehend außer Acht.
In ihrer Gesamtheit zeichnen die in diesem Band versammelten Fotografien ein sehr eindrückliches Bild der brasilianischen Gesellschaft der 1940er- und 1950er-Jahre, und sie zeichnen dies auf ästhetisch höchstem Niveau. Der Band (wie auch die nun bis zum 27. April 2014 verlängerte Ausstellung im Museum für Fotografie in Berlin) ist ein Genuss für das Auge und macht neugierig auf die Geschichte eines Landes, das sich von Europa aus betrachtet auch dann noch an der Peripherie befindet, wenn es gerade die Ausrichtung einer Fußballweltmeisterschaft vorbereitet. Allen, die mit dem Gedanken spielen, zu diesem Anlass dorthin zu reisen – und sei es nur mental –, sei dieser Band wärmstens empfohlen.
Katalog
Ludger Derenthal und Samuel Titan Jr. (Hrsg.), Brasiliens Moderne 1940–1964. Fotografien aus dem Instituto Moreira Salles, Bielefeld/Berlin: Kerber-Verlag 2013, 176 Seiten, zahlreiche s/w-Abbildung im Textteil und 111 schwarz-weiße Bildtafeln im Katalog, 40,00 Euro.
Ausstellung
Brasiliens Moderne 1940–1964. Fotografien von José Medeiros, Thomaz Farkas, Marcel Gautherot und Hans Gunter Flieg aus dem Instituto Moreira Salles, Museum für Fotografie, Jebensstr. 2, 10623 Berlin, 27. September 2013 bis 27. April 2014 (nach Verlängerung), Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro