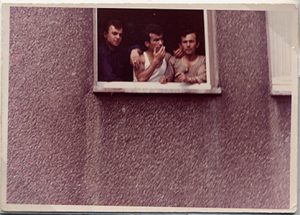In meinem Aufsatz (2000) zur Erinnerungskultur der Strafjustiz schrieb ich über die rätselhaften Neidköpfe: „Die rätselhaften Bildwerke, deren Funktion bis heute umstritten ist, dienten ebenso als „Erzähl-Male“ wie beispielsweise die Darstellung des Martyriums des heiligen Cyrillus – seine Peiniger wanden ihm mit einer Walze die Gedärme aus dem Leib – in der Lübecker Marienkirche. Das Schnitzwerk wurde in protestantischer Zeit als Erinnerung an die Bestrafung des adeligen Mörders Klaus Bruskow 1367 mißverstanden, dessen Schwert man als Tatwerkzeug lange Zeit auf dem Zeughaus aufbewahrt habe. Während die Geschichten die Gegenstände erklärten, beglaubigten umgekehrt die Gegenstände als „Wahrzeichen“ die Geschichten von abscheulichen Taten und ihrer exemplarischen Ahndung.“1 Diese Passage ist in zweierlei Hinsicht zu korrigieren: Zum einen ist das „adeligen“ zu streichen und zum anderen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich um den hl. Cyrillus gehandelt hat. Vermutlich zeigte die verschwundene Darstellung den Märtyrer Erasmus.
Laut der annähernd zeitgenössischen Lübecker Detmar-Chronik erstach Klaus Bruskow am 3. Juni 1367 in der Lübecker Marienkirche den Ratsherrn Bernhard Oldenborch2 und verwundete zwei weitere Ratsmitglieder.3 Im 15.
[...]
Quelle: http://archivalia.hypotheses.org/63977