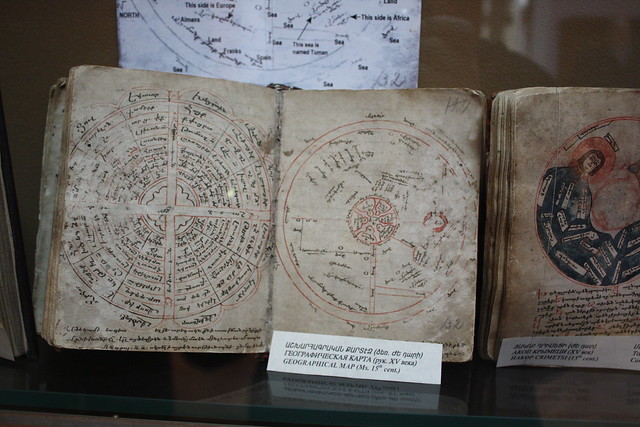Auf dem Hypotheses-Bloggendentreffen am Rande des Göttinger Historikertags wurde auch die Frage angesprochen, was man tun kann, wenn eine Druckförderung nicht möglich ist, sondern die Förderorganisation erwartet, dass der Tagungsband Open Access erscheint. Ich knüpfe im Folgenden an meinen Beitrag “Rechtsfragen von Open Access (2012)” an.((1)) Ausgeklammert wird die Frage, ob Tagungsbände überhaupt sinnvoll sind.((2))
Wenn ich mich recht entsinne, wurde die Option, die Beiträge als PDFs((3)) in einem Hypotheses-Blog an Zusammenfassungen anzuhängen, gar nicht erst erwogen. Zu wenig prestigeträchtig! Aber die Beiträge würden verbreiteten Maßstäben von Zitierfähigkeit genügen, sie wären in Suchmaschinen (einschließlich Google Scholar) gut sichtbar.((4))
Mein Vorschlag, bei universitärer Anbindung den jeweiligen Hochschulschriftenserver zu nutzen, stieß auf keine Gegenliebe. Dabei haben die einzelnen Beiträge dauerhafte Adressen (meistens vom Typ URN), dürften dauerhaft zugänglich sein und sind über Bielefelds BASE und vergleichbare Services findbar (siehe auch hier). Rufen wir uns kurz die Berliner Erklärung für Open Access aus dem Jahr 2003 in Erinnerung: ”
A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving.
Harnadianer schwören darauf, dass beim grünen Weg von Open Access die mandatgestützte Einstellung in den lokalen IRs (institutionellen Respositorien) erfolgt und zentrale disziplinäre Repositorien lediglich die Aufgabe haben, die lokalen Inhalte zu harvesten (also die Metadaten einzusammeln).
Es wurde der Wunsch geäußert, ein zentrales Portal für die deutschsprachige Geschichtswissenschaft zu haben, das mit hohem Ansehen und hoher Akzeptanz behaftet ist, in dem man einen solchen Tagungsband unterbringen könne. Ich kann dazu nur sagen: Dieser Ball liegt – wenn man von den Kompetenzen der verteilten nationalen Forschungsbibliothek ausgeht – seit Jahren im Feld der Bayerischen Staatsbibliothek – ungespielt. Historicum.net wird (ebenso wie CLIO online) als virtuelle Fachbibliothek ausgegeben, doch wird man angesichts der Tatsache, dass keine neuen Themenportale vorgesehen sind, meine Diagnose, Historicum sei gescheitert, nicht ganz von der Hand weisen können. Während die Kunstgeschichte mit ART-Dok (UB Heidelberg) ein ausgezeichnet funktionierendes, auch durch Retrodigitalisate erfreulich angereichertes Repositorium verfügt, ist ein geschichtswissenschaftliches Repositorium nicht vorhanden und auch nicht in Sicht. Wer es vermisst, ist aufgerufen, sich an die Bayerische Staatsbibliothek zu wenden.
In den Sozialwissenschaft recht renommiert ist das bei HistorikerInnen wenig bekannte Social Science Open Access Repository. Eine Suche nach dem Wort Mittelalter zeigt, dass hier nicht nur hardcore-sozialhistorische Arbeiten zu finden sind. Kulturgeschichte ist ja bekanntlich immer auch Sozialgeschichte und umgekehrt …
Mein Hinweis auf Qucosa wurde eher mit Skepsis aufgenommen. Das in Sachsen beheimatete Portal ist zwar nachweislich für alle deutschsprachigen Wissenschaftler, also auch für die nicht an ein universitäres Repositorium angebundenen, offen, verfehlt aber durch seinen regionalen Zuschnitt das dringende Bedürfnis nach einem möglichst qualitätvollen und reputationsträchtigen Portal (aber Qualität wird ja bekanntlich überschätzt …).
Wenig Prestige verheißt auch die für englischsprachige Studien vorgesehene Notlösung OpenDepot der Universität Edinburgh, falls ein geeignetes Open-Access-Repositorium nicht existiert. 2013 gab es nur 54 Eprints, die dort abgelegt wurden. Mareike König weist mich zusätzlich auf HAL-SHS hin, das aber nur für frankophone Beiträger relevant sein dürfte.
Deutlicher attraktiver als solche Schriftenserver (schon das Wort Hochschulschriftenserver signalisiert ja schlechte Laune), ja geradezu “sexy” ist anscheinend Academia.edu (Einführung von Maria Rottler), das, wenn ich E-Prints aus meinem fachlichen Umfeld recht deute, an Beliebtheit andere Angebote wie ResearchGate oder Mendeley in den Geisteswissenschaften weit übertrifft. Das Hochladen ist wesentlich einfacher und bequemer als bei den Repositorien, die Funktion als soziales wissenschaftliches Netzwerk (mit Timeline) wird gern genutzt. Aber es gibt keine Permalinks und auch keine garantierte dauerhafte Verfügbarkeit – solche kommerziellen Angebote können ja auch wieder verschwinden, wenn sie sich als erfolglos erweisen.
Keine Begeisterung löste mein Gedanke aus, es sei doch egal, wo überall der Sammelband als Datei abgelegt sei. Man könne doch auf dem eigenen Webspace eine schicke Präsentation basteln und für die Dateien/PDFs auf andere Server verweisen. Klar, schick heißt nicht unbedingt: Reputation.
Großer Konsens bestand dagegen in Sachen hybrides Publizieren: Open Access und Druckausgabe. Gedruckte Bücher sind in Bibliothekskatalogen findbar und werden rezensiert. Immerhin habe ich ja im Lauf der Jahre über 100 Links gesammelt, die fast alle besagen, dass entgegen landläufigem Vorurteil eine Open-Access-Buchpublikation den Verkaufszahlen der gedruckten Version nicht schadet. Aber welche Verlage akzeptieren Open Access? Eine bequeme Liste gibt es nicht. Man muss einzeln verhandeln, und in vielen Fällen wird wohl ein satter Druckkostenzuschuss erwartet (der ja im Ausgangsfall eben nicht in Aussicht gestellt werden kann).
Gern einigte man sich also auf das Prinzip #Ziegenleder. Bewährt und bekannt: das gute Buch.
- Dort gehe ich auch auf die Frage ein, wie man als Rechteinhaber sein eigenes Buch Open Access zur Verfügung stellen kann z.B. wenn es schon in HathiTrust gescannt ist.
- Tod den Tagungsbänden! Das forderte der Jurist Thomas Hoeren. “Sammelbände, das wissen wir, liest wirklich niemand”, sagt Valentin Groebner. Anne Baillot und Mareike König schreiben in ihrem in Kürze auf http://ifha.revues.org/7959 einsehbaren Beitrag “Wissenschaftliches Publizieren in Frankreich: erste Schritte für Nachwuchshistorikerinnen und -historiker”: “Die Herausgabe eines Sammelbandes muss einen massiven, evidenten Vorteil mit sich bringen, denn es ist eine Veröffentlichungsform, die weder große institutionelle Anerkennung einbringt (im Vergleich zu im Peer Review begutachteten Aufsätzen) noch eine größere Verbreitung der Arbeitsergebnisse gewährleistet – und dies bei beträchtlichem Zeitaufwand”.
- Obwohl Schriftenserver (anders als Open-Access-Zeitschriften) fast nur auf PDFs setzen, sind die Nachteile dieses Formats nicht zu übersehen, angefangen von eingeschränkter Sichtbarkeit im Web bis hin zur unbequemen Nutzung von Hyperlinks.
- Noch ungelöst ist die Frage der Langzeitarchivierung von Blogs. Hypotheses archiviert nach Auskunft von Mareike König, der ich ebenso wie Maria Rottler für die Durchsicht dieses Beitrags danke, die Beiträge (aber nicht die angehängten PDFs), sieht aber keine Langzeitarchivierung vor. Die Deutsche Nationalbibliothek archiviert zwar Blogs, macht diese aber nicht öffentlich im Netz zugänglich.