 Auf der Versammlung der französischen Blog-Community in Paris am 8. April 2014 wurde es bereits angekündigt, jetzt stehen die neuen WordPress-Themen als Webdesign-Vorlage für alle Blogs von hypotheses zur Verfügung: Twenty Eleven, Twenty Twelve, Twenty Thirteen und Twenty Fourteen. Im Laufe der nun beginnenden Umstellung werden die bisherigen Themen abgeschafft. Für alle Blogs von hypotheses ist daher ein Umstieg auf eines der neuen Themen notwendig.
Auf der Versammlung der französischen Blog-Community in Paris am 8. April 2014 wurde es bereits angekündigt, jetzt stehen die neuen WordPress-Themen als Webdesign-Vorlage für alle Blogs von hypotheses zur Verfügung: Twenty Eleven, Twenty Twelve, Twenty Thirteen und Twenty Fourteen. Im Laufe der nun beginnenden Umstellung werden die bisherigen Themen abgeschafft. Für alle Blogs von hypotheses ist daher ein Umstieg auf eines der neuen Themen notwendig.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die Gründe für den Umstieg auf die neuen Themen. Außerdem bekommen Sie eine knappe Anleitung, wie Sie Ihre Blogs auf diese Themen umstellen können. Eine ausführlichere Dokumentation wird demnächst im Bloghaus veröffentlicht.
Weshalb werden neue Themen entwickelt?
Einige der Themen bei hypotheses sind zu komplex und weisen Programmierfehler auf. Andere enthalten Codes, die schwierig zu pflegen sind. Generell sind die Codes sehr heterogen, da sie von unterschiedlichen Organisationen programmiert wurden. Diese Heterogenität erschwert es uns zunehmend, die Wartung der Plattform vorzunehmen.
Hinzu kommt, dass bestimmte Themen bereits veraltet sind und nicht mehr den Standards entsprechen. So lässt sich die Mehrheit der von uns angebotenen Themen nicht an die verschiedenen Bildschirmauflösungen insbesondere von Smartphones und mobilen Geräten anpassen (Stichwort Responsive Webdesign). Auch das Plugin dafür (wp-touch) ist veraltet und ermöglicht keine adäquate und universelle Nutzung.
Die bisher verfügbaren Themen weisen Kompatibilitätsprobleme mit den von vielen Bloggenden geforderten Plugins auf (z.B. Twitter etc.). Somit sind auch die Tests von neuen Plugins für die Plattform schwierig und Entwicklungen langsam bis unmöglich geworden.
Die Erweiterung der Themen ermöglicht uns, schneller auf aktuelle Anforderungen zu reagieren und die Kompatibilität der Plattform nach dem technischen State of the Art zu gewährleisten.
Welche neuen Themen gibt es?
Wir stellen den Bloggenden vier neue, homogenere Themen zur Verfügung, die von einer Gruppe von Softwareentwicklern von WordPress (Basissoftware von hypotheses) erarbeitet wurden. Diese sind in Responsive Webdesign geschrieben, das heißt, dass sich die Auflösung an die Größe und den Typ der Bildschirme bei mobilen Endgeräten anpasst. Die sieben veralteten Themen werden nach und nach abgeschafft.
Die vier neuen Themen sind:
•Twenty Eleven. Beispiel: http://difdepo.hypotheses.org/
•Twenty Twelve. Beispiel: http://hctc.hypotheses.org/
•Twenty Thirteen. Beispiel: http://pock.hypotheses.org/
•Twenty Fourteen. Beispiel (neben Bloghaus): http://surunsonrap.hypotheses.org/
Zurzeit entwickelt WordPress jedes Jahr ein neues Thema. Wir nehmen uns das als Vorbild und versuchen ebenfalls, jedes Jahr ein neues Thema für die Plattform zu testen, anzupassen und für die Community bereitzustellen.
Wie kann man zwischen den einzelnen Themen wechseln?
Um zwischen den Themen zu wechseln, wählen Sie eines der neuen Themen aus und konfigurieren es. Klicken Sie hierzu in der Menüoberfläche auf „Design“ > „Thema“. Dann können Sie zwischen den Themen Twenty Eleven, Twenty Twelve, Twenty Thirteen und Twenty Fourteen auswählen und das gewünschte Thema mit einem Klick auf „Aktivieren” freischalten. Bevor Sie das neue Thema auswählen, können Sie sich eine Vorschau des Ergebnisses anzeigen lassen. Abschließend können Sie Ihr neues Thema personalisieren indem Sie auf „Customize“ im Reiter „Design“ klicken.
Wenn Sie sich ein Thema wünschen, das eine einfache Ansicht hat und wenig Konfiguration benötigt, eignen sich Twenty Eleven oder Twenty Twelve. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Twenty Fourteen um ein stärker konfigurierbares Thema, das allerdings auch mehr Hintergrundwissen abverlangt.
Wann finden die angekündigten Veränderungen statt ?
Die Themen Cleaker Cléo, Evolve Hypothèses.org, Magazine Basic Cléo, Magazine P Basic Hypothèses, Twenty Eleven Hypothèses.org, Twenty Ten und Photopress werden im Zuge der neuen Entwicklungen aufgelöst.
Es gilt der folgende Zeitplan:
- Seit April 2014 sind die neuen Themen Twenty Eleven, Twenty Twelve, Twenty Thirteen und Twenty Fourteen verfügbar.
- Ab dem ersten Juli 2014 werden die alten Themen nicht mehr angeboten. Der technische Support für diese Themen wird dann eingestellt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, möglichst bald eines der neuen Themen auszuwählen.
- Ab dem 30. September 2014 werden die alten Themen abgeschafft. Blogs, die bis dahin noch mit den alten Themen verwaltet werden, bekommen automatisch ein neues Thema zugeteilt. Danach ist ein Wechsel zu einem anderen Thema jedoch selbstverständlich weiterhin möglich.
- Während der Übergangszeit zu den neuen Themen dient Ihnen die Mailingsliste als Plattform, auf der Sie sich austauschen können. Hier können Sie bei auftretenden Schwierigkeiten andere Bloggenden, sowie das Team von de.hypotheses um Rat fragen, und über Ihre Erfahrungen mit den neuen Themen berichten.
Die Dokumentation der Vorgänge wird zurzeit erarbeitet und nach Fertigstellung im Bloghaus veröffentlicht.
_______
Übersetzung und Anpassung des Beitrags im Maison des Carnets von Tammy Steffen Koenig und Mareike König.
Abbildung: Spices von Jungle_Boy, CC-BY-NC-SA.
Quelle: http://bloghaus.hypotheses.org/1064
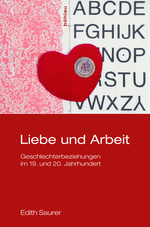 Edith Saurer: Liebe und Arbeit. Geschlechterbeziehungen im 19. und 20. Jhd., hrsg. von Margareth Lanzinger. Wien: Böhlau, 2014.
Edith Saurer: Liebe und Arbeit. Geschlechterbeziehungen im 19. und 20. Jhd., hrsg. von Margareth Lanzinger. Wien: Böhlau, 2014.






