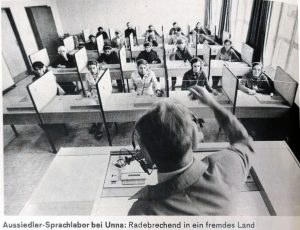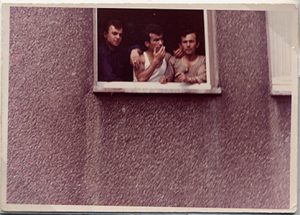Beginn des Abspanns: Grenzübergang DDR/Bundesrepublik bei Nacht
Filmstill aus der „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“, BRD 1970, Regie: Peter Schulze-Rohr © NDR
Als er 2009 über „Erinnerungsorte der DDR“ reflektierte, bemerkte der Zeithistoriker Martin Sabrow, dass „die wissenschaftliche Literatur“ wie auch „der Geschichtsunterricht […] der medialen DDR-Inszenierung in Film und Fernsehen an Wirkung und Ausstrahlungskraft oft hoffnungslos unterlegen“ seien und Spielfilme wie Fernsehspiele häufig gerade „auch wegen ihrer historischen Klischeebildung und narrativen Komplexitätsreduktion stärker und nachhaltiger zur Verortung der DDR im kollektiven Gedächtnis bei[trügen] als jede andere Form der Vergangenheitsvergegenwärtigung“.[1] Doch obwohl die konstatierte Wirkungsmacht medialer DDR-Repräsentationen kaum umstritten sein dürfte, haben sich bisher nur wenige Arbeiten damit beschäftigt, welche Bilder des ostdeutschen Arbeiter- und Bauernstaats (jenseits der großen Kinoleinwand) im Fernsehen entworfen werden.
Dabei kann der Blick auf Fernsehfilme und die Analyse ihrer Einzelbilder, die ihr Narrativ schließlich erst formen,[2] durchaus überraschende Erkenntnisse zutage fördern. Gerade eine Krimi-Reihe wie der „Tatort“, die „als letztes kollektives Erlebnis die bundesrepublikanische Gesellschaft regelmäßig erreiche“,[3] bietet sich als lohnender Untersuchungsgegenstand an.
Die „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ ist einer von insgesamt sieben Fernsehkrimis, die im Zentrum der aus einem Seminar an der Humboldt-Universität zu Berlin hervorgegangenen Podcast-Reihe „Geschichte im Fadenkreuz. Der Tatort und die deutsche Teilung“ stehen.[4] Anlässlich des doppelten Jubiläums „30 Jahre deutsche Einheit – 50 Jahre Tatort“ haben sich Studierende mit der Repräsentation der deutschen Teilung in der erfolgreichen Krimireihe befasst.
[...]
Quelle: https://visual-history.de/2021/03/22/im-zeichen-der-entspannungspolitik/