“Bei Wikipedia kann man keine Schweinehälften bestellen” – bei diesem Zitat aus dem Munde von Pavel Richter, einem der Vorsitzenden von Wikimedia Deutschland, könnte man durchaus vermuten, dass Internet sei noch immer nur ein Tummelplatz für Technikbegeisterte. 5ooo Internet-Faszinierte, zahlreiche Vertreter der klassischen Medien und auch einige der Politik, über 28o Sessions, Vorträge und Workshops, unzählige Tweets – die Zahlen machen klar, dass die re:publica längst für ein breitgefächertes Publikum das Highlight des Frühjahrs ist. Mit dem Motto “In / Side / Out of Science und Culture” im Gepäck, besuchte ich drei Tage Veranstaltungen zu Themen aus Kultur, Wissenschaft, Verlagen und E-Learning. Das Fazit vorweg: die digitale Revolution greift zunehmend auch auf diese Bereiche über, die Handlungsmöglichkeiten sind aber noch längst nicht ausgeschöpft. Und: neben Open Data oder Open Access treten nun auch Schlagwörter wie Open Expertise, Open Science, Open Culture oder Open Learning zunehmend in den Vordergrund.
Tag I – Von Ängsten und Möglichkeiten
Mein erster Tag auf der re:publica war bereits prall gefüllt mit lauter interessanten Projekten rund um die Sammlung, die Anwendbarkeit und den offenen Umgang mit Daten in Kultur und Wissenschaft. Ihrer Sammlung sind derzeit unzählige Projekte gewidmet, die Bücher (wie die Deutsche Digitale Bibliothek), museale Sammlungen (wie Open GLAM und Europeana) oder analoges Geschichtswissen (wie DigIt) digitalisieren. Und sie alle haben große Ziele.
Das WDR-Crowdsourcing Geschichts-Projekt DIGIT will kein Geld, sondern Wissen sourcen in Form von Zeitzeugen der Neuzeit wie Bildern und Videos. Der Erfolg seit Beginn der Kampagne im Dezember 2o12 ist groß, über 5ooo Fotos und 7oo Videos konnten gesammelt werden, um “analoge Erinnerung in die digitale Zukunft zu retten”. Eine solche Idee könnte für jeden Historiker ein faszinierendes und vielfältiges Archiv zugänglich machen. Gerade im Netz hat sie aber noch hohe Hürden zu überwinden, wie die hier angewandte rechtliche Basis zeigt. Da sich der WDR zu CC-Lizenzen für das zusammengetragene Material nicht durchringen konnte, wurde dieses unter nicht-exklusive Nutzungsrechte gestellt. Damit ist es zwar für den WDR weiterverwendbar, aber für Historiker, Interessierte, Blogger oder gar bloggende Historiker eben nicht.
Davon etwas ernüchtert, war ich umso begeisterter von dem Projekt OPEN GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) der Open Knowledge Foundation, das sich mehr Aufmerksamkeit und mehr Möglichkeiten der Nutzung des kulturellen Erbes zur Mission gemacht hat. Dabei soll vor allem die Öffentlichkeit eine große Rolle spielen, da sie als Finanzier einen Anspruch auf das von ihr finanzierte Wissen hat. Sehr gut fand ich neben dem prinzipiellen Anspruch der Open Knowledge Foundation ihre Zusammenarbeit mit Europeana, einem ähnlichen Projekt der EU, dass die Gemeinschaft Europas durch dessen gemeinsame Kultur und Geschichte betonen möchte. Hier werden Sammlungen unter Europeana als gemeinsamem Deckmantel digitalisiert, der die Verbindungspunkte der Länder verdeutlichen soll. Dies ist besonders wichtig, weil auch eine Vielzahl von Datenbanken für verschiedene Sammlungen nicht die gewünschten Ergebnisse bringen kann, wenn alle getrennt arbeiten und sich als unabhängig voneinander verstehen. Open GLAM und Europeana haben zusammen bereits mehr als 4o Millionen Daten gesammelt und mit CC-Lizensen online gestellt. Auch der nächste Schritt, ihre Anwendbarkeit, wurde in Form von Tools wie textus, timeliner oder crowdcrafting bereits in die Wege geleitet.
Bei einer Session, die im Namen der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) das Ende des Buches verkündete, stand jedoch wieder die Sammlung im Mittelpunkt, diesmal sogenannter gemeinfreier Bücher, die sich in den deutschen Bibliotheken und im Netz finden lassen. Auch wenn keineswegs das Ende des gedruckten Buches ausgerufen werden sollte, da die heutigen Bücher durch ihre Inhalte und Formen die Geschichtsquellen der Zukunft sind, geht es auch bei der DDB noch nicht primär um die Anwendbarkeit der Daten. Dies bedeutet nicht, dass es für nicht löblich wäre, für 12o Millionen Euro alle gemeinfreien Bücher in deutschen Bibliotheken zu digitalisieren, anstatt von demselben Geld einen Eurofighter zu kaufen. Aber gerade in Bezug auf die Anwendbarkeit von Open Data, die der eigentliche Kern der Forschung sein sollte, ist Open GLAM derzeit europaweit ein Vorbild für Projekte, die weiterhin im Status der reinen Digitalisierung verbleiben.
Das Ende des ersten Tages markierte für viele re:publica-Besucher der Vortrag von Sascha Lobo. Auch er sprach von Ängsten und Möglichkeiten, von der Netzgemeinde als Hobbylobby und Wut und Pathos als den Rezepten für ein freies, offenes und sicheres Netz. Die Drosselkom wurde nach diesem Vortrag nicht umsonst der meist-getwitterte Begriff der re:publica. Während Sascha Lobo die Netzpolitik als das schlimmste aller Orchideenfächer betitelte, war der Abschluss des Tages für mich vor allem der Blick über die unzähligen Reihen dieses buntgemischten und keineswegs nerdigen Publikums, das diesem Blogger lauschte, während die CDU noch immer glaubt, die Netzgemeinde sei eine eigenartige und etwas weltfremde Parallelgesellschaft.
Tag II – der Tag des Phönix
Während Open Data und Open Culture meinen ersten re:publica-Tag bestimmten, war der zweite geprägt von Open Expertise, Wissenschaftsjournalismus, Büchern und dem Ruf nach Open Open Open.
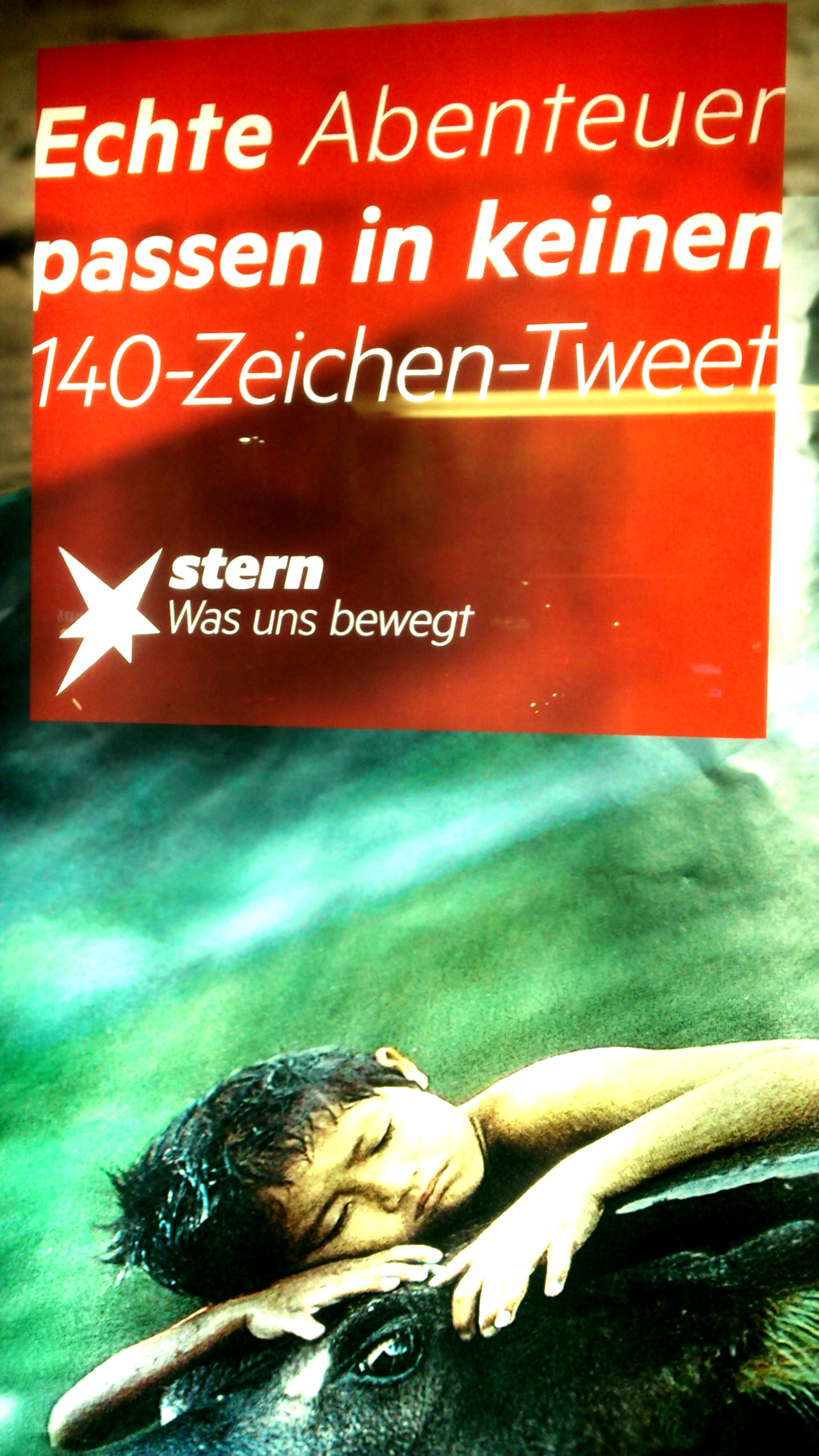
Leider ist das Social des Social Web auch im Journalismus noch nicht überall endgültig angekommen, wie die ersten beiden Sessions meines zweiten re:publica-Tages zeigten. So bleibt es weiterhin schwierig, die Menschen zu Teilnahme am journalistischen Diskurs zu bewegen, obwohl das öffentliche Interesse an wissenschaftlicher Aufklärung weiter ungebrochen ist. Hierfür spielen zwei Gründe eine Rolle. Zum einen bieten die großen Medien auch auf ihren Online-Plattformen nur suboptimale Diskussionsmöglichkeiten. Meist findet man eine Aneinanderreihung zahlreicher Kommentare mit nur wenig Bezug zueinander, kaum argumentative Sortierungen oder gar die Option zu direkten Bezugnahme auf einen bestimmten Absatz. Zum zweiten halten auch diejenigen Privatpersonen, die z.B. aufgrund von Hobbys wirkliche Ahnung haben, mit ihrem Wissen noch sehr oft hinterm Baum. Beides könnte dazu dienen, die Teilnahme an Open Expertise zu fördern und Lesern wie Journalisten neue Ideen und Betrachtungsweisen zu eröffnen. Auf der Suche nach der Wiedergeburt der Zeitung eröffnen sich so neue Wege, sich mit den Bedürfnissen und Fragen der Menschen direkter zu befassen. DER JOURNALISMUS IST TOD. ES LEBE DER JOURNALISMUS!
Ähnliches galt an Tag II für das Buch. Wie der Musikindustrie und dem Printjournalismus, reicht nun auch den geisteswissenschaftlichen und belletristischen Verlagen das Wasser der Gewohnheit bis an den Hals. Ein Damm der Innovationen muss gebaut und der Frage nachgegangen werden, was eigentlich noch Buch ist, auch wenn es noch scheint, als bleibe das gedruckte Buch weiterhin ein heiliger Gral, ein mythisches Ding mit geheimnisvoller Anziehungskraft. Denn definiert sich ein Buch über die Form, so sind weder Hör- noch E-Bücher Bücher. Definiert es sich über den Inhalt, ist alles Geschriebene Buch. Aber nur das gedruckte Buch riecht nach Buch, fühlt sich an wie Buch und ist dekorativ, wie nur Bücher es sein können. Trotzdem steigt die Beliebtheit von E-Books und Readern mit ihren Ideen von Offenheit, Teilbarkeit und wiederum Socialbarkeit. Wie die Platte in der MP3, wird also auch das Buch wiedergeboren. DAS BUCH IST TOD. ES LEBE DAS BUCH!
Die Digital Humanities versuchten am zweiten re:publica-Tag erneut, den Phönix aus der Asche zu erwecken. Was für die Humanities das Buch, ist für die Digital Humanities die Datenbank. Auch die EU machte Open Access in ihrer Agenda 2o2o zur Bedingung für öffentlich finanzierte Projekte. Doch leider scheint es, als wären die DH zwar ihrer Aufgabe entsprechend sehr stark digital geworden, hätten dabei aber viel ihres Humanities-Daseins verloren. Die TOOLIFICATION steht im Mittelpunkt, während die Forschung und wiederum der Aspekt des Social noch fehlen, den die reine Zugänglichmachung von Erkenntnissen in Form von Daten nicht abdecken kann. Kommunikation wird noch nicht groß geschrieben und das obwohl die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Forschung und der Forschung an die Forschung sich teilweise sehr stark unterscheide. Die Kernfrage ist: was kann man vermitteln, was will man vermitteln und wer trägt die Kosten? Von der Beantwortung ist Open Science jedoch nicht weit entfernt und so ist der Phönix gerade erst zu Asche geworden.
Tag III – Lernen Lernen Lernen
Mein dritter re:publica-Tag stand unter dem Motto RE:LEARNING. Dabei wurde schnell deutlich, dass die digitale Revolution auch hier weder für die Kinder- noch für die Erwachsenenbildung ihr schöpferisches Potential bisher voll ausgenutzt hat. Dies liegt anscheinend daran, dass die herkömmlichen Herangehensweisen noch immer sehr stark sind und nur schwer zugunsten neuer Optionen aufgegeben werden wollen. Die Hoffnung war ein aktives, selbstbestimmtes, individuelles, kreatives Lernen durch Tools, die sich an die Bedürfnisse der Schüler, gleich welchen Alters, anpassen lassen. Tatsächliche bieten sie dafür bisher aber nur wenig Optionen. Dies gilt für digitale Schulbücher ebenso, wie für MOOCs. Die meisten Materialien lassen sich zwar downloaden, aber nicht verändern, die Hierarchie zwischen Lernenden und Lehrenden wird noch nicht überwunden und auch die Lernziele sind noch zu unflexibel. Inwieweit dies alles erstrebenswert ist, mag diskutabel sein, trotzdem ändert sich zurzeit primär das Lehren anstatt das Lernen.
Gerade Gamification ist hier ein interessanter Ansatz, der sich auch auf die Vermittlung von Geschichte und Kultur sehr gut übertragen lässt. Eine der Sessions widmete sich dem EDUCACHING, das in einem Berliner Projekt das beliebte Geocaching mit der Suche nach historischen Orten und Geschehnissen innerhalb der Stadt verbindet. Eine virtuelle Schnipseljagd mit Rätseln und Abenteuern, ein Tripventure, digitale Inhalte an realen Orten. Eine Form des Lernens also, die nicht nur in Berlin funktionieren kann und Kompetenz anstatt nur Qualifikation vermittelt.
Während zurzeit vor allem die Schulen noch mit der Angst vor Kontrollverlust durch das Internet zu kämpfen haben und ein wenig die Hoffnung zu schüren scheinen, es gäbe eine Rückkehr zu der Zeit vor dem Netz, übertragen die Universitäten zwar Kurse ins Netz, nutzen aber auch nur selten hierfür wirklich innovative Methoden. Online-Vorlesungen, gepaart mit Tests und Abschlussklausuren, wie sie udacity oder coursera mit Universitätspartnern wie Berkeley, Harvard und dem MIT bieten, sind dieselbe Form des Lehrens in einem anderen Medium und versprechen nur bedingt eine Verbesserung der Lern-Situation. Auch hier herrscht noch ein gewisses Maß an Unflexibilität. Zwar sind die Themen vielfältig und auch zukunftsträchtig, die wirkliche Nutzbarkeit für jeden ist durch technische, sprachliche und zeitliche Voraussetzungen jedoch weiterhin eingeschränkt. Zudem stehen die Materialien nicht frei zur Verfügung, sondern gehören den jeweiligen Universitäten. Es verwundert demnach nicht, dass die Mehrheit der Teilnehmer nach wie vor Akademiker sind.
 Die Ideen des re:learning mögen demnach noch nicht ideal umgesetzt sein, digitale Schulmaterialien, virtuelle Diskussionsräume und eine verstärkte Ausrichtung auf den Social-Aspekt des Web 2.o zeigen aber das Licht am Ende des Tunnels. Insgesamt versprachen trotz noch offener Möglichkeiten und einem gewissen Festhalten an der Gewohnheit alle von mir besuchten Sessions, egal ob Open Culture und Open Science, Open Book oder Social Learning, denn auch neue Optionen, mit den Problemen der Welt umzugehen und mit innovativen Methoden durch die Zugänglichkeit von Wissen Lösungen zu schaffen. Denn nicht jeder hat, wie ich wortwörtlich am Ende der re:publica 2013 noch lernen durfte “the right mindset to study .. let’s say ancient history”..
Die Ideen des re:learning mögen demnach noch nicht ideal umgesetzt sein, digitale Schulmaterialien, virtuelle Diskussionsräume und eine verstärkte Ausrichtung auf den Social-Aspekt des Web 2.o zeigen aber das Licht am Ende des Tunnels. Insgesamt versprachen trotz noch offener Möglichkeiten und einem gewissen Festhalten an der Gewohnheit alle von mir besuchten Sessions, egal ob Open Culture und Open Science, Open Book oder Social Learning, denn auch neue Optionen, mit den Problemen der Welt umzugehen und mit innovativen Methoden durch die Zugänglichkeit von Wissen Lösungen zu schaffen. Denn nicht jeder hat, wie ich wortwörtlich am Ende der re:publica 2013 noch lernen durfte “the right mindset to study .. let’s say ancient history”..



