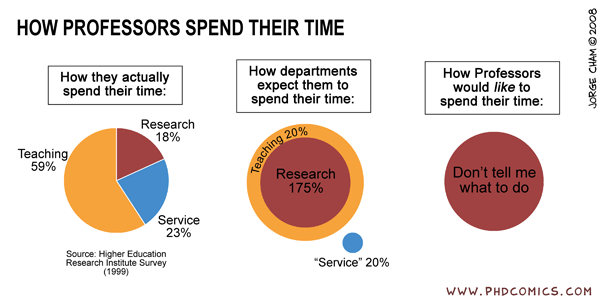Dieser polemische Kommentar aus der paradoxen Sicht eines bloggenden Digital Humanities-Skeptikers ist ein Beitrag zur Blogparade #wbhyp von de.hypotheses.org. Lasst euch nicht abschrecken, ich meine es gut…
Auf der Suche nach den digitalen Räumen – gefangen im digitalen Samsara
Alles muss digital werden, so ist nun mal der Fortschritt – und nützlich ist es ja auch (will nicht sagen bequem), die Welt zu sich bringen zu können, ohne den Schreibtisch neben der dampfenden Kaffeemaschine je verlassen zu müssen. Denn welchen Anreiz kann es noch geben, von Angesicht zu Angesicht wissenschaftliche Fragen zu debattieren, sich in Theorien zu graben und Satz für Satz mit seinen Kommilitonen zu zerlegen, zu hinterfragen und sich anzueignen, wenn alles irgendwo schon auf drei Seiten zusammengefasst, als gültige Wahrheit reproduziert und stets abrufbar ist? Im Zeitalter der Zeitlosen, wo alle getrieben, unstet, ja rasend sind, ob der Verpassens-, Versagensangst orientierungslos durch die Optionenflut wabern, scheint der Vormarsch der Digital Humanities, – die wie immer mit großer Verzögerung, auch Deutschland erreichen, beinahe als etabliert gelten können – einen faden Beigeschmack zu haben.
In einem Beitrag zur Blogparade wird Bloggen bezeichnenderweise als „nichts weniger als die ‚Rettung‘ aus meinem (dunklen!) Elfenbeinturmzimmer” zelebriert und dies auch noch als „eine sehr schöne Begrüßung an die lesende Community“ bezeichnet. Ganz ähnlich geht es weiter, wenn frohen Mutes festgestellt wird, wissenschaftliches Bloggen helfe Studierenden ihren Schreibstil zu verbessern, Hierarchiedenken zu überwinden und einfach wissenschaftliche Erkenntnisse zu publizieren. Der Kommentar dazu, „wie wichtig es wäre, dass mehr Dozenten auf diesem Weg für Studierende erreichbar sind“, treibt es dann noch auf die Palme. Liebe Leute, ihr solltet euer Verständnis von Universität und euer studentisches (Selbst-) Bewusstsein überdenken, denn die Hierarchieüberwindung, den wissenschaftlichen Diskurs auf Augenhöhe stetig einzufordern, ist euer gutes Recht – schließlich sind Studierende wie Dozierende Kommilitonen im Dienste der Wissenschaft! Wenn Mareike König (richtigerweise) nach dem Nutzen des Bloggens, dem return of investment fragt – ist das dann Ausdruck einer Selbstkrise der Geisteswissenschaften? Haben wir (insbesondere auch die Studierenden) vergessen, warum wir Wissenschaft betreiben (oder dass wir es überhaupt tun)?!
Solche Aussagen sind darum in meinen Augen in erster Linie auch nicht Ausdruck des Mehrwertes der Digital Humanities, sondern trauriges Sinnbild für den Zustand der deutschen Universitäten, die nicht länger Ort der kritischen Wissenschaft und Reflexion, sondern produzierende Ausbildungsfabriken sind, in denen jede selbstbestimmte Forschung, jedes studentische Projekt, jede tiefgehende Diskussion bitter erkämpft werden muss.[1] Und in der Tat zeigt sich damit auch schon das Dilemma des wissenschaftlichen Bloggers: Er will die Diskussion, die ungezwungenen Gedankenstrukturierung, den wissenschaftlichen Austausch und ganz sicher auch die wissenschaftliche Anerkennung der Standesgenossen – erlangen aber kann er sie über einen Blog kaum bis gar nicht, denn in Zeiten der Beschleunigung werden Beiträge, die länger als drei A4-Seiten sind, weggeklickt, müssen leicht geschrieben sein, werden Beiträge kaum gelesen und noch weniger kommentiert und geht schlicht in der Flut der Posts unter.
Insofern beschränkt das Internet sogar den Wissenserwerb, denn suchen kann ich nur, wovon ich bereits weiß. In der Zeit des schnellen Zugriffs droht das Gedankengebäude zu einem gesetzten Informationsgebäude zu verkommen. Der flächendeckende Open Access entfremdet die Studierenden noch zusätzlich von der wissenschaftlichen Diskussion – dort geht es tendenziell nur um Wissensabfrage/Wissensakkumulation, die „Automatisierung des Kollationierens und Textvergleichs“[2] (ist das dann überhaupt noch Wissenschaft?) wird als Fortschritt gefeiert. Unter der reinen Quantität leidet jedoch die Qualität, wenn das Hinterfragen, Diskutieren, das Denkenlernen ausbleibt. Und schließlich: wie soll der Laie erkennen, welcher Post wissenschaftlich ist und welcher nicht? Gibt es bald den Blogging-TÜV?
Ich habe mich vor einiger Zeit auf der Plattform academia.edu angemeldet, auf der hauptsächlich „richtige“ Fachliteratur online zur Verfügung steht (und mittlerweile auch Diskussions-Sessions zu Papers möglich sind) und selbst dort kann ich kaum die Menge täglich hochgeladener Artikel und Beiträge bewältigen, die nur in den Themenbereichen liegen, die ich als meine Forschungsinteressen angegeben habe. Mit diesem Problem haben auch die Digital Humanities zu kämpfen: der Steigerungswahn (mehr Posts, mehr Leser, mehr digitale Quellen, mehr Querverweise) droht sie in die Belanglosigkeit hinab zu reißen, bevor sie überhaupt wissenschaftlich langfristig etabliert sind. Das Bloggen erscheint dann schon in weiten Teilen (wissenschaftliche Projektblogs vielleicht ausgenommen) fast als das ewige Treten im Hamsterrad, als Selbsttherapie einer verunsicherten, geängstigten, uneigenständigen Generation von Jungwissenschaftlern, die sich hinter dem Deckmantel der vermeintlichen Professionalität einigelt, als zwanghafte Selbstvergewisserung bzw. Selbstlegitimierung der Geisteswissenschaften unter der Fuchtel der ökonomisch verwertbaren MINT-Konkurrenten. Ob die Digital Humanities die „Krise der Geisteswissenschaften“ tatsächlich überwinden helfen, oder eher noch verstärken, steht eindeutig zur Disposition. Ich stimme Mareike König zu: Vergesst die wissenschaftliche Anerkennung von Blogs!
Vom Samsara zum Nirwana – wo bleibt der Erkenntnisgewinn?
Die Digital Humanities haben durchaus einen Nutzen, das will ich gar nicht bestreiten: „Digitale Informationen sind global verfügbar, und Nutzerinnen und Nutzer kommunizieren grenzüberschreitend miteinander. Methoden, Konzepte und Produkte der Digital Humanities sind daher nicht auf einen national definierbaren Raum begrenzt, sondern wirken durch das Medium grenzüberschreitend und stiften transnationales Wissen.“[3] Zu diesem Zwecke braucht es Plattformen wie hypotheses.org und H-Soz-Kult.[4] Denn ganz ähnlich wie die Mikrogeschichte, die sich in den 1980er/90er Jahren aus der Sozial- und Alltagsgeschichte entwickelt hat, verfügen die Digital Humanities über ein großes Potenzial, das sich aus der digitalen Erfassung von quantitativen Massenquellen ergibt, wenn diese zielführend auslesbar sind und vor allem qualitative Problemquellen zur Verfügung stehen, mit denen sie kombiniert werden können! Dieses komparatistische Element scheint jedoch noch lange nicht kategorisch implementiert zu sein: „In contrast to earlier work, digital history projects tend to be interdisciplinary and interactive, encouraging user participation and engagement with sources in multimodal and experimental ways. Much of the work is still, however, orientated towards single text based sources (e.g. corpora) and seldom ventures outside traditional disciplinary boundaries. As such, little advantage is taken of the increased possibilities for interdisciplinary science offered by digital techniques.“[5]
Die Ordnung des Diskurses – weiß der Blogger um die Wirkung seines Posts?
Zweifelsohne liefert das Bloggen eine hervorragende Möglichkeit, Projekte und Forschungsstände mitzuteilen, die Konzeption und Methodik zu erläutern, zu reflektieren und Menschen Einblicke zu gestatten, die sonst nie dazu kämen, diese zu erhaschen. Forschungsstände und -ergebnisse werden für jeden zugänglich: die Erfüllung des Aufklärungsideals!(?) Doch wie diese Ergebnisse präsentiert, die Beiträge geschrieben werden, hat sowohl einen massiven Einfluss darauf, ob, von wem und wie oft sie gelesen werden, aber auch welche Beiträge vom Leser präferiert werden. Hier zeichnet sich eine „tendency to confuse quality or relevance with popularity“[6] ab. Außerdem trägt die Art und Weise, wie gebloggt wird, dazu bei, wie die jeweilige Geisteswissenschaft öffentlich wahrgenommen wird – ohne Qualitätssicherung und mit dem Impetus „jeder kann’s“ untergräbt das allerdings die Legitimation akademischen Disziplinen immer weiter (jedenfalls aus der Sicht derer, die die Universitäten als ökonomische Betriebe betrachten). Damit scheint das Historyblogging sich der „Angewandten Geschichte“ anzuschließen und eben zu versuchen, Geschichte zu vermitteln und Wissenschaftler und Laien in den Erkenntnisprozess einzubeziehen. Es vertritt das von der Geschichtswerkstätten-Bewegung der 1980er Jahre postulierte „zivilgesellschaftliche Credo“, nachdem jeder etwas beizutragen habe und das im Zweifelsfall der historischen Selbstverortung der Subjekte zum Steigbügelhalter gereicht.[7]
Man soll mich nicht falsch verstehen: Ich bin ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die gesellschaftliche Bedeutung der Geisteswissenschaften zu verdeutlichen und deren gesamtgesellschaftliche Interventionen voran zu treiben! Aber ist dem Blogger seine Rolle im Diskurs bewusst? Weiß er um die hegemonialen Verschiebungen, an denen er teilhat, ohne es zu ahnen oder zu wollen, weil er sich lediglich digital erproben möchte? Wenn aufgerufen wird, alles erst mal zu posten, denn der Rezipient könne dann filtern, was gut und was schlecht ist, dann vergisst man, in welchem Medium man schreibt und dass man tendenziell Objektivierungen von Wahrheiten produziert, die der weniger reflektierende und nicht wissenschaftlich (aus-) gebildete Laie nicht als solche zu enttarnen vermag. Der Historismus, als Dogma der historischen Gesetzmäßigkeiten, steigt aus dem Grab.
Und gleiches gilt auch für den Forschenden selbst, denn wer bestimmt welche Bestände ausgewählt und digitalisiert werden, wie sie verschlagwortet werden, was die Suchmaschinenalgorithmen wie ausgeben? All das bestimmt unweigerlich die Wissenschaftspraxis und determiniert den Ausgang der Forschung, ja definiert unmittelbar den (vermeintlichen) Erkenntnisgewinn. Gleichsam stürzt es den Forschenden in eine Objektivitätskrise, in der er schlechterdings nicht mehr erkennen kann, was Original und was Kopie oder gar Fälschung ist. Die Flut potenzieller Informationen und Quellen erstickt den freien Forschergeist.[8] Nochmal: Die Digital Humanities verkörpern gleichsam den gesamtgesellschaftlichen Steigerungswahn, der in der sozialen Beschleunigung schließlich zum „rasenden Stillstand“ führt.[9] Mit kritischer Wissenschaft hat das unter diesen Prämissen produzierte Ergebnis sicherlich nichts mehr gemein – in ihrem Drang nach Eigenlegitimation tritt die Wissenschaft auf der Stelle oder begnügt sich mit ihrer Rolle als Zulieferer.
Und wenn die aufgeführten Kritikpunkte (zumindest teilweise) zutreffem, was ist dann überhaupt das Ziel der Digital Humanities bzw. des Historybloggings: fachwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn und Selbstvergewisserung via Networking (eben auch im Bezug auf die Beschleunigung von Quellenzugriff und -verwertung) oder fachdidaktische Vermittlung von Geschichte (also politische Bildung)? Und wie erreicht man womit den richtigen Adressaten?
Through the gates of hell – ein skeptischer Blogger
Warum blogge ich, wenn ich so viele Zweifel hege? Weil auch ich wissenschaftlichen Blogs etwas abgewinnen kann, weil ich die Möglichkeit schätze, in einer vernetzten Welt auf (in unserem Fall wohl hauptsächlich studentische) Arbeiten und Projekte hinzuweisen, die andernfalls nur von Dozierenden, manchmal im Kreise des Institutes, selten darüber hinaus wahrgenommen werden. Aber auch weil ich es schätze, mit diesem Beitrag zur Blogparade oder fachlichen Posts an einer Debatte zu partizipieren, die ggf. eine geisteswissenschaftliche Disziplin formt und den Geisteswissenschaften zu neuer Popularität verhilft. Dazu aber müssen einige Bedingungen erfüllt sein (oder eben nicht?), die ich oben angerissen habe. Und vielleicht sind Plattformen wie de.hypotheses.org ein primo victoria für die digitalen geisteswissenschaftlichen Diskurs auch in Deutschland – der Weg zum Ziel jedoch scheint mir noch ein weiter zu sein. Vorerst drängt sich mir auf, dass es , wie Slavoj Žižek sagt, in erster Linie darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, nicht Antworten zu geben.
[1] Zynisch wie amüsant (jedenfalls für den kritischen Studierenden) hat das zuletzt am treffendsten wohl Birger P. Priddat auf den Punkt gebracht. Vgl. Wir werden zu Tode geprüft! Wie man trotz Bachelor, Master & Bologna intelligent studiert, Hamburg 2014.
[2] Hans-Christoph Hobohm: Rezension zu: Terras, Melissa; Nyhan, Julianne; Vanhoutte, Edward (Hrsg.): Defining Digital Humanities. A Reader. London 2013 / Warwick, Claire; Terras, Melissa; Nyhan, Julianne (Hrsg.): Digital Humanities in Practice. London 2012, in: H-Soz-Kult, 05.01.2015,<http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-22690>.
[3] Peter Haslinger: Digital Humanities und transnationale Geschichte, 07.05.2015 – 09.05.2015 Marburg, in: H-Soz-Kult, 22.10.2014,<http://www.hsozkult.de/event/id/termine-26158>.
[4] Vgl. H-Soz-Kult Redaktion: Editorial: The Status Quo of Digital Humanities in Europe, in: H-Soz-Kult, 23.10.2014,<http://www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-2375>.
[5] Thomas Nygren / Anna Foka / Philip Buckland: The Status Quo of Digital Humanities in Sweden: Past, Present and Future of Digital History, in: H-Soz-Kult, 23.10.2014, <http://www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-2402>.
[6] Thomas Nygren / Anna Foka / Philip Buckland.
[7] Vgl. Jürgen Bacia: Rezension zu: Nießer, Jacqueline; Tomann, Juliane (Hrsg.): Angewandte Geschichte. Neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit. Paderborn 2014, in: H-Soz-Kult, 03.02.2015,<http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-22910>.
[8] Vgl. Hannah Janowitz: Tagungsbericht: „Wenn das Erbe in die Wolke kommt.“ Digitalisierung und kulturelles Erbe, 13.11.2014 – 14.11.2014 Bonn, in: H-Soz-Kult, 03.02.2015, <http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5817>.
[9] Vgl. Hartmut Rosa: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt am Main 2012; Hartmut Rosa: Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Umrisse einer neuen Gesell-schaftskritik, Berlin 2013.
Abbildung: I+C+i // Humanitats Digitals von Samuel Huron, Lizenz CC BY-NC-ND 2.0