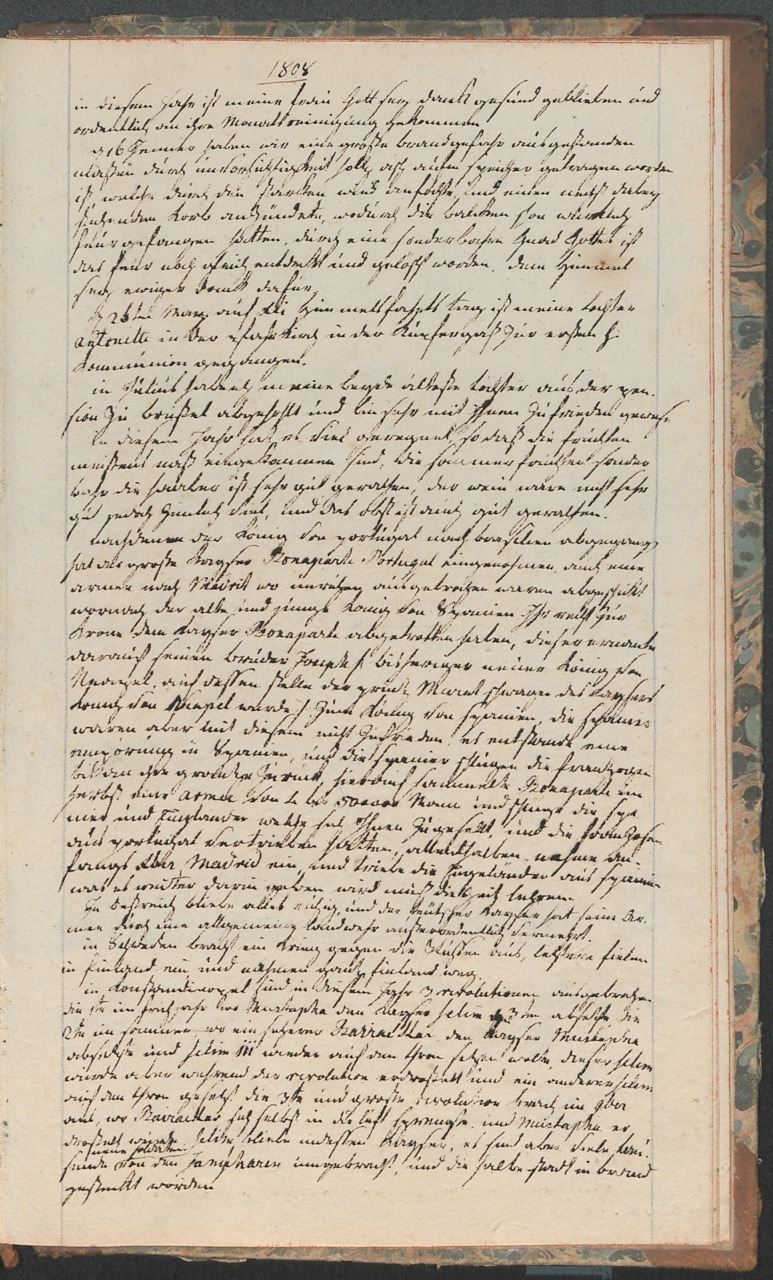(Ein Beitrag zur Blogparade anlässlich des zweiten Geburtstages von siwiarchiv)
Natürlich ist es vermessen, für das Thema Archive und Bloggen einen der ganz großen Sätze der deutschen Geistesgeschichte zu bemühen. Einerseits. Andererseits lässt sich mit Blick auf den digitalen Auftritt der Archive durchaus eine selbstverschuldete Unmündigkeit von Kant’schen Dimensionen konstatieren: Unmündigkeit meint hier das Unvermögen, sich der immensen Möglichkeiten der digitalen Welt zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, weil die Ursache derselben nicht am Mangel der Möglichkeiten, sondern an der Entschließung und dem Mut liegt, sich dieser Medien zu bedienen. Wir erleben gegenwärtig einen derartig allumfassenden Medienbruch, wie er wohl zuletzt mit der Erfindung des Buchdrucks zu erleben gewesen war, aber so richtig ist das bei den Archiven nicht angekommen. Gut, die Mail hat weithin den Brief ersetzt und die Homepage (wenn auch keineswegs allerorten) die gedruckten Flyer und Beständeübersichten. Und die ganz Mutigen sind jetzt sogar schon bei Facebook dabei. Aber die Konzepte hinter diesen neuen, den sozialen Medien sind kaum einmal rezipiert, geschweige denn umgesetzt worden: Interaktivität, Kommunikation, Offenheit, Vernetzung. Archive haben es geschafft, ihren analogen Arbeits- und Denkstrukturen ein digitales Mäntlein umzuhängen ohne aber ihre Arbeit digital zu definieren. Das ist misslich, langfristig wird daran aber kein Weg vorbeiführen. Und allerspätestens dann wird es eine Basis in der digitalen Welt brauchen. Und an dieser Stelle kommt die obige Frage ins Spiel: Warum sollten Archive worüber wie bloggen?
Archive sollten bloggen, um wahrgenommen zu werden.
Archive sind wie schwarze Löcher. Man weiß wenig über sie. Das gilt für den Großteil der Bevölkerung, die in einem Archiv allenfalls eine bibliotheksähnliche Einrichtung mit alten Dokumenten in unzugänglichen Kellerräumen vermutet. Das gilt für Behörden, denen häufig genug nicht klar ist, dass ihre eigenen Altakten nicht in den Papiermüll, sondern in ein Archiv gehören. Das gilt selbst für fortgeschrittene Nutzer, die wohl eher das vorhandene Archivgut als quasi gottgegeben nutzen als die Überlieferungsbildung nachzuvollziehen. Alle diese Gruppen müssen Archive als hermetisch abgeschlossene Räume wahrnehmen, deren Innenleben ihnen nur soweit offenbart wird, wie es für das sporadische Miteinander unvermeidlich ist. Das gilt aber auch für die Archivarinnen und Archivare, also für die Fachöffentlichkeit. Natürlich nicht in dem Sinne, dass man nicht weiß, was Archive im Allgemeinen machen, sondern in dem Sinne, dass man nicht weiß, was denn die Archivarinnen und Archivare andernorts im Speziellen denn so machen. Ich habe als nordrhein-westfälischer Archivar keine Ahnung, was denn die Kolleginnen und Kollegen in, sagen wir, einem bayerischen Staatsarchiv oder einem mecklenburg-vorpommerischen Kommunalarchiv machen. Und das, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass wir vielfach vor ähnlichen Fragen und gleichen Problemen stehen. Wir haben aber kein reguläres Medium, um unsere Fragen publik zu machen, unsere Überlegungen zu teilen, unsere Lösungen zu entwickeln. Selbst als Kollege kann ich nicht hinter die fensterlose Mauer schauen, mit der sich Archive nicht nur physisch umgeben. Ein Blog löst diese hermetische Abschottung auf. Mit einem Blog können Archive ihre Arbeit begleiten und transparent machen. In einem Blog könnte man – zumindest ausschnittsweise – verfolgen, was Archive umtreibt. Über ein Blog lassen sich Zielgruppen erreichen, die vielleicht Interesse an Arbeit und Beständen eines Archivs haben, gegenwärtig aber keine Informationen vermittelt bekommen. Archive sind einzigartige Einrichtungen am Schnittpunkt von Verwaltung, Kulturpflege und Wissenschaft und verfügen (nach Prantl) sogar über „Systemrelevanz“. Ihre Bedeutung steht und fällt mit ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Wahrgenommen aber wird man zunehmend über soziale Medien – und Blogs sind das soziale Medium schlechthin, um Inhalte in den digitalen Raum zu vermitteln.
Archive sollten bloggen, um digital sprachfähig zu sein.
Das Internet ist ein gigantischer universaler Diskursraum. Im Internet bewegen sich Millionen von Menschen, die über Millionen von Themen diskutieren. Natürlich gehört auch Geschichte dazu und damit sind auch Archive berührt. Partizipieren können Archive aber nicht an einer einzigen dieser Diskussionen. Archive sind nämlich digital nicht sprachfähig. Ihre einzige Möglichkeit, ihren Interessenten im virtuellen Raum etwas mitzuteilen, ist die Homepage – ein hierarchisches und statisches Medium, dessen Struktur jeglichen Kommunikationsakt auf das einseitige Verkünden sakrosankter Verlautbarungen reduziert. Eine Homepage ist damit für die Präsentation persistenter Informationen prädestiniert, etwa für E-Texte oder Online-Findmittel inkl. Digitalisate. Ein soziales Medium ist sie allerdings nicht, sie erlaubt kein Miteinander, keinen Austausch, keinen Diskurs. Will man mit seinen Nutzern in einen Dialog eintreten, so kann nicht die Homepage das Medium der Wahl sein, wohl aber das Blog. Ein Blog verkündet keine unveränderlichen Fundamentalinformationen, sondern ist Teil eines allgegenwärtigen kontinuierlichen Diskurses, etwa über archivische, historische und kulturelle Themen. Mit einem Blog kann ein Archiv aktuelle Arbeiten, markante Themen oder spezifische Probleme an einen interessierten Adressatenkreis vermitteln. Mit einem Blog macht ein Archiv ein Gesprächsangebot: Es berichtet von seinen Aufgaben und Projekten, die Nutzer reagieren auf die gebotenen Informationen. Blogbeiträge werden rezipiert und mit Blogbeiträgen andernorts beantwortet. Manches wird Zuspruch ernten, anderes Widerspruch. Nutzerinteressen werden ersichtlich, Nutzerressourcen erschlossen, Nutzerbindungen geschaffen. Ein Blog führt Archiv und Nutzer in einem gemeinsamen Diskursraum zusammen. Wo die Homepage der Balkon ist, von dem ein Ausrufer die wichtigsten Informationen verkündet, da ist das Blog der Tisch, an dem Gesprächspartner auf Augenhöhe zusammenfinden und über ihre Anliegen diskutieren.
Archive sollten bloggen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Niemand kann ernsthaft annehmen, dass das Internet, das Social Web, das Semantic Web nur eine Zeiterscheinung sein werden. Ganz im Gegenteil: Digitalisierung und Virtualisierung werden weiter zunehmen. Geschehen wird das auch und gerade dort, wo Archive tätig sind: im Bereich der Informationsdienstleistung. So werden bereits in den nächsten Jahren Millionen von Digitalisaten online vorliegen und die Nutzung von Archiven auf eine neue Grundlage stellen. Nutzer werden Archiven zunehmend virtuell begegnen. Solche veränderten Nutzungsgewohnheiten werden aber auch neue Strukturen bedingen, um miteinander zu kommunizieren. Archive brauchen nicht nur leistungsfähige Präsentationsplattformen (z.B. Archivportale), sie brauchen auch Kommunikationskanäle, um ihren Nutzern begleitende Informationen näher zu bringen. Die sozialen Medien eignen sich wunderbar, um den Kontakt zwischen Archiven und Nutzern herzustellen. Manche von ihnen sorgen für die Vernetzung (z.B. Facebook, Twitter), andere aber transportieren die Inhalte, insbesondere nämlich Blogs. Wer dieses Prinzip heute nicht versteht, wird es schwer haben, morgen seine Adressaten zu erreichen. Dabei sind Blogs (wie auch allen anderen soziale Medien) keineswegs die Zukunft, sie sind bereits die Gegenwart. Zukunft sind sie lediglich für die deutschen Archive, die sich ihrer Möglichkeiten bis jetzt noch nicht gewahr worden sind. Gerade deshalb sind die Pioniere gar nicht genug zu loben, die einer konservativen Branche den Weg zu neuen Medien und Möglichkeiten bereiten – alles Gute, siwiarchiv, auf viele weiter Jahre!
Und natürlich: Sapere aude!
Quelle: http://archive20.hypotheses.org/1244