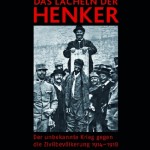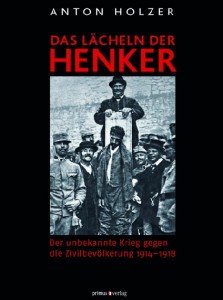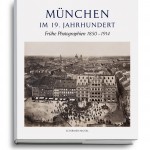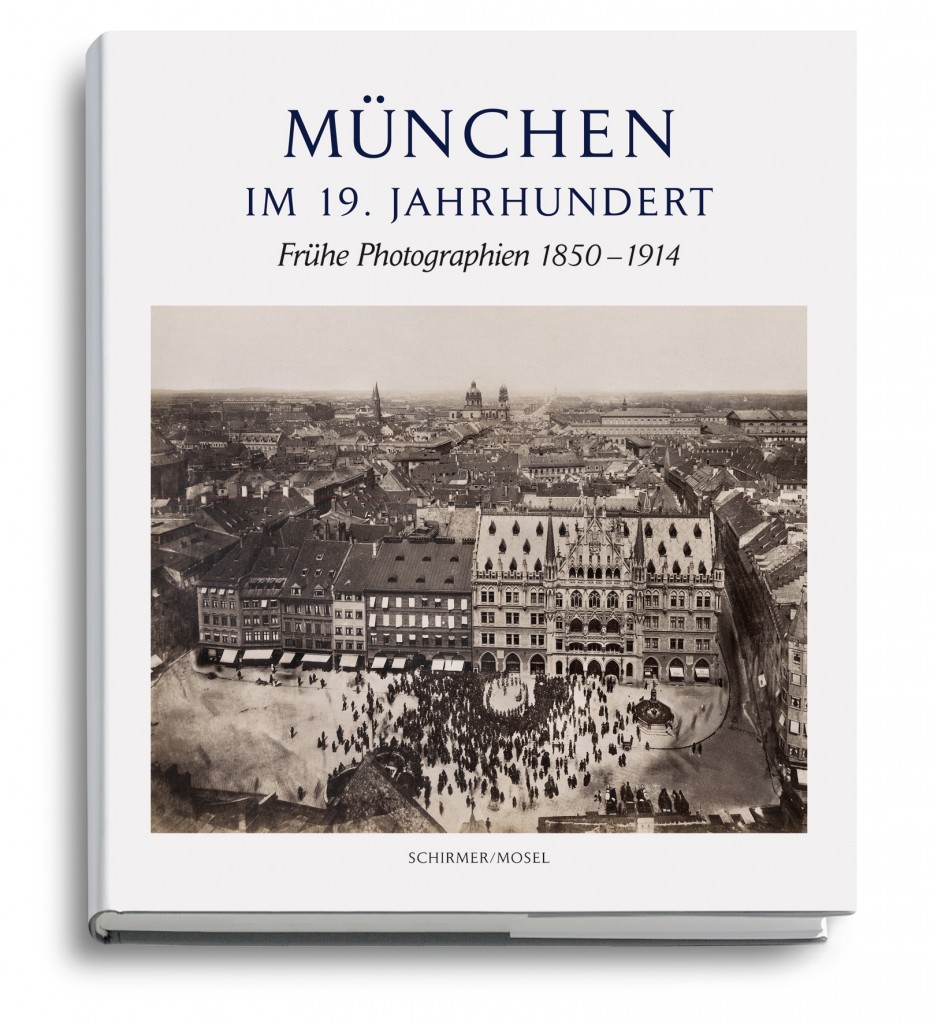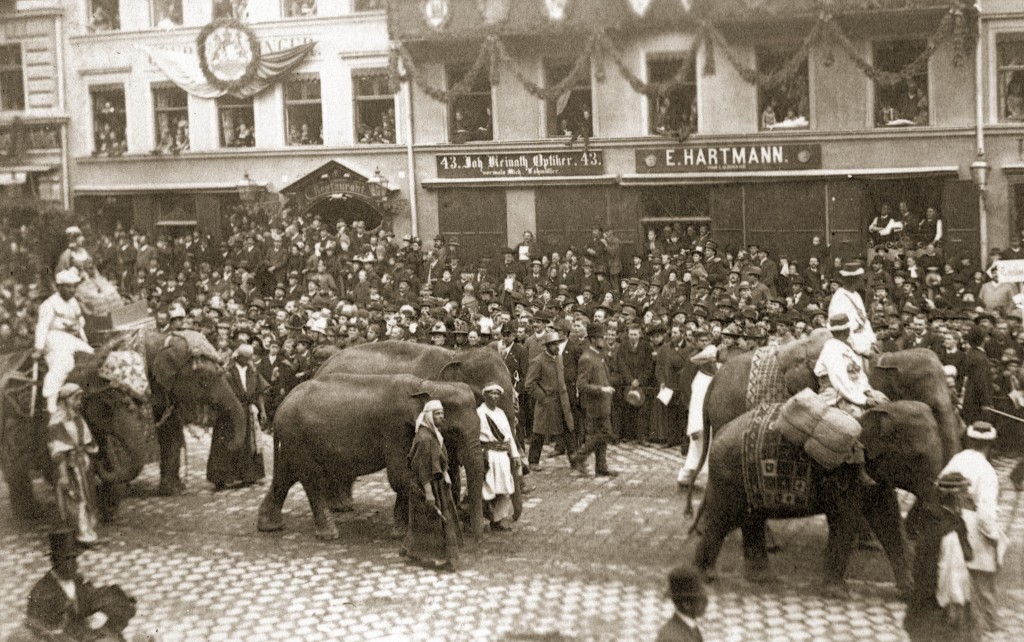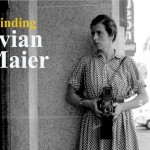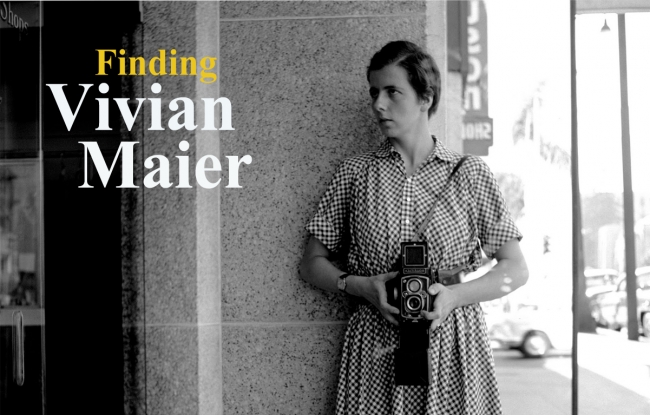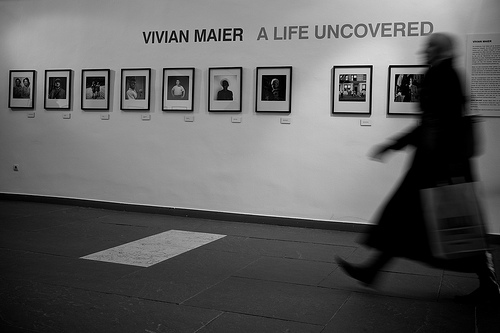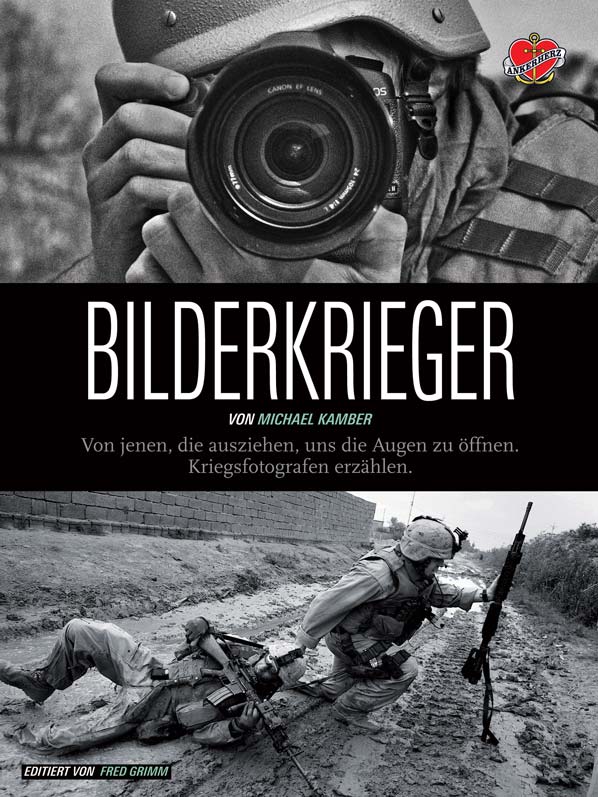Die Links zur Historischen Zeitschrift sind nicht Open Access, sondern nur über Institutionen mit einem Abonnement aufrufbar.
Stefanie Gänger: Rezension zu: Sabine Anagnostou: Missionspharmazie. Konzepte, Praxis, Organisation und wissenschaftliche Ausstrahlung. Stuttgart 2011, in: H-Soz-u-Kult, 02.07.2014
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014-3-005
Karl Vocelka: Rezension zu: Jean Andrews / Marie-Claude Canova-Green / Marie-France Wagner: Writing Royal Entries in Early Modern Europe (Early European Research, 3). Turnhout 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/andrews_vocelka
David Frick: Rezension zu: Matthias Asche / Werner Buchholz / Anton Schindling (Hgg.): Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721. Teil 1-4. Münster 2009-2012, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/25662.html
Marc Mudrak: Rezension zu: Alexandra Bamji / Geert H. Janssen / Mary Laven (ed.): The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation. Farnham 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/bamji_mudrak
Eckhart Hellmuth: Rezension zu: Thomas Biskup: Friedrichs Größe. Inszenierungen des Preußenkönigs in Fest und Zeremoniell 1740-1815, Frankfurt/M. 2012, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/20788.html
Anne Begenat-Neuschäfer: Rezension zu: William Brooks: Christine McCall Probes / Rainer Zaiser (dir.): Lieux de culture dans la France du XVIIe siècle (Medieval and Early Modern French Studies, 11). Bern, Berlin, Bruxelles et al. 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014.
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/brooks_begenat-neuschaefer
Geoffrey Parker: Rezension zu: Jean-Philippe Cénat: Le roi stratège. Louis XIV et la direction de la guerre (1661–1715). Rennes 2010, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/cenat_parker
Andrea Iseli: Rezension zu: Marco Cicchini: La police de la République. L’ordre public à Genève au XVIIIe siècle. Préface de Michel Porret. Rennes 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/cicchini_iseli
Andrea Bendlage: Rezension zu: Faramerz Dabhoiwala: Lust und Freiheit. Die Geschichte der ersten sexuellen Revolution. Stuttgart 2014, in: H-Soz-u-Kult, 22.07.2014
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014-3-056
Birgit Emich: Rezension zu: C. Scott Dixon: Contesting the Reformation (Contesting the Past). Malden, Mass./Oxford/Chichester 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 792-793, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0267
Sven Externbrink: Rezension zu: Étienne Dolet: De officio legati. De immunitate legatorum. De legationibus Ioannis Langiachi Episcopi Lemovicensis (Les classiques de la pensée politique, 23). Genève 2010, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/dolet_externbrink
Oliver Mallick: Rezension zu: Anaïs Dufour: Le pouvoir des »dames«. Femmes et pratiques seigneuriales en Normandie (1580–1620). Rennes 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/dufour_mallick
Jürgen Overhoff: Rezension zu: Patrick M. Erben: A Harmony of the Spirits. Translation and the Language of Community in Early Pennsylvania. Chapel Hill, N. C. 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 804-805, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0274
Andreas Waczkat: Rezension zu: Tassilo Erhardt (Hrsg.): Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770, Wien 2012, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24413.html
Regina Dauser: Rezension zu: Martin Espenhorst (Hrsg.): Unwissen und Missverständnisse im vormodernen Friedensprozess. Göttingen 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24404.html
Wilhelm Ribhegge: Rezension zu: Christoph Galle: Hodie nullus – cras maximus. Berühmtwerden und Berühmtsein im frühen 16. Jahrhundert am Beispiel des Erasmus von Rotterdam. Münster 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24340.html
Hannelore Putz: Rezension zu: Christian M. Geyer: Der Sinn für Kunst. Die Skulpturen Antonio Canovas für München (Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst 11). Berlin 2010, in: ZBLG, 08.07.2014
http://www.kbl.badw-muenchen.de/zblg-online/rezension_1893.html
Günther Kronenbitter: Rezension zu: Christine de Gemeaux: De Kant à Adam Müller (1790–1815). Éloquence, espace public et médiation. Préface de Jean-Marie Valentin. Paris 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/gemeaux_kronenbitter
Matthias Bähr: Rezension zu: John Gibney: The Shadow of a Year. The 1641 Rebellion in Irish History and Memory. Madison 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24344.html
Margrit Schulte Beerbühl: Rezension zu: Natasha Glaisyer: The Culture of Commerce in England, 1660–1720 (Royal Historical Society, Studies in History, New Series). Woodbridge/Rochester, NY 2011, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 801-803, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0272
Silvia Richter: Rezension zu: Gianluigi Goggi: De l’Encyclopédie à l’éloquence républicaine. Étude sur Diderot et autour de Diderot (Les dix-huitièmes siècles, 165). Paris 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/goggi_richter
Michael Quisinsky: Rezension zu: Marcia B. Hall / Tracy E. Cooper (ed.): The Sensuous in the Counter-Reformation Church. Cambridge 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/hall_quisinsky
Ronald G. Asch: Rezension zu: Tim Harris / Stephen Taylor: The Final Crisis of the Stuart Monarchy. Revolutions of 1688–91 in their British, Atlantic and European Contexts (Studies in Early Modern Cultural, Political and Social History, 16). Woodbridge 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/harris_asch
Katrin Keller: Rezension zu: Éric Hassler: La Cour de Vienne 1680–1740. Service de l’empereur et stratégies spatiales des élites nobiliaires dans la monarchie des Habsbourg. (Les mondes germaniques). Strasbourg 2013, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 803-804, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0273
Martin Rink: Rezension zu: David M. Hopkin: Soldier and Peasant in French Popular Culture. 1766–1870 (Royal Historical Society Studies in History New Series). Woodbridge 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/hopkin_rink
Hannes Ziegler: Rezension zu: Claudia Jarzebowski / Anne Kwaschik (Hrsg.): Performing Emotions. Interdisziplinäre Perspektiven auf das Verhältnis von Politik und Emotion in der Frühen Neuzeit und in der Moderne. Göttingen 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/jarzebowski_ziegler
Ludolf Pelizaeus: Rezension zu: Carina L. Johnson: Cultural Hierarchy in Sixteenth-Century Europe. The Ottomans and Mexicans. Cambridge 2011, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815)
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/johnson_pelizaeus
Hans−Jürgen Goertz: Rezension zu: Thomas Kaufmann: Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 67). Tübingen 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 787-790, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0265
Hans−Christof Kraus: Rezension zu: Milan Kuhli: Carl Gottlieb Svarez und das Verhältnis von Herrschaft und Recht im aufgeklärten Absolutismus (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Bd. 272). Frankfurt/M. 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 808-810, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0277
Wolfgang Bockhorst: Rezension zu: Heinrich Lackmann / Tobias Schrörs (Bearb.): Katholische Reform im Fürstbistum Münster unter Ferdinand von Bayern. Die Protokolle von Weihbischof Arresdorf und Generalvikar Hartmann über ihre Visitationen im Oberstift Münster in den Jahren 1613 bis 1616. Münster 2012, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24338.html
Andreas Sohn: Rezension zu: Jean Leclant / André Vauchez / Daniel Odon-Hurel (éd.): Dom Jean Mabillon, figure majeure de l’Europe des lettres. Actes des deux colloques du tricentenaire de la mort de dom Mabillon, abbeye de Solesmes, 18–19 mai 2007, palais de l’Institut, Paris, 7–8 décembre 2007. Paris 2010, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/leclant_sohn
Jochen Hoock: Rezension zu: Virginie Lemmonier-Lesage / Marie Roig Miranda (dir.): Réalités et représentations de la justice dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles (Université de Lorraine – Groupe Europe aux XVIe et XVIIe siècles). Nancy 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/lemmonier-lesage_hoock
Bettina Severin-Barboutie: Rezension zu: Thierry Lentz: Napoléon diplomate. Paris 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/lentz_severin-barboutie
Pauline Pujo: Rezension zu: Martin Mulsow / Guido Naschert (Hrsg.): Radikale Spätaufklärung in Deutschland. Einzelschicksale, Konstellationen, Netzwerke (Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte, 24. Jg. 2012). Hamburg 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/mulsow_pujo
Harald Bollbuck: Rezension zu: Günter Mühlpfordt / Ulman Weiß (Hrsg.): Kryptoradikalität in der Frühneuzeit (Friedenstein-Forschungen, Bd. 5). Stuttgart 2009, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 793-795, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0268
Franz Leander Fillafer: Rezension zu: Christian Neschwara (Hrsg.): Die ältesten Quellen zur Kodifikationsgeschichte des österreichischen ABGB. Josef Azzoni, Vorentwurf zum Codex Theresianus – Josef Ferdinand Holger: Anmerckungen über das österreichische Recht (1753). Wien 2012, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/25070.html
Manju Ludwig: Rezension zu: Carmen Nocentelli: Empires of Love. Europe, Asia, and the Making of Early Modern Identity. Philadelphia 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/nocentelli_ludwig
Friedrich Edelmayer: Rezension zu: Jean Nouzille: Le Prince Eugène de Savoie et le sud-est européen (1683–1736). Texte remis en forme par Simone Herry et Daniel Tollet. Avant-propos de Jean Bérenger (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale, 6). Paris 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 805-807, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0275
Andrew McKenzie-McHarg: Rezension zu: Claus Oberhauser: Die verschwörungstheoretische Trias. Barruel – Robison – Starck. Innsbruck 2013, in: H-Soz-u-Kult, 08.07.2014,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014-3-022
Arne Karsten: Rezension zu: John W. O’Malley: Trent. What Happened at the Council? Cambridge, Mass./London 2013, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 795-796, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0269
Georg Eckert: Rezension zu: Anthony Pagden: The Enlightenment. And Why it Still Matters. Oxford 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/pagden_eckert
Johan Lange: Rezension zu: Simon Palaoro, Städtischer Republikanismus, Gemeinwohl und Bürgertugend. Politik und Verfassungsdenken des Ulmer Bürgertums in Umbruchzeiten (1786–1825) (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 33). Stuttgart 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/palaoro_lange
Christoph Streb: Rezension zu: Lindsay A. H. Parker: Writing the Revolution. A French Woman’s History in Letters. Oxford 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/parker_streb
Christian Rohr: Rezension zu: Thomas Poggel: Schreibkalender und Festkultur in der Frühen Neuzeit. Kultivierung und Wahrnehmung von Zeit am Beispiel des Kaspar von Fürstenberg (1545-1618). Jena 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24329.html
Sandra Hertel: Rezension zu: Dries Raeymakers: One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albert and Isabella, 1598–1621. Louvain 2013, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/raeymakers_hertel
Beat Kümin: Rezension zu: Ronald K. Rittgers: The Reformation of Suffering. Pastoral Theology and Lay Piety in Late Medieval and Early Modern Germany (Oxford Studies in Historical Theology). Oxford/New York/Auckland 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 785-787, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0264
Matthias Roick: Rezension zu: Stefano Saracino / Manuel Knoll (Hgg.): Das Staatsdenken der Renaissance – Vom gedachten zum erlebten Staat. Baden-Baden 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 7/8, 15.07.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/07/24416.html
Jonas Flöter: Rezension zu: Theresa Schmotz: Die Leipziger Professorenfamilien im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Studie über Herkunft, Vernetzung und Alltagsleben (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte, Bd. 35). Stuttgart/Leipzig 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 799-801, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0271
Wolfgang Weber: Rezension zu: Flemming Schock (Hrsg.): Polyhistorismus und Buntschriftstellerei. Populäre Wissensformen und Wissenskultur in der Frühen Neuzeit (Frühe Neuzeit, 169). Berlin/Boston 2012, in: Francia-Recensio 2014/2 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 16.07.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-2/FN/schock_weber
Alexander Jendorff: Rezension zu: Tom Scott: The Early Reformation in Germany. Between Secular Impact and Radical Vision. Surrey/Burlington 2013, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 790-792, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0266
Susanne Rau: Rezension zu: Johann Anselm Steiger / Sandra Richter (Hrsg.): Hamburg. Eine Metropolregion zwischen Früher Neuzeit und Aufklärung (Metropolis. Texte und Studien zu Zentren der Kultur in der europäischen Neuzeit). Berlin 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 796-799, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0270
Axel Körner: Rezension zu: Mélanie Traversier: Gouverner l’Opéra. Une histoire politique de la musique à Naples, 1767–1815. Rome 2009, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 810-813, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0278
Detlev Kraack: Rezension zu: Carl Christian Wahrmann: Kommunikation der Pest. Seestädte des Ostseeraums und die Bedrohung durch die Seuche 1708–1713 (Historische Forschungen, Bd. 98). Berlin 2012, in: Historische Zeitschrift, 298.3 (2014): 807-808, 18.07.2014
doi:10.1515/hzhz-2014-0276
Quelle: http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1791
 Es gibt sie also: die Zukunft. Trotz Klimawandel und Ressourcenmangel. Und obwohl die Menschheit nicht nur wächst, sondern immer mehr Menschen so leben wollen wie wir im Westen. Fleisch essen, auf der Autobahn rasen, Elektroschrott nach Afrika exportieren. Armin Reller, Professor für Ressourcenstrategie in Augsburg, und taz-Journalistin Heike Holdinghausen glauben trotzdem an uns. An unsere Lernfähigkeit, an die Macht des Wissens. Reller und Holdinghausen wollen den Glauben an den Fortschritt nicht aufgeben: „Wo kämen wir ohne ihn hin?“ (S. 16). Ihre Idee: An „resilienten Technologien oder Verhaltensweisen“ arbeitet es sich leichter, wenn man die „Geschenke des Planeten“ besser kennt (S. 8, 17). Reller und Holdinghausen erzählen deshalb die Geschichten von Stoffen. Welche Rolle hat das Öl in der Geschichte der Menschheit gespielt? Wie steht es um Raps und Lein, Weizen und Holz? Was ist mit Kohlendioxid, Algen und Bakterien, was mit Eisen, Gallium und Abfall?
Es gibt sie also: die Zukunft. Trotz Klimawandel und Ressourcenmangel. Und obwohl die Menschheit nicht nur wächst, sondern immer mehr Menschen so leben wollen wie wir im Westen. Fleisch essen, auf der Autobahn rasen, Elektroschrott nach Afrika exportieren. Armin Reller, Professor für Ressourcenstrategie in Augsburg, und taz-Journalistin Heike Holdinghausen glauben trotzdem an uns. An unsere Lernfähigkeit, an die Macht des Wissens. Reller und Holdinghausen wollen den Glauben an den Fortschritt nicht aufgeben: „Wo kämen wir ohne ihn hin?“ (S. 16). Ihre Idee: An „resilienten Technologien oder Verhaltensweisen“ arbeitet es sich leichter, wenn man die „Geschenke des Planeten“ besser kennt (S. 8, 17). Reller und Holdinghausen erzählen deshalb die Geschichten von Stoffen. Welche Rolle hat das Öl in der Geschichte der Menschheit gespielt? Wie steht es um Raps und Lein, Weizen und Holz? Was ist mit Kohlendioxid, Algen und Bakterien, was mit Eisen, Gallium und Abfall?