
Dass die einfache und fachfremde Idee “Warum digitalisieren wir nicht alles und werfen den Rest weg?” nicht umsetzbar ist, ist inzwischen jedem klar, der in einem Archiv arbeitet.( Oder sollte es zumindest sein) Aber warum gibt es keine zentralen Digitalisierungsstrategien des Bundes wie z.B. in den Niederlanden? Warum dies in Deutschland anders ist und was in Deutschland auf dem Bereich Digitalisierung überhaupt geschieht ist das Thema des Beitrags von Marcus Stumpf. Der Beitrag beruht aus einem Vortrag beim Deutsch-Niederländischen Archivkolloquium 2013 und ist in der aktuellen Archivpflege 80/2014 abgedruckt.
Digitalisierungsstrategien in Deutschland – Versuch einer Bestandsaufnahme
von Marcus Stumpf
Um es vorweg zu nehmen: Eine nationale Digitalisierungsstrategie gibt es in Deutschland nicht und wird es wohl auch zukünftig aufgrund der föderalistischen Struktur der Bundesrepublik und der Kulturhoheit der Länder kaum geben. Und selbst wenn man regionale und institutionsbezogene Digitalisierungsstrategien in die Betrachtung mit einbezieht, was im Folgenden geschehen soll, fällt die Bestandsaufnahme relativ ernüchternd aus. Die Strategiediskussion ist offenkundig in Deutschland noch nicht so weit vorangeschritten, dass sich daraus ein reicher Fundus an Beispielen ergeben würde.
Bevor nun Ansätze der Strategiediskussion diskutiert werden, soll der internationale und nationale Rahmen kurz in den Blick genommen werden, ohne den die in Deutschland gerade einsetzende Diskussion nicht zu verstehen ist.
Vor einigen Jahren hat die Smithsonian Institution in den USA, die größte Forschungs- und Bildungseinrichtung der Welt, in der allein 18 Museen zusammengefasst sind, unter dem Titel „Inspiring Generations through Knowledge and Discovery – a Smithsonian for the 21st century eine neue Strategie veröffentlicht. Ihre Vision lautet „Sharing our resources with the world“ und daher wird unter den strategischen Zielen auch die Ausweitung des Zugangs (broadening access) durch die Digitalisierung als ein ganz wesentliches Ziel benannt: „Digitizing the collections and making them accessible online are major Institutional priorities“.[1] Zu dieser solchermaßen explizit formulierten Priorität hat das Smithsonian kürzlich ein eigenes Strategiepapier vorgelegt. In diesem beschreibt der Direktor der Smithsonian Institution, G. Wayne Clough, die Ausgangslage: „Today’s digital revolution is providing a dizzying array of tools that offer opportunities for learning institutions all over the world to become more vibrant and accessible. This revolution provides the means to share vital information, enabling people to learn more, shape informed opinions, and make decisions in their daily lives. Suddenly, everybody can have access to information that previously was only available to the experts.” […]
„We at museums, libraries, and archives must ask: How can we prepare ourselves to reach the generation of digital natives who bring a huge appetite — and aptitude for the digital world?”[2]
Bemerkenswert ist – gerade vor dem Hintergrund der archivarischen Diskussion in Deutschland zur Digitalisierung – der große Enthusiasmus von Clough in Bezug auf die erwarteten Effekte einer Ausweitung des Onlinezugangs zu den Museums- und Sammlungsbeständen des Smithsonian. Als Selbstverpflichtung postuliert wird eine Demokratisierung des Zugangs zu den Beständen: „We can help all the people, not just a few of the people, to understand our culture, the cultures of other countries, and life in all its dimensions.”[3] Nicht mehr nur Experten können nun die Bestände nutzen, sondern jedermann; niemand muss mehr zwingend an die Orte reisen, an denen Kulturgut aufbewahrt wird, sondern kann aus der Ferne recherchieren, rezipieren und forschen. Clough sieht sich ferner in der Pflicht, den Rezeptionsgewohnheiten und -erwartungen der ‚Digital natives‘ entgegen zu kommen. Da diese die Angebote des Web 1.0 und des Web 2.0 anders, intensiver und intuitiver nutzen werden als Menschen, die vor der digitalen Revolution zur Welt gekommen sind, müssten auch die digitalen Angebote ausgeweitet und intuitiver nutzbar gemacht werden.[4]

Abb1. Best of Both Worlds: Museums, Libraries, and Archives in a Digit
Die Fotomontage aus dem Strategiepapier des Smithsonian veranschaulicht den vielfach zu beobachtenden Wandel der Rezeptionsgewohnheiten im digitalen Zeitalter; – einen Wandel, der für Archive und andere Kulturgut bewahrende Institutionen Konsequenzen nach sich zieht: Klassische Aneignungstechniken wie das geduldige Betrachten, das Speichern im Gedächtnis und das Exzerpieren werden zunehmend ersetzt durch das schnelle Fotografieren oder Kopieren. Man sichert sich Bilder und Texte quasi im Vorbeigehen, um sie jederzeit wieder aufrufen, betrachten und irgendwann später in Ruhe studieren zu können. Aufgrund dieses grundlegenden Wandels ziehen es Archivbenutzerinnen und -benutzer immer öfter vor, Archivgut digital zu benutzen. Eine wachsende Benutzergruppe nutzt aus Kostengründen nur noch aus der Ferne, indem sie nach Onlinerecherche und E-Mailauskunft Scans ordert. Im Lesesaal sinkt zunehmend die Verweildauer der Nutzenden, weil diese sich zwar die Originale vorlegen lassen, aber dann ohne tiefere Befassung und Lektüre direkt zur Digitalkamera greifen oder Scans bestellen. Diese Entwicklung ist natürlich nicht neu, wird sich aber wohl weiter verstärken, je besser und umfangreicher die digitalen Angebote der Archive werden.
Europeana und Deutsche Digitale Bibliothek
Das sicherlich bekannteste Projekt in Europa, das den mutmaßlichen „Riesenhunger der Digital Natives“ auf digitalisiertes Kulturgut stillen will, ist die Europeana. Sie wurde im Jahr 2005 von den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten Frankreich, Polen, Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn angeregt, und am 20. November 2008 von Manuel Barroso und der zuständigen EU-Kommissarin Viviane Reding freigeschaltet,[5] für EU-Verhältnisse also in bemerkenswerter Geschwindigkeit realisiert.
2009 waren in der Europeana bereits fünf Mio. digitale Objekte eingestellt, im Juli 2010 zehn Mio. und pünktlich zum fünften Geburtstag des Portals standen Ende November 2013 rd. 30 Mio. Digitalisate online.[6] Die Europeana wächst also kontinuierlich, um ihrem selbst gesetzten Anspruch gerecht zu werden, „to be a catalyst for change in the world of cultural heritage [and] to create new ways for people to engage with their cultural history, whether it’s for work, learning or pleasure”. [7] Diese Zielsetzung kommt derjenigen nahe, die der Direktor der Smithsonian Institution für seine Museen gesetzt hat.
Deutschland ist mit zurzeit 4,4 Mio. digitalen Objekten der größte Datenlieferant der Europeana, der Anteil an den 30 Mio. Einzelobjekten beträgt damit knapp 15%. Glaubt man der jüngsten veröffentlichten Nutzerstatistik der Europeana,[8] kommen außerdem die meisten Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland: 712.000 Zugriffe auf die Webseiten der Europeana, im Vergleich etwa zu 615.000 aus Frankreich, 322.000 aus den Niederlanden oder 290.000 aus Spanien.[9]
In Gestalt der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) liegt nun auch eine nationale Plattform vor, die sich als Hauptaggregator für die Europeana etablieren soll. Träger der DDB ist das sogen. Kompetenznetzwerk, das aus von Bund, Ländern und Kommunen getragenen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen besteht.[10] Noch befindet sich die DDB im Beta-Betrieb und es ist daher alles andere als einfach, sich einen Gesamtüberblick über vorhandene digitale Bestände in deutschen Archiven, Bibliotheken, Museen und anderen Wissenschaftseinrichtungen zu verschaffen. Will man dies tun, kann man hilfsweise über die Webseite http://www.kulturerbe-digital.de recherchieren, auf der zahllose Projekte gelistet, kurz beschrieben und verlinkt sind.[11]

Abb. 2: Kulturerbe digital
Man sieht also, dass die virtuelle Infrastruktur in Deutschland im Entstehen ist und die bestehenden Angebote – neben der DDB und der Europeana auch etablierte spartenübergreifende Portale wie das BAM-Portal[12] und die regionalen Archivportale[13] – auch genutzt werden. Auch über die genannten Portale hinaus ist die Portalsituation sehr bunt. Allein die Bibliotheken haben neben ihren Verbundkatalogen sehr gut etablierte Angebote wie etwa das „Zentrale Verzeichnis digitalisierter Drucke“ (ZVDD) zur Recherche und Ansicht der Digitalisate aus den großen Projekten zur Digitalisierung der Drucke des 16., 17. und 18. Jh. (VD16, VD17 und VD18),[14] „Kalliope“ für Nachlässe und Autographen,[15] und für mittelalterliche Handschriften die – in Bibliothekskreisen allerdings nicht unumstrittene und technologisch überarbeitungsbedürftige – Plattform „Manuscripta Mediaevalia“.[16]
Ob die DDB also einmal das digitalisierte Kulturgut (Metadaten und Content) aus Deutschland vollständig aggregieren wird, bleibt abzuwarten.
Mindestens genauso wichtig wie die Plattformen selbst ist indes die Frage, welches Kulturgut digitalisiert werden soll, denn dass das Archiv-, Bibliotheks-, Museums- und Sammlungsgut jemals vollständig online sein wird, darf mit Fug bezweifelt werden. Die Kulturgut verwahrenden Einrichtungen müssen zwangsläufig Prioritäten setzen.
Hier fehlt es – anders als in anderen Ländern[17] – noch an übergreifenden Strategien, die nicht nur den Ist-Zustand beschreiben (wer hat bereits was mit welchen Mitteln digitalisiert), sondern definieren, welche langfristige Entwicklung angestrebt wird und welche Prioritäten bei der Digitalisierung gesetzt werden sollen.
Strategien und Strategieansätze in Deutschland
Im März 2011 legte der Deutsche Bibliotheksverband ein Thesenpapier zur Digitalisierung vor. Unter dem Titel „Deutschland braucht eine nationale Digitalisierungsstrategie!“ werden der Auf- und Ausbau der Deutschen Digitalen Bibliothek und „verstärkte Anstrengungen für die Digitalisierung“ gefordert, der zusätzliche Finanzbedarf der Bibliotheken für die Jahre 2012–2016 wird auf 10 Mio. Euro jährlich beziffert.[18]
Mit diesem Papier gelangte das Thema zumindest vorübergehend auf die bundespolitische Agenda. Im Deutschen Bundestag wurde am 26. Januar 2012 von der schwarz-gelben Parlamentsmehrheit der Antrag verabschiedet, die Regierung solle eine „Digitalisierungsoffensive für unser kulturelles Erbe“ beginnen. „Die Verstärkung der Digitalisierungsanstrengungen [sei] auch unter dem Gesichtspunkt der internationalen Außenrepräsentation wichtig [...]“. Die DDB solle „zu einem Schaufenster für die Kultur- und Wissenschaftsnation Deutschland werden“.[19] Geschehen ist im Sinne einer ausformulierten Digitalisierungsstrategie auf Bundesebene seither freilich nicht viel, zumal auch danach kein Beschluss zu einer verstärkten finanziellen Förderung der Digitalisierung ergangen ist. Die Anträge der Oppositionsparteien waren hier zum Teil sehr viel konkreter; so forderte die Linke die Bereitstellung von 30 Mio. Euro jährlich zusätzlich allein durch den Bund.[20] Im Antrag der SPD-Fraktion fehlen Angaben zum konkreten Finanzbedarf. Von der Bundesregierung wird allerdings gefordert, „eine Übersicht über den Stand der Digitalisierung in Deutschland in Abstimmung mit den Ländern vorzulegen“,[21] bislang ohne Erfolg.
Eine gesamtstaatliche Strategie zur Digitalisierung von Kulturgut aller Sparten fehlt, und damit bleibt auch ein planvolles, von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam getragenes Handeln ein Desiderat, obwohl der Bedarf zuletzt auch in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020 ausdrücklich betont wurde. Mit Bezug auf die Digitalisierung heißt es dort, dass auch bei dieser Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe das Schmieden von Allianzen von besonderer Bedeutung sei: „Würden Möglichkeiten der Koordination und Kooperation zwischen Einrichtungen der Informationsinfrastruktur sowie zwischen und innerhalb bestehender Zusammenschlüsse besser genutzt, könnten das vorhandene Potential besser ausgeschöpft und der Prozess der digitalen Transformation beschleunigt werden“.[22]
Nicht viel besser sieht es auf Länderebene aus: Lediglich das Land Brandenburg verfügt über ein ausformuliertes und öffentlich zugängliches Strategiepapier, das im Jahr 2009 im Auftrag des brandenburgischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur erstellt wurde und an dem Archive, Bibliotheken, Museen und Hochschulen mitgewirkt haben.[23] Das Papier gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand der Digitalisierung in den Kultureinrichtungen Brandenburgs, es werden die in den einzelnen Einrichtungen vorhandenen Digitalisierungsressourcen beschrieben, vor allem aber findet sich der Handlungsbedarf konkretisiert, der für eine verstärkte Online-Bereitstellung von Erschließungsdaten und Content im Rahmen der DDB als erforderlich angesehen wird. Kernpunkt der Handlungsempfehlungen ist die Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums „Brandenburg.digital“, in dem nicht etwa das operative Digitalisierungsgeschäft zentralisiert werden soll (im Sinne eines Digitalisierungszentrums), sondern vor allem Koordinierungs-, Standardisierungs- und Beratungsleistungen erbracht werden sollen.[24]
Das Kompetenzzentrum ist Ende 2012 am Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam eingerichtet worden.[25] Ferner haben die Bemühungen dazu geführt, dass die brandenburgische Landesregierung die Digitalisierung als wichtige kulturpolitische Aufgabe formuliert hat: In der „Kulturpolitischen Strategie 2012“ der Landesregierung heißt es: „Die Digitalisierung eröffnet die Chance, in großem Umfang neue Nutzerkreise für kulturelle Werte und Vorhaben zu gewinnen.“[26] Ferner wird zum Ziel erklärt, die Infrastruktur zur Digitalisierung auszubauen.[27] Auch wenn keine konkreten Finanzierungszusagen gegeben werden, so ist doch offensichtlich mit dem Strategiepapier erfolgreiche Lobbyarbeit geleistet und mit der Einrichtung der Koordinierungsstelle ‚Brandenburg-digital‘ ein wichtiger Schritt getan worden.[28]
In dem Brandenburgischen Strategiepapier zur Digitalisierung wird im Übrigen offengelegt, dass der Nachholbedarf erheblich und die Ressourcen ausbaufähig sind. Zugespitzt formuliert: Brandenburg hat eine Gesamtstrategie, aber es fehlen die Kapazitäten, andere Bundesländer haben hingegen mehr Kapazitäten, aber (noch) keine Strategie.
Auf institutioneller Ebene ist die Digitalisierungsstrategie der Stiftung Preußischer Kulturbesitz von 2010 erwähnenswert.[29] Nach einleitenden programmatischen Ausführungen zur Wichtigkeit der Digitalisierung werden
Prioritäten benannt. Danach soll die Stiftung prioritär digitalisieren,
„wo sie Kulturerbe von nationaler und internationaler Bedeutung öffentlich zugänglich machen kann,
- wo die Digitalisierung der Vermittlung deutscher, europäischer und außereuropäischer Kulturen, dem internationalen Kulturaustausch oder allgemeinen Bildungsaufgaben dient,
- wo die Sammlungen herausragend oder einmalig sind,
- wo der Bedarf von Forschung und Wissenschaft groß ist,
- wo die Einrichtungen der SPK besondere Verantwortung übernehmen,
- wo die Digitalisierung den Ausstellungs- und Forschungsvorhaben der Einrichtungen der SPK dient,
- wo sie die Präsentation von Inhalten der anderen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ergänzen oder die Vernetzung von Inhalten unterstützen kann,
- wo das Digitalisat dem Schutz eines gefährdeten Originals oder dem Erhalt von Inhalten dient, oder
- wo wirtschaftliches Interesse besteht (Tourismus, Verlage) und sie durch bpk – Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte für die kommerzielle Nutzung vermarktet werden können.“[30]
Diese Kriterien stecken ohne Zweifel einen sinnvollen Rahmen ab, doch muss man bei näherem Hinsehen konstatieren, dass sie für die Kulturgut verwahrenden Institutionen der Stiftung kaum operationalisierbar sind. Denn es wird wenig Kulturgut in den musealen Sammlungen, Bibliotheken und Archiven geben, auf das nicht wenigstens eines der genannten Priorisierungskriterien zutrifft.
Rolle der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Bevor die Strategiediskussion der deutschen Archive im engeren Sinne vorgestellt werden soll, ist die Rolle der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Bereich der Erschließung und Digitalisierung hervorzuheben. Nicht nur dass zwischen 2002 und 2012 allein rd. 100 Mio. Euro für Erschließung und Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut sowie die Entwicklung von entsprechenden Werkzeugen, Infrastrukturen und Informationssystemen der Bibliotheken und Archive aufgewendet wurden,[31] die DFG-Gremien üben über ihre konzeptionelle, steuernde und gutachterliche Tätigkeit hinaus einen großen Einfluss auf die Standard- und Strategiebildung im Bereich der Digitalisierung aus und wirkt damit auf die deutschen Archive, Bibliotheken und Museen zurück. Es wundert nicht, dass der Wissenschaftsrat die Arbeit der DFG, also auch den Förderbereich Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS), würdigt und weiter stärken will.[32]
Erwähnt seien an dieser Stelle vor allem die DFG-Praxisregeln zur Digitalisierung, deren Standards zur Digitalisierung, vom Scannen über die Generierung von Metadaten zur Bereitstellung in Portalen, auch international hohes Ansehen genießen.[33] Weithin etabliert ist auch der DFG-Viewer, der als Open Source frei nachnutzbar Mindeststandards für die digitale Präsentation historischer Quellen in Deutschland setzt und fortlaufend in Zusammenarbeit mit der Fachcommunity weiterentwickelt wird. In Form von Positionspapieren, die in gemeinsamer Arbeit von Informationsinfrastrukturexpertinnen und -experten, Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern entstehen, wird zudem in regelmäßigen Abständen die Förderpolitik mit ihren Schwerpunkten transparent gemacht.[34]
Strategiediskussion der Archive
Wayne Clough, der eingangs erwähnte Direktor der Smithsonian Institution rühmt in seinem Strategiepapier gerade die Archive und Bibliotheken als ‚early adopters’ der Digitaltechnik.[35] Mit ihrer Ethik des Open Access hätten sie die Digitalisierung und das „Social Networking“ früh angenommen. Trifft dieses Lob aber auch auf die deutschen Archive zu?
Dass die (Wissenschaftlichen) Bibliotheken früh auf die digitale Technologie gesetzt haben und den „open access“ befürworten, ist bekannt: Schon in den späten 1980er Jahren wurde mit der Retrokonversion und Onlinestellung der Bestandskataloge begonnen, lange schon werden die benutzungsrelevanten Arbeitsabläufe elektronisch unterstützt und mit erheblichen Anstrengungen wichtige Bestände insbesondere der älteren Zeit digitalisiert. Für die Archive wird man konstatieren müssen, dass sie dem Weg der Bibliotheken inzwischen zwar folgen, aber doch mit einer Zeitverzögerung von beinahe einer Dekade. Der Open-Access-Gedanke wird inzwischen intensiv diskutiert, ist aber noch lange nicht voll in den Archiven etabliert, stößt natürlich auch durch die Archivgesetze auf vorgegebene Grenzen.
Indessen ist m.E. nicht von der Hand zu weisen, dass im Mittelpunkt der Fachdiskussion lange eher die Risiken der Digitalisierung als deren Chancen standen. Erst allmählich scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Archive gerade auch auf diesem Feld in einer Konkurrenzsituation mit anderen Informationsinfrastruktur- und Wissensspeichereinrichtungen stehen.
Auf den ersten Blick sieht es mit der Präsenz der deutschen Archive in der Europeana nicht schlecht aus: Hinter den größten deutschen Lieferanten, der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek und der Bayerische Staatsbibliothek folgt recht bald ein archivischer Vertreter – nämlich das Landesarchiv Baden-Württemberg.: Dabei fällt auf, dass die deutschen Content-Lieferanten ihre Daten und digitalen Objekte meist direkt an die Europeana liefern, einige auch über das „Gemeinsame Portal zu Archiven, Bibliotheken und Museen“, kurz: BAM-Portal genannt.[36] Noch ist die DDB für Archive nicht der zentrale Aggregator für die Europeana.[37]
Archivportale
Die regionale archivische Portallandschaft ist uneinheitlich: In elf Bundesländern existieren regionale Archivportale, die zumindest zum Teil als Aggregatoren für das entstehende Archivportal-D und die DDB in Betracht kommen,[38] es gibt daneben aber auch Spartenportale etwa für die deutschen Wirtschaftsarchive[39] und die Kirchenarchive.[40] Über die meisten dieser Portale können Informationen zu den einzelnen Archiven, die Beständeübersichten und teilweise noch Onlinefindbücher recherchiert werden, nur die wenigsten haben jedoch bereits den weiteren Ausbauschritt hin zur Ebene digitalisierter Bestände vollzogen, namentlich die Archivportale in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.[41]
Immerhin gibt es für die Schaffung eines deutschen Archivportals neben und zugleich als Bestandteil der Deutschen Digitalen Bibliothek nach jahrelangen Diskussionen in der Community ein klares Commitment auf der Ebene der kommunalarchivischen und staatsarchivischen Spitzengremien, der Archivreferentenkonferenz des Bundes und der Länder und der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag, das auch vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) unterstützt wird.[42] Das von der DFG geförderte Archivportal-D wird zurzeit als für die Archive konzipierte Präsentationssicht („View“) der Deutschen Digitalen Bibliothek entwickelt und soll auch das Archivportal Europa bedienen.[43] Viele Archive haben im Übrigen schon die Chance genutzt, sich in der von der DDB angebotenen „Wissenschaftslandkarte“ eintragen zu lassen.[44]

Abb. 3: Archive in der Wissenschaftslandkarte der DDB
Warum beanspruchen die Archive eine spezifische Präsentationssicht innerhalb der DDB? Aus archivfachlicher Sicht und aufgrund der provenienzorientierten Erschließungstradition in Deutschland besteht weitgehend Konsens darüber, dass eine kontextlose Präsentation archivischer Erschließungsinformationen und Einzeldigitalisate nicht sinnvoll ist. Ohne Verknüpfung der Digitalisate mit den Erschließungsinformationen (Klassifikation und Titelaufnahme) im Onlinefindbuch und ohne gleichzeitige Sicht auf die Archivtektonik steht das einzelne Digitalisat isoliert da.[45] In Bezug auf einen angemessenen Auftritt der deutschen Archive auf dem europäischen Parkett wird insofern mit dem Archivportal-D ein wichtiger Schritt verwirklicht.
Retrokonversion von Findbüchern
In den wenigen vorhandenen Strategiepapieren deutscher Archive – zu nennen sind das ARK-Positionspapier „Digitalisierung von Archivgut im Kontext der Bestandserhaltung“ und die Strategiepapiere des Landesarchivs Baden-Württemberg und des Bundesarchivs – findet sich die eindeutige Prioritätensetzung zugunsten der Onlinestellung der Findmittel als wichtigstes Onlinerechercheangebot: Im Strategiepapier des Landesarchivs Baden-Württemberg heißt es: „Ziel ist es, sämtliche Findmittel, die zu einem großen Teil noch in Papierform vorliegen, in einem überschaubaren Zeitraum im Internet oder – sofern sie noch nicht frei zugänglich sind – im Intranet zugänglich zu machen. Gleichzeitig sollen die digitalen Erschließungsinformationen standardisiert in nationalen und internationalen Internet-Portalen oder Online-Informationssystemen bereitgestellt werden.“[46] Ähnlich heißt es im Strategiepapier des Bundesarchivs von 2011: „Basis und Rahmen für die Bereitstellung von bildlichen Digitalisaten aus Schriftgutbeständen sind Online-Findmittel. Findbücher und Beständeübersicht sind die wesentlichen Hilfsmittel für die Ermittlung von relevantem Archivgut für Fragestellungen im Zuge der Benutzung und Auswertung.“[47]
Dieses strategische Ziel teilen das Landesarchiv Baden-Württemberg und das Bundesarchiv mit den meisten anderen Archiven, und durch die von 2006 bis 2013 laufende Förderlinie der DFG sind die Archive diesem Ziel schon ein Stück näher gekommen. Im Rahmen der Förderlinie wurden insgesamt 2.600 Findmittel mit knapp 4.8 Mio. Verzeichnungseinheiten retrokonvertiert und der Forschung online bereitgestellt.[48]
Contentdigitalisierung
Der nächste Schritt für die deutschen Archive ist konsequenterweise nun auch die Digitalisierung von Archivbeständen selbst. Mit diesem Ansatz im Allgemeinen, erst recht aber in der Frage der Methoden und Prioritäten befinden sich die deutschen Archive auf dem Wege zu einer einmütigen Strategie, freilich nach einigem Zögern: Während Archive in anderen Ländern längst große Digitalisierungsinitiativen gestartet hatten, blieben (und bleiben zum Teil) die deutschen Archive lange Zeit dem Mikrofilm konzeptionell und operativ treu und zwar nicht nur als Sicherungs-, sondern auch als Schutzmedium. Dennoch begannen schon Ende der 1990er Jahre im archivischen Bereich Digitalisierungsprojekte. Zu nennen ist hier die von 1996 bis 1999 von der VW-Stiftung geförderte digitale Bereitstellung der Bestände des Stadtarchivs Duderstadt,[49] aber auch die Digitalisierung von Zivilstandsregistern im Personenstandsarchiv Brühl, heute Teil der Abteilung Rheinland des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen.[50]
Vor allem aber führte seit Mitte der 1990er Jahre die damalige Landesarchivdirektion Baden-Württemberg mehrere DFG-geförderte Projekte durch, die unter anderem auf die „Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut“ und die Entwicklung von Workflows und Werkzeugen zur digitalen Bereitstellung größerer Mengen von Archivgut und von archivischen Online-Informationssystemen zielten. Hier wurden wichtige Grundlagenarbeit geleistet und wegweisende Ergebnisse erzielt, unter anderem auch das BAM-Portal entwickelt.[51]
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das viel zitierte Diktum von Hartmut Weber, der 1999 mit Bezug auf die neue digitale Welt im Archiv prognostiziert hatte, die deutschen Archive würden langfristig zwar 100% der Beständeübersichten, aber nur ca. 10% ihrer Findbücher und lediglich 1% ihrer Archivalien online anbieten.[52] Dass diese Prognose weit übertroffen wurde, liegt auf der Hand. Wohl jedes Archiv bietet heute auf seiner Homepage oder in seinem Webauftritt eine Beständeübersicht, auch sind die Archive eifrig dabei, ihre Findbücher sukzessive online zu stellen. Man wird vermuten dürfen, dass die staatlichen Archive mit der Retrokonversion ihrer Findbücher die Marke von 10% längst übertroffen haben, und auch die kommunalen Archive dürften wenigstens absehbar dorthin gelangen.[53]
Noch im 2007 publizierten Strategiepapier „Das Landesarchiv Baden-Württemberg in der digitalen Welt“ wirkt die intensiv geführte Diskussion pro und contra Mikrofilm bzw. Digitalisat im Spannungsfeld von Sicherung und Nutzung nach.[54] Darin heißt es: „Die wesentliche Maßnahme zum Schutz und zur Erhaltung des analogen Archivguts ist – neben einer sachgerechten Lagerung und konservatorischen, restauratorischen Maßnahmen – die Mikrografie und nicht die Digitalisierung. Sie hat im Archivwesen im Gegensatz zum Bibliothekswesen eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert für die Bestandserhaltung (Sicherungsverfilmung, Schutzverfilmung)“.[55] Die Digitalisierung hat gleichwohl im Strategiepapier ihren Platz erobert, denn das Landesarchiv verbindet – wo möglich – „die klassische Mikrografie und die Digitalisierung synergetisch miteinander“.[56] In der Regel wird erst mikroverfilmt, von den Mikrofilmen werden aber nicht mehr, wie zuvor praktiziert, Nutzungsfilme bzw. -fiches hergestellt, sondern Digitalisate erzeugt und im Lesesaal oder gleich online bereit gestellt. Die ergonomischen Vorteile der Nutzung von Digitalisaten über Viewer liegen gegenüber der Arbeit am Mikrofilmscanner auf der Hand.
Die baden-württembergische Strategie, den Mikrofilm als Sicherungsmedium mit dem davon abgeleiteten Digitalisat als Nutzungsmedium zu verbinden, entspricht auch der langjährigen Praxis des Bundesarchivs; auch hier gibt es eine langjährige Tradition der Sicherungs- und Schutzverfilmung und auch hier setzt man konsequent weiterhin auf den Mikrofilm als primäre Quelle für digitale Nutzungsformen.[57]
Andere Archivverwaltungen wie etwa das Landesarchiv NRW, wo über die bundesfinanzierte Sicherungsverfilmung hinaus keine eigene Schutzverfilmung etabliert war, digitalisieren zwar ebenfalls vorhandene Mikrofilme, haben daneben aber in größerem Umfang zusätzlich Kapazitäten für die direkte Digitalisierung von Archivgut aufgebaut.
Digitalisiert wird inzwischen von den Landesarchiven, den Kommunalarchiven[58] und natürlich auch von den Archiven der anderen Sparten. Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen digitalisiert in seinem 2005 in Betrieb genommenen Digitalisierungszentrum planmäßig ganze Archivbestände.[59] Einerseits werden hierfür die reichen Bestände an Sicherungsfilmen aus der Bundessicherungsverfilmung genutzt, ein ebenso großes Gewicht liegt aber auch auf der direkten Digitalisierung. Immerhin liegen inzwischen im Landesarchiv NRW bereits 10 Mio. Digitalisate vor, das sind rd. 0,8 % der Bestände insgesamt. Primäres Ziel dabei war allerdings zunächst die Ablösung des Mikrofilms als Schutzmedium durch das Digitalisat, d.h. die digitalisierten Archivbestände wurden zunächst nur in den Lesesälen zur Nutzung bereitgestellt. Begonnen wurde inzwischen aber auch damit, digitalisierte Bestände im Internet zugänglich zu machen, soweit keine archivrechtlichen Gründe dagegen sprechen.
Tempo aufgenommen hat die Digitalisierung von Archivgut durch das vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und dem LWL-Archivamt 2011 initiierte DFG- Pilotprojekt zur Digitalisierung archivalischer Quellen,[60] an dem sich neben den genannten das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Archive, das Stadtarchiv Mannheim und das Sächsische Staatsarchiv mit Pilotprojekten beteiligen. In den Pilotprojekten werden seit Anfang 2013 Standards und Workflows zur Digitalisierung und Onlinestellung verschiedener Archivalientypen von mittelalterlichen Urkunden bis zu modernen Massenakten entwickelt und erprobt. Mit den erarbeiteten methodischen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen soll dann eine Road Map für eine breite Digitalisierungskampagne in deutschen Archiven erstellt werden.
Priorisierung
Das wichtigste und zugleich schwierigste konzeptionelle Thema stellt letztlich die Priorisierung von Archivgut dar. Denn im Unterschied zu den Bibliotheken, die sich für die ältere Zeit vergleichsweise einfach Zeitschnitte setzen konnten, indem man sich die vollständige Digitalisierung der deutschen Drucke der Frühen Neuzeit zum Ziel setzte (VD 16 / VD 17 / VD 18), ist die Entwicklung ausgefeilter Kriterien der Priorisierung von Archivgut deutlich schwieriger.
Allein in den deutschen kommunalen Archiven liegen nach einer in den letzten Jahren durchgeführten BKK-Erhebung rd. 1.620 Kilometer Archivgut, in den staatlichen sind es 1.275 Kilometer.[61] An eine Totaldigitalisierung dieser Massen ist nicht zu denken. Im Landesarchiv Baden-Württemberg hat man 2011 Archivgut zur Digitalisierung priorisiert und 7,34 Prozent der Bestände des Landesarchiv als vorrangig zu digitalisieren identifiziert. Doch allein diese 7,34% zu digitalisieren, würde – so Robert Kretzschmar jüngst im Archivar – rd. 88 Millionen Euro kosten.
Mario Glauert hat in einem lesenswerten Beitrag ähnlich einschüchternde Hochrechnungen vorgelegt und insbesondere nachgewiesen, dass die jährlichen Zugänge in den staatlichen Archiven größer sind als das, was jährlich von den Archiven verfilmt und digitalisiert werden kann, egal ob vom Original oder vom Mikrofilm.[62] Eine Totaldigitalisierung erscheint daher schlechterdings unmöglich, da die Schere trotz aller praktischen Digitalisierungsanstrengungen immer weiter auseinandergeht.
Gleichwohl erscheint mir die daraus entwickelte Schlussfolgerung riskant, dass die Archive von vornherein auf jede planmäßige Digitalisierung ganzer Bestände verzichten und stattdessen allein auf die Digitalisierung „on demand“ setzen sollten. Die Archive stehen, ob sie es wollen oder nicht, in Konkurrenz mit anderen Informationseinrichtungen. Ein Verzicht der Archive auf planmäßige Digitalisierungen würde nichts anderes bedeuten als der Verzicht auf jegliche Drittmittelförderung. Denn die DFG und andere Fördereinrichtungen fördern nur Projekte, die ein konkretes messbares Ziel haben. Ich bin daher der festen Überzeugung, dass die Archive im Strom mitschwimmen müssen, um ihr Angebot und ihre Dienstleistungen gegenüber den Angeboten und Dienstleistungen anderer Informationseinrichtungen sichtbar zu halten. Die Unikalität der Bestände schützt diese nicht vor dem Vergessenwerden: Je schwerer sie aufzufinden sind, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie genutzt werden. Ihr möglicherweise unübertreffliche Wert für historische und andere Fragenstellungen muss wahrnehmbar, auffindbar, recherchierbar und nutzbar sein und bleiben.
Überzeugende Priorisierungskriterien zu entwickeln, ist eine der dringlichsten Aufgaben im Rahmen des DFG-Pilotprojekts zur Digitalisierung archivalischer Quellen. Ansätze dazu sind da: Verwiesen sei auf das bereits erwähnte Strategiepapier des Landesarchivs Baden-Württemberg, in dem eine solche Priorisierung als wichtige und permanente Aufgabe angesprochen wird. Maßgebliche Kriterien könnten bei der Auswahl von Archivgut zur Digitalisierung dessen visuelle Attraktivität oder die Nutzungsfrequenz sein. Ferner könne Archivgut prioritär digitalisiert werden, das aufgrund seines Inhalts nicht oder nur unzureichend archivisch erschlossen werden kann. [63] Anregung kann auch hier der Blick in die internationale Diskussion bieten. Seamus Ross hat bereits Ende der 1990er Jahre dargelegt, dass Kulturgut verwahrende Institutionen eine eigene Strategie entwickeln müssen, zu der als wesentlicher Baustein die Priorisierung gehört. Ihm zufolge ist eine Priorisierung zumindest für größere Institutionen absolut zwingend.[64] Digitalisierungswürdige ‚Kronjuwelbestände‘ fallen sofort ins Auge, für alle anderen Bestände seien folgende Aspekte zu bedenken: ihr jeweiliger Wert im Vergleich zu den anderen Beständen, die potentielle Erleichterung des Zugangs, die tatsächliche und potentielle Nutzungshäufigkeit, die komplementäre Bedeutung im Kontext anderer bereits digitalisierter Bestände, der konservatorische Nutzen und das Potential für möglichst viele Fragestellungen.
Sicherlich aber besteht die Kunst darin, diese oder anderswo ähnlich definierte Kriterien nicht nur anzulegen, sondern auch zu operationalisieren. Inwieweit sich dies durch die Entwicklung von Entscheidungshilfen in Gestalt von Matrizen und Bepunktungsschemata objektivieren lässt oder weiterhin die Expertise und das Fingerspitzengefühl der Archivarinnen und Archivare für die Auswahl von Beständen zur Digitalisierung entscheidend bleiben wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall aber muss der Grundsatz lauten, diese Fragen an die eigenen Bestände zu stellen und, auf die Antworten gestützt, zu priorisieren, bevor man digitalisiert.
Dr. Marcus Stumpf
LWL-Archivamt für Westfalen
marcus.stumpf@lwl.org
[1] Smithsonian Strategic Plan, http://www.si.edu/Content/Pdf/About/SI_Strategic_Plan_2010-2015.pdf, S. 4 (dieser und alle folgenden Links zuletzt abgerufen am 8.2.2014).
[2] Vgl. G. Wayne Clough, Best of Both Worlds. Museums, Libraries, and Archives in a Digital Age. Washington 2013, S. 2-4 (= http://www.si.edu/content/gwc/BestofBothWorldsSmithsonian.pdf).
[4] Die folgende Abbildung leitet das Kapitel „Conclusion: Unlimited Possibilities“ ein, ebd., S. 70.
[5] Vgl. Building a Movement. Annual Report and Accounts 2012, 2013 April, S.8, und die Statistik S. 9, http://pro.europeana.eu:9580/documents/858566/858665/Annual+Report+and+Accounts+2012).
[6] So die Pressemeldung vom 25.11.2013: http://pro.europeana.eu/web/guest/news/press-releases.
[7] So die Selbstdefinition auf der Seite „About us“ von Europeana Professional, http://pro.europeana.eu/web/guest/about.
[8] Vgl. Europeana Web Traffic Report, 2012, S.6 (= http://pro.europeana.eu/documents/858566/1415274/Europeana+Web+Traffic+Report+Summary+2012).
[10] Vgl. Gemeinsame Eckpunkte von Bund, Ländern und Kommunen zur Errichtung einer Deutschen Digitalen Bibliothek als Beitrag zur „Europäischen Digitalen Bibliothek (EDB): https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/static/de/sc_documents/div/gemeinsame_eckpunkte_finale_fassung_02122009.pdf, S. 9: „Technologisch fortgeschrittene, ‚kultur- und wissenschaftsaffine’ Recherche- und Präsentationstechniken, die eine komfortable und übergreifende Suche in den Beständen und Diensten der Bibliotheken, Archive, Museen, Denkmalpflege usw. ermöglichen und mittels multidirektionaler Verlinkung einzelne Objekte und Dokumente in ihrem semantischen Kontext wahrnehmbar und zugreifbar machen, lassen die DDB zu einem hochattraktiven Angebot für Bildung,
Wissenschaft, Wirtschaft und die allgemein kulturell interessierte Öffentlichkeit werden“; vgl. auch https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/competence-network; zur archivarischen Sicht auf die DDB vgl. vor allem die einschlägigen Webseiten des Landesarchivs Baden-Württemberg, das die archivischen Belange auch in den Gremien der DDB mit vertritt: http://www.landesarchiv-bw.de/web/52723; vgl. dazu auch unten Anm. 37.
[11] Man kann dort über eine verfeinerte Suche, z. B. durch Vorauswahl von „Sparte“ oder „Projekttyp“ filtern, darunter findet such auch der Projekttyp „Von analog zu digital“: vgl. http://www.kulturerbe-digital.de/de/9.php. Eine hilfreiche, wenn auch sicher nicht vollständige Linksammlung findet sich in http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven.
[12] Vgl. http://www.bam-portal.de, wo über die Bestände von Archiven, Bibliotheken und Museen übergreifend recherchiert werden kann.
[13] Eine gute Übersicht der regionalen Archivportale findet sich im Serviceangebot der Archivschule Marburg: http://archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/archive-in-deutschland/archivportale/regionale-archivportale-im-internet.html; ausführlich dazu unten bei Anm. 38-40.
[14] Vgl. http://www.zvdd.de/startseite/.
[15] Vgl. http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/.
[16] Vgl. http://www.manuscripta-mediaevalia.de.
[17] Einige internationale Beispiele seien genannt: Australien: http://www.nla.gov.au/policy-and-planning/collection-digitisation-policy; Frankreich: Claire Sibille-de Grimoüard: The digitization of archives in France. Projects and perspectives, in: Katrin Wenzel (Hrsg.), Retrokonversion, Austauschformate und Archivgutdigitalisierung. Beiträge zum Kolloquium aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Archivschule Marburg, zugleich 14. Archivwissenschaftliches Kolloquium der Archivschule Marburg am 1. und 2. Dezember 2009, Marburg 2010, S. 275-289; Großbritannien: http://www.bl.uk/blpac/pdf/digitisation.pdf; Kanada: http://www.cdncouncilarchives.ca/digitization_en.pdf; Neuseeland: http://archives.govt.nz/sites/default/files/Digital_Preservation_Strategy.pdf; Schweden: Christina Wolf, Digitalisierung von Kulturgut in Schweden. Strategische Ansätze und Aktivitäten, in: Archivar 65 (2012), S. 387-393; USA: http://www.archives.gov/digitization/.
[18] Vgl. http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/ThesenpapierDigitalisierung_dbv_Papier.pdf.
[19] So wörtlich im verabschiedeten Antrag von CDU, CSU und FDP, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/063/1706315.pdf, dazu die Pressemeldung http://heise.de/-1424063.
[20] Vgl. den Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 17/6096, http://dip.bundestag.de/btd/17/060/1706096.pdf; dazu http://heise.de/-1271516, S. 2.
[21] Vgl. den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/6296, http://dip.bundestag.de/btd/17/062/1706296.pdf, S. 4.
[22] Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020 (Drs. 2359-12), http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf, S. 45ff., Zitat S. 47; vgl. dazu jüngst ausführlich Robert Kretzschmar, Archive als digitale Informationsinfrastrukturen. Stand und Perspektiven, in: Archivar 66 (2013), S. 146-153, hier S. 146f., der zu Recht betont, dass Archive bei ihren Digitalisierungsbemühungen und bei der Prioritätensetzung alle Benutzergruppen gleichermaßen und nicht allein die wissenschaftliche Klientel im Blick haben dürften.
[23] Strategiepapier zur Digitalisierung von Kulturgut im Land Brandenburg, http://www.mwfk.brandenburg.de/media/lbm1.a.1491.de/strategiepapier.pdf; vgl. dazu Mario Glauert, Kulturgut im Verbund: gemeinsame Digitalisierungsstrategie von Bibliotheken, Archiven, Museen, Denkmalpflege und Archäologie im Land Brandenburg, in: Brandenburgische Archive 27 (2010),S. 63-64. Neben Brandenburg verfügt wohl auch das Land Berlin über eine – m. W. noch unveröffentlichte – Digitalisierungsstrategie, die sich nach Auskunft von Kollegen allerdings eng an der Brandenburgischen orientiert.
[24] Vgl. Strategiepapier zur Digitalisierung von Kulturgut, wie Anm. 23, S. 41f., zum Aufgabenkanon der Koordinierungsstelle. Bereit gestellt werden jährlich 100.000€.
[25] vgl. das im Februar 2012 publizierte „Konzept zur Beteiligung von Kultureinrichtungen des Landes Brandenburg an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)“, http://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/files/233/Konzept_zur_Beteiligung_von_Kultureinrichtungen_des_Landes_Brandenburg_an_der_DDB.pdf, das auf Grundlage des Strategiepapiers entstanden ist; zur Koordinierungsstelle Brandenburg-digital vgl. http://informationswissenschaften.fh-potsdam.de/kst-lb-digital.html.
[26] Kulturpolitische Strategie 2012 (September 2012), S. 8 (= http://www.mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Kulturpolitische%20Strategie.pdf.
[28] In Berlin existiert inzwischen beim Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) eine vergleichbare Beratungs- und Koordinierungsstelle, die digiS, die Archive, Bibliotheken, Museen und Gedenkstättenberät und in diesem Jahr für beachtliche 400.000€ Digitalisierungsprojekte fördert; vgl. http://www.servicestelle-digitalisierung.de.
[29] Vgl. Digitalisierungsstrategie der Stiftung Preußischer Kulturbesitz – inhaltliche Prioritäten der Einrichtungen der SPK 2011-2015; Download über die Seite http://www.preussischer-kulturbesitz.de/schwerpunkte/digitalisierung/digitalisierungsstrategie.html.
[31] Vgl. Empfehlungen zur Weiterentwicklung (wie Anm. 22), S. 49.
[32] Vgl. Empfehlungen zur Weiterentwicklung (wie Anm. 22), bes. S. 50-52, hier S. 50: „Die DFG sollte in die Lage versetzt werden, die dafür bereit gestellten Mittel für weitere zehn Jahre aufzustocken.“
[33] DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“, http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf: englisch: http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_en.pdf.
[34] Vgl. z. B. DFG-Positionspapier: Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme: Schwerpunkte der Förderung bis 2015 (2006), http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/positionspapier.pdf; Die digitale Transformation weiter gestalten – Der Beitrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu einer innovativen Informationsinfrastruktur für die Forschung (2012), http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/positionspapier_digitale_transformation.pdf.
[35] Clough, Best of Both Worlds, wie Anm. 2, S. 5: „Libraries and archives were among the early adopters of digital technology. With their “open access” ethic, they embraced both digitization and social networking early on and began to ask, “What would the model look like if visitors could explore the collections on their own terms?”“
[36] Vgl die Projektbeschreibung auf der Homepage des BAM-Portals. http://www.bam-portal.de/projektziel.html: „Das BAM-Portal ist ein wichtiger nationaler Beitrag zu Digitalisierungsstrategien in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene. Das BSZ ist für die Museen in der Bund-Länder-Fachgruppe für die Deutsche Digitale Bibliothek vertreten. Das BSZ ist mit dem BAM-Portal zudem Datenaggregator für die Europeana“.
[37] Seit dem 12. November 2012 ist eine Beta-Version der DDB online, vgl. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de. Vgl. dazu den aktuellen Sachstand: Ein Archivportal für Deutschland. Der Aufbau des Archivportals-D innerhalb der Deutschen Digitalen Bibliothek als Chance für Archive in der Informationsgesellschaft”. Vortrag Gerald Maier, Christina Wolf auf dem Deutschen Archivtag, Sektionssitzung 4, 26. September 2013 in Saarbrücken, http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/55666/Archivportal-D_saarbruecken-2013_Vortrag.pdf.
[38] In den Flächenbundesländern fehlen regionale Archivportale in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In den Stadtstaaten Bremen und Hamburg ist die Archivlandschaft überschaubar.
[39] Vgl . http://www.wirtschaftsarchivportal.de; nur Kontaktdaten und Links zu den Homepages, keine Beständeübersichten oder Online-Findbücher.
[40] Vgl. z. B. http://www.katholische-archive.de, mit Kontaktdaten und groben Bestandsübersichten, keine Onlinefindbücher.
[41] Eine Standardisierung täte hier not; vgl. dazu die vom IT-Ausschuss der ARK erarbeiteten Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Präsentationen von Erschließungsinformationen im Internet, http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/ark/vorlage_ark_erschlie_ung_online.pdf. Als weitere Plattform ist außerdem noch das Findbuchportal des Archivsoftwareanbieters AUGIAS-Data zu nennen, über das Findbücher von Archiven verschiedener Sparten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Italien und den USA recherchierbar sind: vgl. http://www.findbuch.net/homepage/index.php.
[42] Vgl. http://www.landesarchiv-bw.de/web/54267.
[43] Vgl. Gerald Maier, Der Aufbau einer „Deutschen Digitalen Bibliothek“ und der „European Digital Library – Europeana, in: Archivar 61 (2008), S. 399-401, hier S. 400: „Die Architektur ist so geplant, dass neben spartenübergreifenden Nutzer-Sichten (views) auch spartenspezifische Sichten möglich sind, was auch im Hinblick auf die Realisierung eines „Archivportals D“ zu berücksichtigen ist“; vgl. auch die Informationen auf der Projekthomepage des Landesarchivs Baden-Württemberg, http://www.landesarchiv-bw.de/web/54267; zum europäischen Archivportal vgl. http://www.archivesportaleurope.net/de; jüngst zusammenfassend Kerstin Arnold, Susanne Waidmann, Vernetzte Präsentation – Erfahrungen mit Portalen; In: Archivar 4 (2013), S. 431-438, bes. S. 433f.
[44] Vgl. http://www.landesarchiv-bw.de/web/55783; die Karte findet sich unter https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/about-us/institutions#map (nur Archive).
[45] vgl. dazu ausführlich und mit zahlreichen weiteren Hinweisen zuletzt Angelika Menne-Haritz, Archivgut in digitalen Bibliotheken, in: Archivar 65 (2012), S. 248-257.
[46] Das Landesarchiv Baden-Württemberg in der digitalen Welt“. Strategie für die Integration von analogem und digitalem Archivgut, die Digitalisierung von Archivgut und die Erhaltung digitalen Archivguts, http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/43034/Digistrategie_labw2007web.pdf, S. 6; vgl. auch Positionspapier der ARK „Digitalisierung von Archivgut im Kontext der Bestandserhaltung“, in: Archivar 61 (2008), S. 395-398, hier S. 396 (online: http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/42353/digibest.pdf
[47] Digitalisierung im Bundesarchiv. Strategie für den Einsatz neuer Techniken der Digitalisierung zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Archivguts und zu seinem Schutz 2011 – 2016 (Stand Februar 2011), S.6.
[48] Vgl. http://archivschule.de/DE/home/zum-abschluss-ein-rekorddie-koordinierungsstelle-retrokonversion-archivischer-findmittel-hat-ihre-arbeit-beendet.html.
[49] Vgl. den Projektbericht von Hans-Reinhard Fricke, http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/fundus/2/fricke.pdf. Die Original-URL des Digitalen Archivs Duderstadt funktioniert seit Jahren nicht mehr. Zugänglich sind die Digitalisate m.W. nur noch über das Portal digitalisierter Kulturgüter Niedersachsens OPAL, was als ausgesprochen schlechte, weil kontextlose Lösung gelten muss, vgl. http://opal.sub.uni-goettingen.de/no_cache/browse/erweitert/?tx_jkOpal_pi1%5BcatEntry%5D=Urkunden+des+Stadtarchivs+Duderstadt&. Besonders traurig mutet an, dass von der Infoseite des Stadtarchivs das Digitale Archiv zwar gerühmt wird („Diese Sammlung ist im Bereich der kommunalen und staatlichen Archive noch immer führend in Europa“), aber nicht verlinkt ist!
[50] Vgl. zuletzt Christian Reinicke, Arbeiten im digitalen Lesesaal. Landesarchiv NRW Personenstandsarchiv Brühl, in: Archivar 61 (2008) S. 76-80 mit weiteren Hinweisen.
[51] Vgl. zu den Projekten die Projektwebsites mit weiteren Hinweisen; zum Projekt Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut http://www.landesarchiv-bw.de/web/47361, zu den Workflows und Werkzeugen zur digitalen Bereitstellung größerer Mengen von Archivgut http://www.landesarchiv-bw.de/web/47354 und zum BAM-Portal http://www.landesarchiv-bw.de/web/44573.
[52] Vgl. Hartmut Weber, Digitale Repertorien, virtueller Lesesaal und Praktikum im WWW – neue Dienstleistungsangebote der Archive an die Forschung, in: Fundus – Forum für Geschichte und ihre Quellen 4 (1999), S. 197-213, hier S. 212 (= http://webdoc.gwdg.de/edoc/p/fundus/html/heft_4.html).
[53] 10% von 60 Mio. geschätzten Verzeichnungseinheiten war die Zielmarke der DFG-Aktionslinie Retrokonversion: Mit DFG-Förderung wären demnach 8% (4,8 von 60 Mio.) der Verzeichnungseinheiten insgesamt retrokonvertiert worden.
[54] Vgl. z. B. Frieder Kuhn, Nicht zu vergessen: Mikrofilm! Ein Zwischenruf, in: Gerald Maier / Thomas Fricke (Hrsg.), Kulturgut aus Archiven, Bibliotheken und Museen im Internet (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A, Heft 17), Stuttgart 2004, S. 203-205 (online: http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/43102/WerkheftA17_Schnitt.pdf).
[55] Das Landesarchiv Baden-Württemberg in der digitalen Welt. Strategie für die Integration von analogem und digitalem Archivgut, die Digitalisierung von Archivgut und die Erhaltung digitalen Archivguts, http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/43034/Digistrategie_labw2007web.pdf, S. 6.
[56] Ebd., S. 2 Anm. 4 und bes. S. 7.
[57] Digitalisierung im Bundesarchiv, wie Anm. 47, S. 10: „Der teilweise von Nutzern als reduziert empfundene Komfort der Mikrofilme kann durch den Einsatz der Digitalisate für die Nutzung erheblich verbessert werden, so dass sich Mikrofilm als Sicherungsmedium und Digitalisate als Nutzungsmedium gut ergänzen. Die Erstellung von Digitalisten wird deshalb in der Regel vom Mikrofilm aus vorgenommen.“
[58] Vgl. die nützliche und praxisnahe, inzwischen freilich etwas in die Jahre gekommene Empfehlung Digitalisierung von archivischem Sammlungsgut http://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen/Empfehlung_Digitalisierung.pdf, sowie Marcus Stumpf, Grundlagen, Planung und Durchführung von Digitalisierungsprojekten, in: ders. / Katharina Tiemann (Hrsg.), Kommunalarchive und Internet. Beiträge des 17. Fortbildungsseminars der Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK) in Halle vom 10.–12. November 2008 (Texte und Untersuchungen zur Archivpflege 22) Münster 2009, S. 111–132.
[59] Vgl. dazu http://www.archive.nrw.de/lav/archivfachliches/bestandserhaltung/digitalisierung/index.php und Grundsätze der Bestandserhaltung – Technisches Zentrum, hrsg. vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Überarb. Neuauflage, Düsseldorf 2011, S. 44f.
[60] Frank Bischoff / Marcus Stumpf, Digitalisierung von archivalischen Quellen – DFG-Rundgespräch diskutiert fachliche Eckpunkte und Ziele einer bundesweiten Digitalisierungskampagne, in: Archivar 64 (2011), S. 343-346, Frank Bischoff, Digitale Transformation. Ein DFG-gefördertes Pilotprojekt deutscher Archive, in: Archivar 65 (2012), S. 441-446; Projekthomepage: http://www.archivschule.de/DE/forschung/digitalisierung/.
[61] Vgl. Entwicklungen der Personalstrukturen im Archivwesen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Strategiepapier der ARK 2011, in: Archivar 64 (2011), S. 397-413, hier S. 398.
[62] Vgl. Mario Glauert, Dimensionen der Digitalisierung. Kosten, Kapazitäten und Konsequenzen, in: Claudia Kauertz (Red.), Digital und analog. Die beiden Archivwelten. 46. Rheinischer Archivtag. 21.-22. Juni 2012 in Ratingen. Beiträge (Archivhefte 43), Bonn 2013, S. 42-53, hier S. 46f.
[63] Vgl. Das Landesarchiv Baden-Württemberg in der digitalen Welt, wie Anm. 46, S. 5f. Dies ist im übrigen auch ein wichtiger Aspekt im DFG-Pilotprojekt, indem erprobt werden soll, inwieweit durch die Vergabe von Strukturdaten bei der Digitalisierung, die das Archivale in der Viewer-Ansicht besser gliedern (etwa bei Amtsbüchern), eine (zu) flache Verzeichnung kompensiert werden kann.
[64] Vgl. Seamus Ross, Strategies for selecting resources for digitization: source-orientated,
user-driven, asset-aware model (SOUDAAM). In: T. Coppock (Hrsg.), Making information available in digital format: perspectives from practitioners. Edinburgh 1999, S. 5-27, hier S. 16 f.
Quelle: http://archivamt.hypotheses.org/668


















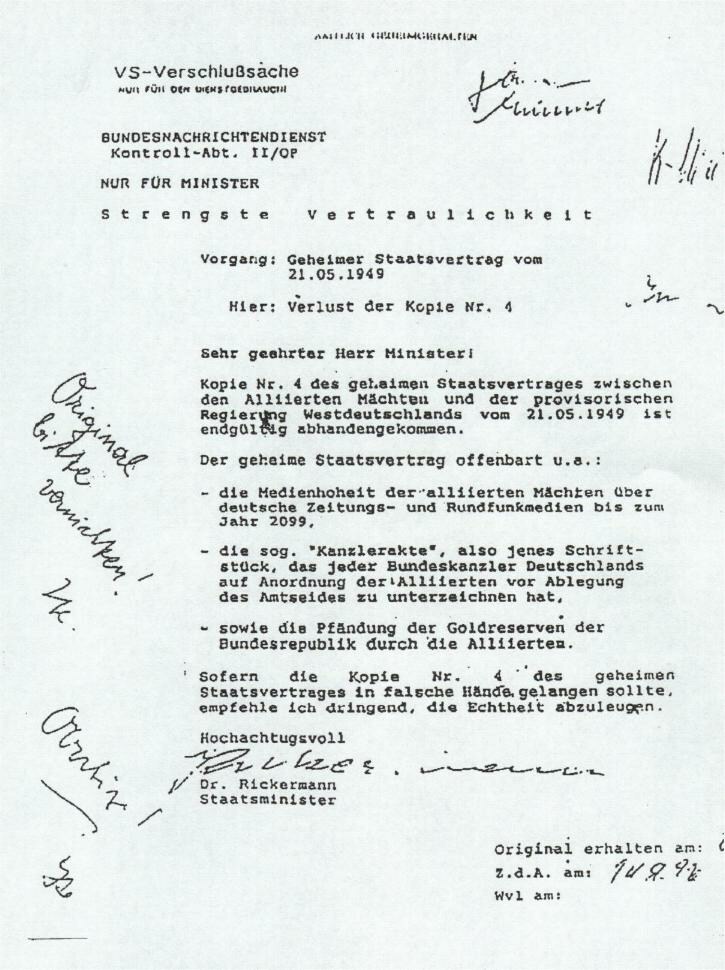



![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r-v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/%C3%9Cbersicht-Zeitung-300x223.jpg)
![Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 1. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Nachrichtentext-150x150.jpg)
![links: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [46]. rechts: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 7. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Kamel1-300x232.jpg)
![Detail aus: Melchior Lorck: Wolgerissene und Geschnittene Figuren. Hamburg: Hering, 1626, S. [57]. Detail aus: Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]v.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Auslassungen-300x113.jpg)

![Werner Eberhard Happel: Thesaurus Exoticorum. Hamburg: Thomas von Wiering, 1688. S. 28. Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 2. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Kamel-300x242.jpg)
![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 10. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Fu%C3%9Fsoldat-170x300.jpg)
![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 26. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r. Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 79. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1]r.](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Bostangi-300x221.jpg)
![Türckis. Estats- und Krieges-Bericht Nr. 5. Hamburg: Thomas von Wiering, 1683, S. [1].](http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1230/files/2014/04/Tartar-188x300.jpg)
