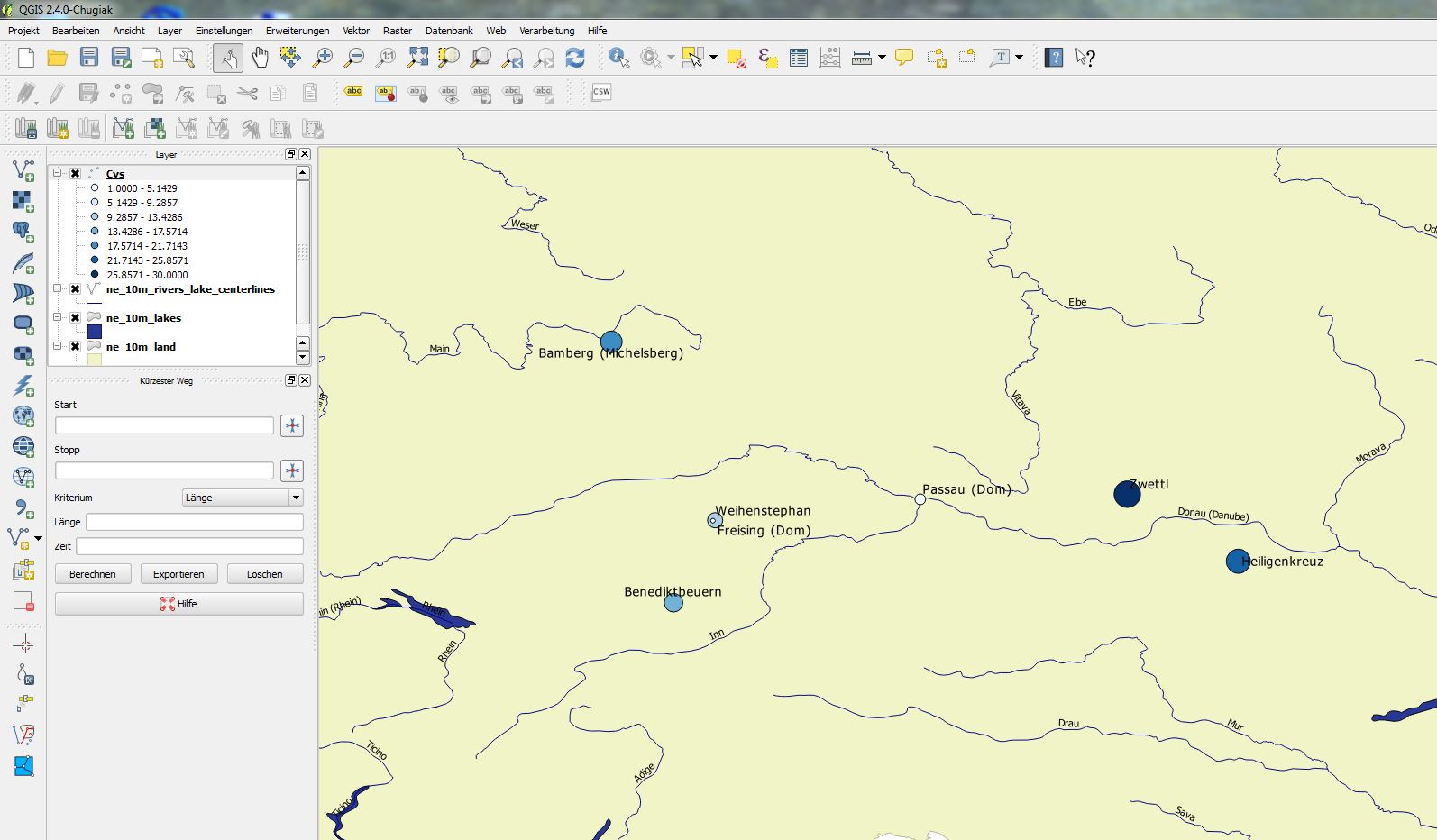So wie Mareike König fragt – quo vadis? - , fällt mir als erstes der Historienschinken gleichen Titels von Henryk Sienkiewicz (1895) ein und das Hollywood-Kintopp der 1950er Jahre, in dem Peter Ustinov den Nero als eine rundliche Mischung aus Macbeth und Richard III. gibt: so brutal traurig mit seinem schick abgefackelten Rom.
Davon ausgehend, lässt sich gleichwohl direkt ins Thema „Gymnasialbibliothek“ einsteigen, denn so etwas wie der Sienkiewicz stand da schon mal 'rum. Nur deshalb gleich ein Blog? Das fragte ich ja bereits schon auf dieser Seite, wenn auch, zugegeben, einige Leser dort Ironiesignale gesehen haben wollten. Wirklichkeit ist eben manchmal ironisch.
Warum ein Blog wie „bibliotheca.gym“? Zunächst, weil's das nicht gab und weil nur eine einzige Gymnasialbibliothek bloggte, die's unterdessen aber eingestellt zu haben scheint. Und warum in einem Wissenschaftsportal? Grund waren Erkenntnisse, die ich aus dem 2012 als Causa Stralsund bekannt gewordenen Verkauf einer umfangreichen gymnasialen Buchsammlung aus einem Stadtarchiv gewonnen zu haben meinte und die ich mir in zwei Arbeitshypothesen goss:
1. Wissenschaft und Bibliothekswesen haben zwar durchaus Kenntnis von dieser speziellen, über Jahrhunderte dicht verbreiteten Sammlungsform, aber sie ist kein eigenes wissenschaftliches Thema geworden und in den Bibliotheken ein internes geblieben. Zwei externe Gutachter in Stralsund kamen ins Regionalprogramm; Tagungen zu diesem Komplex oder DFG-Förderungen wurden bislang nicht bekannt. Das wissenschaftlich orientierte Weblog Kulturgut erschien infolge der Causa.
2. Die breite Öffentlichkeit hat keinerlei Kenntnis von dieser Sammlungsform und in welch einmaliger Weise sie die Bildungsgeschichte (insbesondere die in unserem Land) zu repräsentieren vermag: eine nicht nur wissenschaftliche, sondern auch eine publizistische Brache, und deshalb eine Herausforderung. Über die Causa Stralsund berichtete die Regionalpresse, 1 (in Worten: ein) nennenswerter Artikel erschien in einer überregionalen Tageszeitung. Hier war allein das Internet der maßgebliche Motor gewesen, Verantwortliche in Bewegung zu setzen.
Was tat ich? Ich stellte zwei kleine Artikel ein (zur gymnasialen Bibliothek, zum gymnasialen Archiv), die wohlwollende Reaktionen erbrachten seitens derer, die's bereits wussten. Ich stellte eine zerzauste, unfertige Liste ein, die als Arbeitsliste schon seit einigen Jahren auf meiner Festplatte herumdümpelte, mit der Idee, a) überhaupt erst einmal irgendwo in der Literatur und im Internet bekannt gewordene vorhandene, umgesiedelte und zerstörte Bestände von Gymnasialbibliotheken zu erfassen, wobei b) ich fest davon überzeugt war (und bin), dass dies einem Einzelnen, ja auch einer Gruppe an einem einzigen (und sei es: universitären) Ort nicht in absehbarer Zeit gelingen könne, sondern dass c) ein allgemein zugänglicher Ort, den ein Blog darstellt, eventuell Personen mit ihrem Wissen herbeilocken könne. Ich legte Köder aus, auch die kleinen Entdeckungen nicht zu missachten.
Nun, ein paar kamen, schnupperten, gingen aber nicht in die Falle – gingen wieder fort und blieben fort. Ich schaute mir an, wie andere Blogs aussehen (zum Beispiel bei de.hypotheses) auf der Suche nach der Melodie des Rattenfängers. Ich habe noch keinen Klang im Kopf. Die „Öffentlichkeit“ dieses Blogs ist wohlwollend, nett – und anscheinend allein im Internet zuhause. Bürger, die als Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung signifikant Einfluss nehmen könnten, sind mir bloggend unerreichbar (auch da fehlt mir noch die betörende Melodie).
Ich bin indes der festen Überzeugung, dass Bloggen zum Thema Gymnasialbibliothek und -archiv sich dennoch lohnt, und zwar wissenschaftlich und publizistisch für ein noch zu interessierendes Publikum. Hoffnung hat sich noch niemals entlohnt:
1. Ich halte es nach wie vor für vordringlich, dass die Wissenschaft sowohl den inhaltlichen als auch den methodischen Wall aufbaut, der dieses fragile Kulturgut, das sich landauf landab nicht mal gar so selten noch an seinen angestammten Orten befindet, vor unbedarftem und unkontrolliertem Umgang beschützt.
2. „Bildung“, vor allem auch die schulische, befindet sich unterdessen fest in den Händen politischer Parteien und wurde längst für Wahlkämpfe zurechtgeschnitzt. Dringend erforderlich erscheint mir, zum Beispiel gegen abenteuerliche, aber gern unter die Leute gebrachte Missverständnisse die Kanonen der Aufklärung in Stellung zu bringen. Wörter wie „humanistisch“ und Namen wie „Humboldt“ müssen nicht zur wohlfeilen Propaganda aller Couleur zusammengedampft und so auch noch tradiert werden.
Wie haben allerdings keinen Anlass, uns zum Beispiel gegenüber einer Causa Stralsund auf ein hohes Ross zu setzen. Die DDR hatte 40 Jahre lang daran gearbeitet, die bürgerliche Geschichte zu tilgen; derlei dauert in den Köpfen. Der Westen fügte sich derweil der Diktatur der Zahl („brauchen wie das?“) - kein Anlass also zu triumphieren, wenn das Pekuniäre das Denken und Handeln bestimmt.
Versuchen wir's doch einfach mal mit der Hoffnung - einem der Leitgedanken der Aufklärung und den Ideen der Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts gar nicht mal so fern. Als eine der Leitideen der Gymnasien wurde sie angesichts politischer Umgebungen nicht selten vergessen. Auch von den dunklen gymnasialen Perversionen der Zeitläufte zeugen die Buch- und Dokumentensammlungen der Anstalten gelegentlich noch.
Zurück in die Zukunft war ein hübscher Filmtitel; dann aber, so fordert der Oberlehrer, auch bitte gleich richtig und ad fontes, ihr Gesellen!
_______
Beitrag zur Blogparade: Wissenschaftsbloggen: zurück in die Zukunft - ein Aufruf zur Blogparade #wbhyp
Abbildung: Kite by Mario, CC BY-NC 2.0.