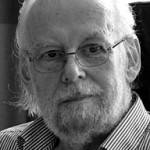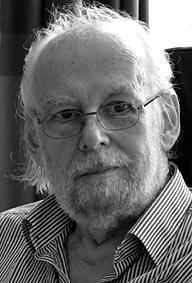Die Jury hat abgestimmt und das Publikum hat gewählt. Hier also die Ergebnisse unseres Blogawards 2014, den wir anlässlich des zweiten Geburtstags der deutschsprachigen Plattform für geistes- und sozialwissenschaftliche Blogs de.hypotheses.org organisiert haben. Gewählt bzw. gezählt wurde dabei in vier Kategorien: die Jury bestehend aus Wissenschaftlichem Beirat, Redaktion und Community Management wählte ihre persönliche Top-3 der Blogbeiträge aus dem Slider und Top-5 der Blogs. Der Spezialpreis der Jury geht an das Blog, das am häufigsten im Slider und auf der Startseite vertreten war. Und schließlich gibt es den Publikumspreis, bei dem die Community über die Top-5 der beliebtesten Blogs der Plattform abgestimmt hat.
Die Jury hat abgestimmt und das Publikum hat gewählt. Hier also die Ergebnisse unseres Blogawards 2014, den wir anlässlich des zweiten Geburtstags der deutschsprachigen Plattform für geistes- und sozialwissenschaftliche Blogs de.hypotheses.org organisiert haben. Gewählt bzw. gezählt wurde dabei in vier Kategorien: die Jury bestehend aus Wissenschaftlichem Beirat, Redaktion und Community Management wählte ihre persönliche Top-3 der Blogbeiträge aus dem Slider und Top-5 der Blogs. Der Spezialpreis der Jury geht an das Blog, das am häufigsten im Slider und auf der Startseite vertreten war. Und schließlich gibt es den Publikumspreis, bei dem die Community über die Top-5 der beliebtesten Blogs der Plattform abgestimmt hat.
I. Publikumspreis
Wir beginnen mit dem Publikumspreis: Zur Wahl standen die über 90 Blogs, die im Katalog von OpenEdition aufgenommen sind und im letzten Jahr aktiv waren. Die Kandidaten hatten wir in der Reihe “Was soll ich denn nur wählen?” vorgestellt. Insgesamt haben 355 Personen ihre Stimme abgegeben. Und so hat die Community abgestimmt:
Platz 1
1914 – Mitten in Europa – http://1914lvr.hypotheses.org/
Insgesamt 81 Stimmen entfielen auf dieses Blog, das ein Verbundprojekt begleitet, mit dem der Landschaftsverband Rheinland (LVR) an den Beginn des Ersten Weltkrieges erinnert. Herzlichen Glückwunsch!
Platz 2
Soziologieblog – http://soziologieblog.hypotheses.org/
Auf Platz 2 wurde das Soziologieblog, das von Studierenden und junge Nachwuchswissenschaftler/innen begleitend zum Soziologie-Magazin gemacht wird, mit 52 Stimmen gewählt. Wir gratulieren!
Platz 3
Geschichte zwopunktnull – http://zwopktnull.hypotheses.org/
Mit 50 Stimmen ganz knapp dahinter kam das Blog von Christian Brunnenberg über Digitales in Geschichtsunterricht und Geschichtsdidaktik auf Platz 3. Félicitations!
Platz 4
Soziale Medienbildung – http://medienbildung.hypotheses.org/
Das Gemeinschaftsblogs des Fachbereichs Sozialwesen und des Zertifikatprogramms “Soziale Medienbildung” des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung an der Hochschule Fulda erhielt insgesamt 36 Stimmen und sicherte sich damit Platz 4. Wir gratulieren!
Platz 5
musermeku – http://musermeku.hypotheses.org/
Platz 5 in dieser Kategorie geht mit 29 Stimmen an das Blog “Museum, Erinnerung, Medien und Kultur” von Angelika Schoder und Damián Morán Dauchez. Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen sehr herzlich, danken der Community für die Stimmabgabe und hoffen, dass dabei so manches bisher unbekanntes Blog entdeckt werden konnte!
II. Top 3 der Blogbeiträge aus dem Slider (Jurywahl)
Zur Erinnerung: Hier wählten die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats, der Redaktion und des Community Management aus den 45 Beiträgen, die im vergangenen Jahr im Slider waren, jeweils ihre drei Lieblingsbeiträge aus. Hier das Ergebnis der Abstimmung:
Platz 1
In der Begründung der Jury heißt es: „Der Beitrag zum Swing-Plakat zeigt exemplarisch, wie man durch eine interessante Themenwahl zum richtigen Zeitpunkt viel Aufmerksamkeit erhalten kann.“ Wir haben es mit einer „wunderbaren Fallstudie“ zu tun, die „schwungvoll“, „sehr anschaulich und überzeugend“ geschrieben ist. Kurz: „ein gut recherchierter, ausgezeichnet bebilderter Beitrag zu einem ungewöhnlichen Thema“ und ein „glänzendes Beispiel dafür, wie ein aktueller Anlass – in diesem Fall die Ausstrahlung eines medial gehypten Fernsehspiels – dazu genutzt werden kann, Geschichtsmythen zu widerlegen.“ Herzlichen Glückwunsch an Bodo Mrozek!
Platz 2
Klaus Graf: Recht für Blogger: Darf ich fremde Bilder verwenden? – http://redaktionsblog.hypotheses.org/1706
Das sagt die Jury zu diesem Artikel: „Der Beitrag von Klaus Graf steht stellvertretend für viele andere von ihm verfasste, die instruktiv die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen bzw. aus seiner bisherigen Erfahrungen gewonnene Regeln zusammenfassen und auch dem/der nicht so mit der Materie vertrauten LeserIn nahebringen.“ Kurz: Der Artikel „schafft wichtige Klarheit“ darüber, dass unklare Rechtsfragen die freie Entfaltung der digitalen Geschichtswissenschaft behindert.
Platz 3
Den Dritten Platz teilen sich vier Artikel, die stimmgleich abgeschnitten haben und hier in alphabetischer Reihenfolge nach Autorenname geordnet genannt werden:
Christian Boulanger: Wie man sich auf eine wissenschaftsnahe Stelle (nicht) bewirbt – http://gab.hypotheses.org/695
Die Jury findet: “Der Beitrag von Christian Boulanger ist äußerst nützlich für alle Nachwuchswissenschaftler und fasst zwar vielfach Bekanntes zusammen, dies jedoch sprachlich witzig und anschaulich. Bewerbungen, die seinen Tipps folgen, haben sicherlich höhere Aussichten auf Erfolg”.
Kerstin Küster: “Emma, die Nackte” oder vom Akt im öffentlichen Raum – http://gra.hypotheses.org/722
In der Begründung der Jury heißt es: „Der Beitrag stellt in bewundernswerter Kürze einen Denkanstoß dar und lotet auch auf einer generischen Ebene das Zusammenspiel zwischen Kunst, Wissenschaft und sozialen Netzwerken aus (hier im Bereich der Sperrung von Bildern/Seiten, die Kunstobjekte mit vermeintlich “obszönem” Charakter darstellen). Das Format entspricht genau der Textsorte Blog und regt zur intellektuellen Auseinandersetzung an.“
Lilian Landes: (Digital) Humanities Revisited – Challenges and Opportunities in the Digital Age. Oder: Wie man Gräben isst – http://rkb.hypotheses.org/576
Die Jury zeigt sich angetan: Der Artikel von Lilian Landes ist ein „wichtiger Beitrag zur Positionierung der deutschsprachigen digitalen Geschichtswissenschaft“. Er ist „einfach gut geschrieben”, dabei “nicht nur flott, sondern auch informativ“.
Claudine Moulin: Codices im Netz – Die Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften und ihre Konsequenzen - http://annotatio.hypotheses.org/353
So begründet die Jury ihre Wahl: Claudine Moulin hat „ausgehend von einem Tagungsbericht einen wirklich programmatischen Artikel“ geschrieben. “Digital Humanities als Normalfall, gänzlich unaufgeregt und nah an den Dingen“.
Wir gratulieren allen Autorinnen und Autoren dieser Beiträge und wünschen dem Publikum bei der neuerlichen oder erstmaligen Lektüre dieser Blogposts viel Spaß!
III. Top-5 der Blogs (Jurywahl)
In dieser Kategorie wählten Wissenschaftlicher Beirat, Redaktion und Community Management aus den Blogs aus, die im Katalog von OpenEdition sind und im letzten Jahr aktiv waren. Und so wurde abgestimmt:
Platz 1
DK-Blog: Quellen, Literatur, Interpretationen zum Dreißigjährigen Krieg – http://dkblog.hypotheses.org/
In der Begründung der Jury heißt es: “Das Blog verbindet die substanzielle Kenntnis eines arrivierten Wissenschaftlers auf diesem Gebiet mit dem neuen Format – auch in der Art des Schreibens und der regelmäßigen Frequenz. Die Gattung der Quellenmiszelle wird hier auf überzeugende Weise wiederbelebt. Jedes Posting ist wohlproportioniert, gut formuliert und bringt Neues zu einem wichtigen Forschungsfeld der Frühneuzeitforschung. Sachkenntnis trifft sich hier mit der Lust an neuen Vermittlungsformen. Das vielleicht originellste deutschsprachige geschichtswissenschaftliche Blog.” Wir gratulieren Michael Kaiser zu Platz 1!
Platz 2
Auf Platz 2 finden sich mit gleicher Stimmenzahl drei Blogs, hier alphabetisch gelistet:
Mind the gaps – http://mindthegaps.hypotheses.org/
Die Jury findet: “Auch für Nicht-SinologInnen stets hoch spannend, mit wunderbaren kulturhistorischem Sinn und Stil. So geht Habilitation heute!”
Ordensgeschichte – http://ordensgeschichte.hypotheses.org
Aus der Begründung der Jury: „Das Blog ist lebendig und zeichnet sich durch hohe Qualität der Beiträge aus, die von jüngeren, aber auch erfahrenen Wissenschaftler/innen geschrieben werden. Das Blog zeigt sich offen, lädt zu Mitarbeit und zu Verbesserungen ein. Sehr gefällt außerdem der vorbildliche Einsatz der sozialen Medien, vor allem die mit Zotero gemeinsam erstelle Bibliographie. Insgesamt großes Kompliment!“
Pophistory – pophistory.hypotheses.org
Das sagt die Jury: „Thema und Beiträge sind spannend und interessant und hätten noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Zwar gab es quantitativ bei den Beiträgen einen kleinen Hänger im vergangenen Jahr, aber wir hoffen auf mehr, da einfach viele gute einzelne Artikel mit interessanten Beobachtungen dabei sind.“
Platz 3
Platz 3 teilen sich stimmengleich zwei Blogs:
Mittelalter – http://mittelalter.hypotheses.org/
Die Jury meint: “Ein lebendiges, vielfältiges, stets aktuelles und von vielen Beiträgern und Beiträgerinnen geführtes Blog. Besonders nützlich ist der Bereich “Opuscula”, in dem verschiedene Formen von “Kleinpublikationen” erprobt werden. Das Blog zeichnet sich durch professionellen Aufbau und Organisation aus und setzt insbesondere auf Vernetzung. Ein gelungenes Beispiel für das Engagement von (Nachwuchs)wissenschaftlern im interdisziplinären Austausch. Toll!”
Aktenkunde – http://aktenkunde.hypotheses.org/
In der Begründung der Jury heißt es: „Im Blog werden interessante Themen an einzelnen Beispielen ganz anschaulich dargestellt, so wird ein vermeintlich langweiliges Sujet spannend. Publiziert werden sehr fundierte Artikel und Analysen, die zwar manchmal speziell, aber trotz der trockenen Materie gut gemacht und gut geschrieben sind, so dass man doch einfach weiterliest.“
Platz 4
Auf Platz 4 finden sich stimmengleich zwei Blogs:
Minus Eins Ebene – http://minuseinsebene.hypotheses.org/
Das sagt die Jury: “Ein vorbildliches dissertationsbegleitendes Blog: flotte Schreibe, interessante Blickwinkel und eine gelungene Vermischung aus aktuellen Themen und Blogbeiträge zum Dissertationsprojekt. Sehr gut!”
Nordic history Blog – http://nordichistoryblog.hypotheses.org/
Die Jury findet: “Ein Gemeinschaftsblog mit vielen sehr gut geschriebenen und informativen Beiträgen. Sehr schön ist die Einbindung des Sondersammelgebiet Skandinavien der UB Kiel, die regelmäßig interessante Webressourcen vorstellt. Das sollte Schule machen!”
Platz 5
Auf Platz 5 schließlich drängen sich mit gleicher Stimmenzahl gleich neun Blogs, und zwar in alphabetischer Reihenfolge:
Achtundvierzig – http://achtundvierzig.hypotheses.org/
Aus Sicht der Jury ein Blog mit zahlreichen „ausführlichen Beschreibungen der Teilprojekte der Mitarbeiter“, aber auch „eigens für das Blog verfasste Tagungsberichte sowie insbesondere Rezensionen und Miszellen“. Gelobt wird vor allem die Bereitschaft zur Vernetzung und zur Zusammenarbeit mit anderen Blogs!
Archivar – Kamera – Weltkrieg – http://kriegsfoto.hypotheses.org/
So äußert sich die Jury: „Ein vorzügliches, materialnahes archivalisches Blog, mit dem wichtiges fotohistorisches Material zugänglich gemacht wird.“
Das 19. Jahrhundert in der Perspektive – http://19jhdhip.hypotheses.org/
Die Meinung der Jury dazu: „Das DHI Paris ist wie eigentlich immer vorn dabei in Sachen Geschichtsblogs. Für ein institutionelles Blog ist dieses zudem erstaunlich kollaborativ. Weiter so!“
De rebus sinicis – http://wenhua.hypotheses.org/
“Ein Blog mit vielen interessanten und sehr gut geschriebenen Artikeln, das die Sinologie verdienstvoll einem größerern Publikumskreis öffnet”, meint dazu die Jury.
Deutsche Nachkriegskinder – http://zakunibonn.hypotheses.org/
Die Jury findet: “Zwar gerade erst gestartet, aber ein Blog zu einem spannenden Projektthema, das innovativ über Crowdfunding finanziert wird und viel Potential erahnen lässt.”
Philosophie – Phisolophie – http://philophiso.hypotheses.org/
Aus der Sicht der Jury ein Blog mit „gut geschriebenen Texten, die Interesse am Thema wecken und einen oftmals schmunzeln lassen, so dass man denkt: genau so ist es!“
Quadrivium – http://quadrivium.hypotheses.org/
So begründet die Jury ihre Wahl: Ein Wissenschaftsblog „ganz nah dran am geozentrischen Weltbild des Mittelalters – dabei wissenschaftliche Reflexion zur eigenen Dissertation mit öffentlicher Vermittlung gut kombinierend. Wir freuen uns auf mehr!“
Soziologieblog – http://soziologieblog.hypotheses.org/
Das meint die Jury: “Ein Blog, das eine Zeitschrift begleitet und vielfältige Themen fundiert und gut geschrieben aufgreift. Ein hervorragendes Beispiel für das Engagement des wissenschaftlichen Nachwuchses.”
TEXperimentales – http://texperimentales.hypotheses.org/
Hier genügt ein schlichtes Wort der Jury: „authentisch!“, obwohl es im vergangenen Jahr einen quantitativen Einbruch gab. Wir hoffen auf weitere (Meta)-Beiträge!
Auch hier gratulieren wir ganz herzlich allen Bloggenden!
IV. Spezialpreis der Redaktion
Und schließlich kommen wir zur letzten Kategorie, dem Spezialpreis der Redaktion. Zur Erinnerung: Dieser Spezialpreis sollte an das Blog vergeben werden, das am häufigsten mit Beiträgen auf der Startseite und im Slider der Plattform vertreten war. Nun ergab die mühsame Auszählung allerdings, das gleich vier Blogs mit jeweils drei Beiträgen im letzten Jahr im Slider vertreten waren. Daher wird der Spezialpreis also viermal vergeben, und zwar an:
Herzlichen Glückwunsch an alle vier und ein Dank vor allem, für die hochwertigen Beiträge!
Der zweite Spezialpreis wird an das Blog verliehen, das mit den meisten Beiträge auf der Startseite vertreten war. Hier geht der Preis an:
Glückwunsch an Monika Lehner, die mit 45 Beiträgen damit sogar das Redaktionsblog schlägt! Eine tolle Leistung, handelt es sich doch nicht etwa um ein Gemeinschaftsblog, sondern um ein habilitationsbegleitendes Blog einer einzelnen (fleißigen) Wissenschaftlerin.
Damit endet der Blogaward 2014. Wir gratulieren allen Bloggenden und ihren Blogs, allen Autorinnen und Autoren! Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der Jury, die abgestimmt und die Laudatio mit vorbereitet haben. Ein ganz großes Dankeschön geht an das Community Management, das im Hintergrund schwer gewerkelt hat, um den Blogaward mit den verschiedenen Abstimmungen umzusetzen. Und schließlich ein Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass unser Blogaward 2014 als das verstanden wurde, was er sein sollte: ein Dank an die gesamte Community für ihr Engagement und eine Werbung für das Wissenschaftsbloggen und bestehende Blogs, die sich durch Qualität, Kreativität und Vielfalt auszeichnen.
Quelle: http://redaktionsblog.hypotheses.org/2148