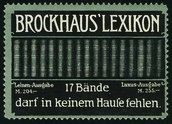 Aufräumarbeiten in der Vergangenheit
Aufräumarbeiten in der Vergangenheit
Wieder einmal klappt er zu, der Sargdeckel des Veralteten. Ein historisches Kapitel wird beschlossen, ein lange Zeit vertrautes Element verabschiedet sich aus der Wirklichkeit, ein bislang selbstverständliches Phänomen verlässt das Hier und Jetzt – und lenkt damit unseren Blick auf eben diese Wirklichkeit, in der wir leben. Den Brockhaus wird es in Zukunft nicht mehr geben. Nach mehr als 200 Jahren wird dieser einst als unverzichtbar geltende Hort des Wissens, der in keinem sich selbst als bildungsbürgerlich verstehenden Haushalt fehlen durfte, der Entropie der Geschichte zum Opfer fallen. Oder muss man genau genommen nicht davon sprechen, dass es ihn schon länger nicht mehr gibt? Denn die wirtschaftlichen Probleme und zurückgehenden Absatzzahlen, in denen die sinkende Bedeutung dieses Nachschlagewerks ihren unerbittlichen Ausdruck findet, sind ja nicht über Nacht aufgetaucht. Schon länger schwächelt der Brockhaus, weshalb die nun getroffene Ankündigung wie die Hinnahme einer schon länger bestehenden Tatsache anmutet. Die Entwicklungen der jüngeren Zeit – 2012 wurde bereits bekannt gegeben, dass die altehrwürdige „Enyclopaedia Britannica“ nur noch digital erscheint – sind wohl eher Aufräumarbeiten in den Halden einer abgeschlossenen Vergangenheit. Die Reaktionen auf das Brockhaus-Ende sind daher auch weniger durch ein kulturpessimistisches „Was soll jetzt werden?“ als vielmehr durch ein erleichtertes „Wurde aber auch Zeit“ geprägt.
Mit was für einer Veränderung haben wie es hier zu tun? Handelt es sich um eine Verschiebung lexikalischen Wissens vom Bücherregal auf den Bildschirm? Oder wird hier das gewinnorientierte Verlagsunternehmen durch die kollaborative Schwarmintelligenz abgelöst? Oder überholt die Hochgeschwindigkeit des Virtuellen die Trägheit des Gedruckten? Ohne Frage sind all das Faktoren, die sich am Beispiel des Endes klassischer Enzyklopädien beobachten lassen. Schließlich ist es nur zu offensichtlich, dass in der derzeitig vorherrschenden Lexikalisierung von Wissen eine Transformation stattgefunden hat (und weiterhin stattfindet), dass teure und verhältnismäßig schwerfällige Buchprodukte nicht mehr mit kostenlosen und flexiblen Internetangeboten konkurrieren können und dass die Ansprüche an Verfügbarkeit und Aktualisierbarkeit des Wissens einer unübersehbaren Beschleunigung unterliegen.
Beständige Anpassung
Aber ist das aktuelle Ereignis des Brockhaus-Endes tatsächlich ein Indiz für den Abschluss einer historischen Entwicklung? Wir haben es mit dem Ende eines Wirtschaftsunternehmens zu tun, aber nicht – in einem tragischen Sinn – mit dem Ende eines Kapitels der Kulturgeschichte oder – in einem emphatischen Sinn – mit einem Beleg für eine Revolution des Wissens. Wir sind vielmehr Zeugen einer erneuten Transformation der Wissensorganisation, von der einst auch Brockhaus profitierte. Denn das seit 1808 erscheinende Konversationslexikon war wahrlich nicht das erste seiner Art. Schon ein Jahrhundert zuvor hatte sich das nur als „Hübner“ bekannte „Reale Staats- Zeitungs- und Conversationslexicon“ etabliert. Es war um 1700 aus der Notwenigkeit heraus entstanden, die im noch relativ jungen Medium der Zeitung behandelte Welt der Gegenwart zu thematisieren. Wissen sollte sich also nicht mehr nur auf klassische und gewissermaßen ewig gültige Inhalte beziehen, sondern hatte nun auch das Hier und Jetzt zu behandeln. Denn die Welt, wie sie der Leserschaft in der periodisch erscheinenden Zeitung vor Augen trat, war durchzogen von Phänomenen, Personen, Ereignissen, Institutionen und Begriffen, die nicht ohne weiteres verständlich waren. Die Gattung des Zeitungs- und Konversationslexikons sollte hier Abhilfe schaffen.
Schon dieses neue Informationsmedium lebte von der Beschleunigung des Wissens, denn Voraussetzung seines Erfolgs war, dass es sich an die permanent verändernde Gegenwart anpasste und in beständig verbesserten Auflagen erschien. Andere Enzyklopädien, die seit dem 16. Jahrhundert (und auch noch parallel zu den neuen Konversationslexika im 18. Jahrhundert) erschienen, waren Einmalprodukte. Sie traten mit dem hypertrophen Anspruch auf, das Wissen der Welt in einer letztlich vollständigen und vor allem dauerhaft gültigen Form zu versammeln. Aber selbst bei diesen einmalig erscheinenden Enzyklopädien lassen sich Phänomene nicht übersehen, die einer Dynamisierung des Wissens dienen sollten. Denn hatten ältere Exemplare noch auf ein topisches und systematisches Wissensverständnis gesetzt, indem sie ihre Inhalte in Themenbereichen anordneten, sprengten spätere Veröffentlichungen diese Einheit auf. Sie gingen zu einer alphabetischen Organisation des Wissenskosmos über, wodurch keinerlei inhaltlicher Zusammenhang mehr sichtbar wurde. Die Einheit des Wissens wurde geradezu zerfetzt, indem man sie der zufälligen Zuordnung der Buchstabenfolge überließ. Dadurch konnten solche Lexika aber zugleich als schnellere Nachschlagewerke genutzt werden, die überhaupt nicht mehr die Intention hatten, zur Gänze gelesen zu werden.
Die Beständigkeit des Unbeständigen
Vor diesem Hintergrund ist das Ende des Brockhaus überhaupt kein Ende. Der Wandel des Mediums und die zunehmende Dynamisierung des Wissens sind nur konsequente Fortsetzungen von Prozessen, die schon seit Längerem zugange sind. Aufschlussreicher ist daher möglicherweise die Frage nach der Kultur, die Wissen für sich in einer bestimmten lexikalischen Form organisiert. Wenn das Wikipedia-Prinzip inzwischen das Brockhaus-Prinzip abgelöst hat, dann überwindet hier nicht nur das schnellere Internet das langsamere Buch. Dann wird vor allem eine Unbeständigkeit und Unsicherheit des Wissens etabliert, die wesentlich bedeutsamer zu sein scheint. Der gedruckte Brockhaus arbeitete mit einer Verbindung von Zeit und Wissen, die wenn schon nicht auf Ewigkeit, dann zumindest auf Dauerhaftigkeit setzte. Wissen war stabil – oder hatte zumindest stabil zu erscheinen. Demgegenüber funktioniert Wikipedia nicht nur auf der Basis des Prinzips, dass Wissen immer aktualisiert werden muss, sondern dass es sich von den Grundlagen bis in die kleinsten Verästelungen hinein beständig verändern können muss. Die Fragilität des Wissens tritt an die Stelle der Stabilität. Und wenn man sich der Beständigkeit des Wissens über die Welt unsicher geworden ist, dann macht seine Materialisierung in Papierform auch keinen Sinn mehr. Wenn das Ende des Brockhaus also etwas über unsere Wirklichkeit verrät, dann über den fragilen Status des Wissens.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien Tagged: Brockhaus, Enzyklopädie, Wikipedia, Wissen
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2013/06/17/09-brockhaus-und-die-fragilitat-des-wissens/




