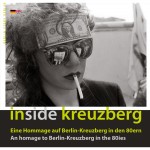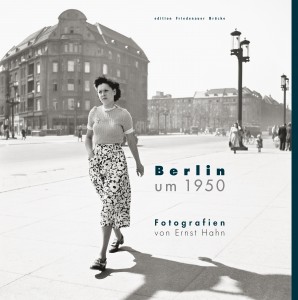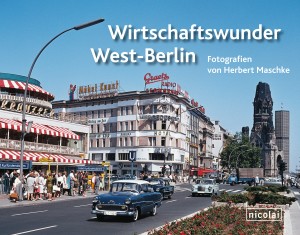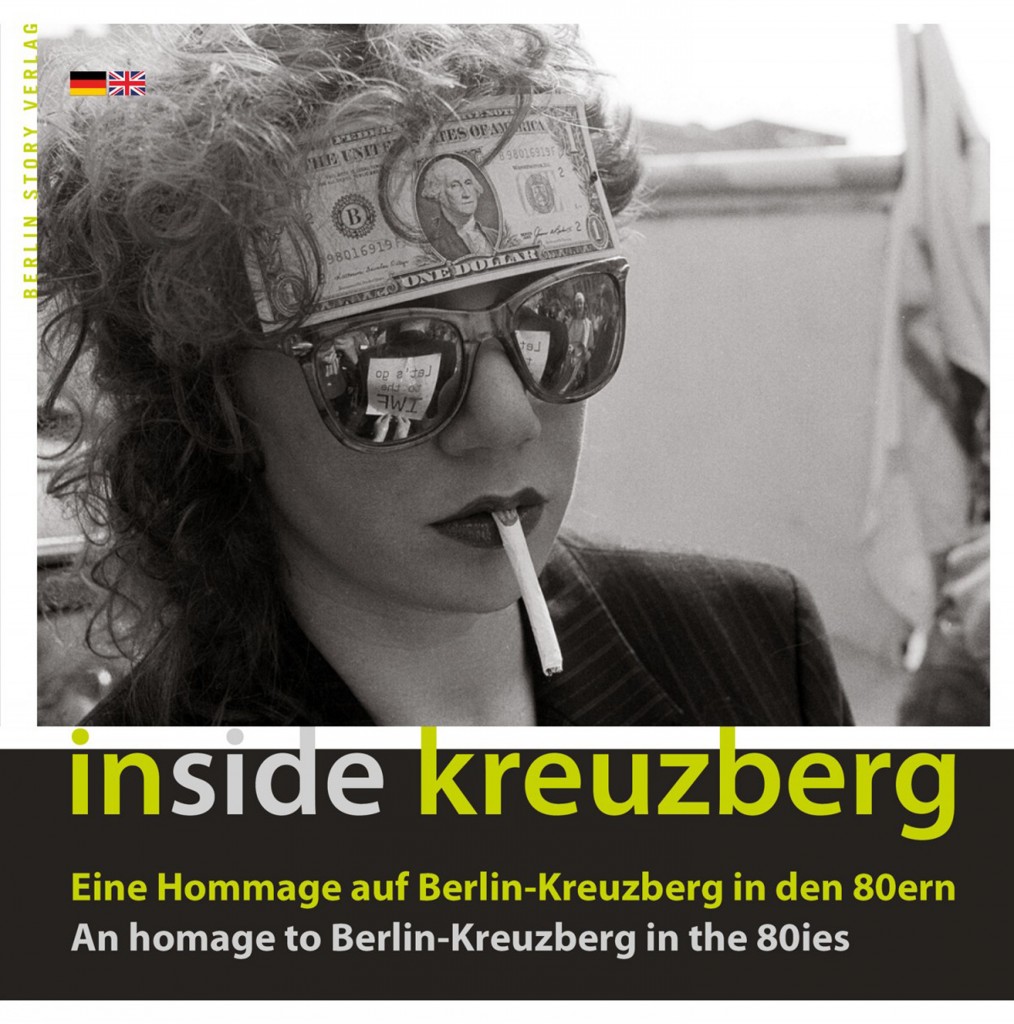Die Links zur Historischen Zeitschrift sind nicht Open Access, sondern nur über Institutionen mit einem Abonnement aufrufbar.
Regina Dauser: Rezension zu: Acta Pacis Westphalicae: Acta Pacis Westphalicae. Ser. 2, Abt. A: Die kaiserlichen Korrespondenzen. Bd. 9: Mai – August 1648. Bearb. v. Stefanie Fraedrich-Nowag. Münster 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 788-789
doi:10.1515/hzhz-2014-1476
Moritz Isenmann: Rezension zu: Jesús Astigarraga / Javier Usoz (dir.): L’économie politique et la sphère publique dans le débat des Lumières (= Collection de la Casa de Velázques, 135). Madrid 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/astigarraga_isenmann
Volker Reinhardt: Rezension zu: Nicholas Scott Baker: The Fruit of Liberty. Political Culture in the Florentine Renaissance. Cambridge, MA 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/baker_reinhardt
Christine Zabel: Rezension zu: Carine Barbafieri / Jean-Christophe Abramovici (éd.): L’invention du mauvais goût à l'âge classique (XVIIe–XVIIIe siècle) (= La république des lettres, 51). Louvain, Paris, Walepole, MA 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/barbafieri-abramovici_zabel
Andrea Iseli: Rezension zu: Justine Berlière: Policer Paris au siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (= Mémoires et documents de l’École des chartes, 91). Paris 2012, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/berliere_iseli
Wilhelm Ribhegge: Rezension zu: Eckhard Bernstein: Mutianus Rufus und sein humanistischer Freundeskreis in Gotha. Köln / Weimar / Wien 2014, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 12, 15.12.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/12/25761.html
Alexander Querengässer: Rezension zu: Jaap R. Bruijn / Ronald Prud'homme van Reine / Rolof van Hövell tot Westerflier (Hrsg.): De Ruyter. Dutch Admiral. Zutphen 2012 / Robert Rebitsch: Die Englisch-Niederländischen Seekriege. Köln 2013, in: H-Soz-Kult, 15.12.2014
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-21411
Thomas Kaufmann: Rezension zu: Heinrich Bullinger: Heinrich Bullinger Werke. Abt. 2: Briefwechsel. Bd. 15. Briefe des Jahres 1545. Bearb. v. Reinhard Bodenmann, Alexandra Kess, Judith Steiniger. Unter Benützung der Abschriften v. Emil Egli u. Traugott Schieß. Philologische Beratung durch Ruth Jörg. Zürich 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 782-785
doi:10.1515/hzhz-2014-1473
Ignace Bossuyt: Rezension zu: Camilla Cavicchi / Marie-Alexis Colin / Philippe Vendrix (dir.): La musique en Picardie du XIVe au XVIe siècle. Turnhout 2012, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 17.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/cavicchi_colin_bossuyt
Tobias Daniels: La congiura dei Pazzi: i documenti del conflitto fra Lorenzo de' Medici e Sisto IV. Le bolle di scomunica, la"Florentina Synodus", e la "Dissentino" insorta tra la Santità del Papa e i Fiorentini (= Studi di Storia e Documentazione Storica; 6). Florenz 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 12, 15.12.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/12/24796.html
Sünne Juterczenka: Rezension zu: Luigi Delia / Aurélie Zygel-Basso (dir.): L’Europe et le monde colonial au XVIIIe siècle (= Études internationales sur le dix-huitième siècle, 14). Paris 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 10.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/delia-zygel-basso_juterczenka
Jörg Ulbert: Rezension zu: Heinz Duchhardt / Martin Espenhorst (Hg.): Utrecht – Rastatt – Baden 1712–1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 98). Göttingen 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/duchhardt-espenhorst_ulbert
Michael Rowe: Rezension zu: Heinz Duchhardt: Der Wiener Kongress München. Die Neugestaltung Europas 1814/1815 (= Beck’sche Reihe, 2778). München 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/duchhardt_rowe
Susanne M. Hoffmann: Rezension zu: Johannes Fontana: »Liber instrumentorum iconographicus«. Ein illustriertes Maschinenbuch. Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Horst Kranz (= Boethius. Texte und Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, 66). Stuttgart 2014, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/fontana_hoffmann
Arne Karsten: Rezension zu: Gigliola Fragnito: Storia di Clelia Farnese. Amori, potere, violenza nella Roma della Controriforma. Bologna 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 785-786
doi:10.1515/hzhz-2014-1474
Thomas Wozniak: Rezension zu: Miriam von Gehren: Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Zur Baugeschichte im Zeitalter der Aufklärung. Köln/Weimar/Wien 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/gehren_wozniak
Gerd Schwerhoff: Rezension zu: Joel F. Harrington: Die Ehre des Scharfrichters. Meister Frantz oder ein Henkersleben im 16. Jahrhundert. Aus dem Engl. v. Norbert Juraschitz. München 2014, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 786-788
doi:10.1515/hzhz-2014-1475
Gabriele B. Clemens: Rezension zu: Heiner Haan: Die Haans. Geschichte einer rheinischen Kaufmannsfamilie (= Industrialisierung und Bürgertum, 1). Trier 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/haan_clemens
Silvia Richter: Rezension zu: Thorsten Heese / Martin Siemsen: Justus Möser 1720–1794. Aufklärer, Staatsmann, Literat. Die Sammlung Justus Möser im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück (= Osnabrücker Kulturdenkmäler, 14/Möser-Studien, 1). Bramsche 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/heese-siemsen_richter
Michael Wenzel: Rezension zu: Berthold Heinecke / Hole Rößler / Flemming Schock (Hrsg.): Residenz der Musen. Das barocke Schloss als Wissensraum (= Schriften zur Residenzkultur, 7). Berlin 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/heinecke-roessler_wenzel
Albert Schirrmeister : Rezension zu: James Hirstein (éd.), avec la collab. de Jean Boës, François Heim, Charles Munier† et al.: Epistulae Beati Rhenani. La Correspondance latine et grecque de Beatus Rhenanus de Sélestat. Édition critique raisonnée, avec traduction et commentaire. Vol. 1 (1506–1517). Turnhout 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/hirstein_schirrmeister
Katrin Keller: Rezension zu: Marcel Korge: Kollektive Sicherung bei Krankheit und Tod. Fallstudien zum frühneuzeitlichen Zunfthandwerk in städtischen Zentren Sachsens (Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau) (= Studien zur Gewerbe- und Handelsgeschichte der vorindustriellen Zeit, Bd. 33). Stuttgart 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 780-782
doi:10.1515/hzhz-2014-1472
Johan Lange: Rezension zu: Jonathan Israel: Revolutionary Ideas. An Intellectual History of the French Revolution from »The Rights of Man« to Robespierre. Princeton 2014, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/israel_lange
Christian Witt: Rezension zu: Bernd Jaspert (Hrsg.): Kirchengeschichte als Wissenschaft. Münster 2013, in: H-Soz-Kult, 02.12.2014
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-20066
Christina Vanja: Rezension zu: Robert Jütte: Krankheit und Gesundheit in der Frühen Neuzeit. Stuttgart 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 779-780
doi:10.1515/hzhz-2014-1471
Klaus Malettke: Rezension zu: Nicolas Le Roux: Le roi, la cour, l’État. De la Renaissance à l’absolutisme. Seyssel 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/le-roux_malettke
Inken Schmidt-Voges: Rezension zu: Peter Lindström / Svante Norrhem: Flattering Alliances. Scandinavia, Diplomacy, and the Austrian-French Balance of Power 1648–1740. Lund 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/lindstroem-norrhem_schmidt-voges
Sebastian Meurer: Rezension zu: Gaby Mahlberg / Dirk Wiemann (ed.): European Contexts for English Republicanism. Farnham/Surrey 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/mahlberg_meurer
Volker Reinhardt: Rezension zu: Brian Jeffrey Maxson: The Humanist World of Renaissance Florence. Cambridge 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/maxson_reinhardt
Maria-Christina Lutter: Rezension zu: Daniel Ménager, L’Ange et l’ambassadeur. Diplomatie et théologie à la Renaissance (= Études et essais sur la Renaissance, 101). Paris 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/menager_lutter
Georg Eckert: Rezension zu: Paul Kléber Monod: Solomon’s Secret Arts. The Occult in the Age of Enlightenment. New Haven/London 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 791-793
doi:10.1515/hzhz-2014-1478
Heinz Noflatscher : Rezension zu: Matthias Müller / Karl-Heinz Spieß / Udo Friedrich (Hg.): Kulturtransfer am Fürstenhof. Höfische Austauschprozesse und ihre Medien im Zeitalter Kaiser Maximilians I. (= Schriften zur Residenzkultur, 9). Berlin 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/mueller-spiess-friedrich_noflatscher
Dominik Perler: Rezension zu: Cecilia Muratori / Burkhard Dohm (Eds.): Ethical Perspectives on Animals in the Renaissance and Early Modern Period (= Micrologus’ Library, 55). Firenze 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 777-779
doi:10.1515/hzhz-2014-1470
Georg Eckert: Rezension zu: Stefano Saracino: Republikanische Träume von der Macht. Die Utopie als politische Sprache im England des 17. Jahrhunderts. Göttingen 2014, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 12, 15.12.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/12/25939.html
Stefan Jordan: Rezension zu: Ulrich Johannes Schneider: Die Erfindung des allgemeinen Wissens. Enzyklopädisches Schreiben im Zeitalter der Aufklärung. Berlin 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 789-791
doi:10.1515/hzhz-2014-1477
Gonthier-Louis Fink : Rezension zu: Jürgen von Stackelberg: Voltaire und Friedrich der Große (= Aufklärung und Moderne, 31). Hannover 2013, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/stackelberg_fink
Damien Tricoire: Rezension zu: Benjamin Steiner: Colberts Afrika. Eine Wissens- und Begegnungsgeschichte in Afrika im Zeitalter Ludwigs XIV.. München 2014, in: H-Soz-Kult, 01.12.2014
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-22884
Bernhard R. Kroener: Rezension zu: Guy Thewes: Stände, Staat und Militär. Versorgung und Finanzierung der Armee in den Österreichischen Niederlanden 1715-1795. Wien 2012, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 12, 15.12.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/12/25370.html
Josef Johannes Schmid: Rezension zu: Otto Ulbricht (Hg.): Schiffbruch! Drei Selbstzeugnisse von Kaufleuten des 17./18. Jahrhunderts. Edition und Interpretation. Köln / Weimar / Wien 2013, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 12, 15.12.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/12/25369.html
Stefan Benz: Rezension zu: Karl Vocelka: Frühe Neuzeit 1500–1800. Konstanz 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 776-777
doi:10.1515/hzhz-2014-1469
Josef Johannes Schmid: Rezension zu: Harry Ward: When Fate Summons. A Biography of General Richard Butler, 1743-1791. Palo Alto 2014, in: sehepunkte 14 (2014), Nr. 12, 15.12.2014
http://www.sehepunkte.de/2014/12/25780.html
Thomas Clark: Rezension zu: Hermann Wellenreuther: Citizens in a Strange Land. A Study of German-American Broadsides and Their Meaning for Germans in North America, 1730–1830 (= Max Kade German-American Research Institute Series). University Park 2013, in: Historische Zeitschrift, 299.3 (2014): 793-795
doi:10.1515/hzhz-2014-1479
Pascal Firges: Rezension zu: Victor N. Zakharov / Gelina Harlaftis / Olga Katsiardi-Hering (ed.): Merchant Colonies in the Early Modern Period (= Perspectives in Economic and Social History, 19). London 2012, in: Francia-Recensio 2014/4 Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815), 05.12.2014
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2014-4/FN/zakharov-harlaftis_firges
Quelle: http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1836