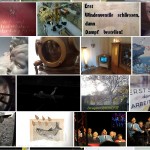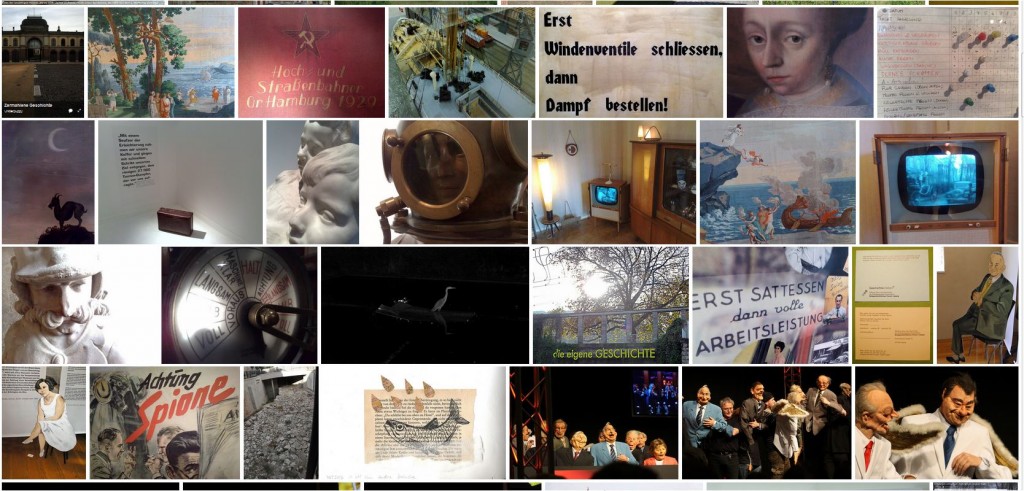Von Torsten Weber
Der Erste Weltkrieg spielt in der Geschichtsschreibung und im öffentlichen Diskurs Japans traditionell nur eine sehr untergeordnete Rolle. Dies liegt zum einen an anderen historiographischen Traditionen, denen zufolge der Weltkrieg in die kurze und meist weniger beachtete Regierungszeit des Taisho-Kaisers (1912–1926) fällt.

Plan des Kriegsgefangenenlagers Bando, Japan.
Weit größere Beachtung finden dagegen die längeren und ereignisreicheren Meiji- (1868–1912) und Showa-Zeiten (1926–1989). Mit der Meiji-Zeit begann nicht nur die rapide „Modernisierung“ des Landes nach westlichen Vorbildern, sondern es fallen damit auch die militärischen Erfolge gegen das chinesische Qing-Reich (1894–1895) und das Russische Reich (1904–1905), die Japans regionale Vormachtstellung begründeten,zusammen. In Kombination mit der Showa-Periode, in die nicht nur der Zweite Weltkrieg fällt, sondern auch der Aufstieg Nachkriegsjapans zur wirtschaftlichen Weltmacht, wirkt die Taisho-Zeit als bloßes Interregnum. Zudem nimmt der Erste Weltkrieg verglichen mit der Bedeutung des Russisch-Japanischen und des sogenannten „Fünfzehnjährigen Krieges“ (1931–1945) gegen China sowie später die USA und andere westliche Kolonialmächte auch rein faktisch einen bescheideneren Platz in der Geschichte Japans ein.
Dennoch gibt es seit einigen Jahren Bestrebungen, den Ersten Weltkrieg auch in Japan wieder stärker ins Zentrum des historischen Interesses zu rücken. Dies liegt auch am Einfluss globalhistorischer und transnationaler Geschichtsschreibung, durch die unter anderem Themen aus der Geschichte der ostasiatischen Nachbarländer Japans stärker in die japanische Historiographie einfließen. Dort nimmt vor allem das Jahr 1919 als Ursprung des anti-japanischen Widerstandes eine besondere Position ein. Darüber hinaus versucht insbesondere der renommierte japanische Ideenhistoriker Yamamuro Shinichi (Kyoto Universität) schon seit einigen Jahren, die historische Bedeutung des Ersten Weltkrieges auch für Japan selbst zu unterstreichen. Im Jahr 2008 setzte er in einer Befragung der Zeitung Asahi Shinbun den Ersten Weltkrieg an die Spitze einer Liste der zehn bedeutendsten Ereignisse der modernen Geschichte Ostasiens, noch vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Russisch-Japanischen Krieg. Aus seiner Sicht entsprangen dem „Großen Europäischen Krieg“, wie er zeitgenössisch in Japan überwiegend bezeichnet wurde, viele politische Ideen sowie Ereignisse, die die folgenden Jahrzehnte bis in die Gegenwart geprägt haben. Als Beispiele nennt Yamamuro unter anderem die Entstehung anti-kolonialer Bewegungen, eines durch internationale Organisationen institutionalisierten Internationalismus sowie die Herausbildung einer modernen Massenkultur, die gleichzeitig auch eine Kritik an der Moderne hervorbrachte. Für Japan, das in Folge des Ersten Weltkrieges zunehmend in Konflikt mit den USA, China und Russland gekommen war, habe der Krieg gleichzeitig auch die Konstellation des Zweiten Weltkrieges vorangekündigt. Yamamuro geht darüber hinaus davon aus, dass sich in Japan verhältnismäßig früh – um das Jahr 1920 – bereits ein Bewusstsein bildete, dass es sich beim Weltkrieg nur um einen ersten handelte, dem bald ein zweiter (gegen die USA) folgen könnte.
Damit sieht Yamamuro ähnlich wie Eric Hobsbawm große ideelle und strukturelle Kontinuitäten, die als Beginn des „Zeitalters der Extreme“ (Hobsbawm) ihren Ursprung im Ersten Weltkrieg haben, allerdings im Falle Ostasiens nicht mit dem Ende des Kalten Kriegs enden. In Ostasien dauert der Kalte Krieg vielmehr an und mit ihm in mancher Hinsicht auch das „Zeitalter der Extreme“. Anstelle ideologischer Spannungen, die auch in Ostasien deutlich in den Hintergrund getreten sind, markieren wirtschaftliche und strategische Interessen sowie nationalistische Rhetorik die Eckpunkte der Streitigkeiten. Als lange Schatten des „kurzen 20. Jahrhunderts“ (Hobsbawm) reichen diese bis in die Gegenwart. Für Japan sind dabei besonders die angespannten Beziehungen zu seinen Nachbarn problematisch. Mit Russland, Südkorea, der Volksrepublik China und auch Taiwan streitet es über Territorien. Zwar hat keiner dieser rivalisierenden Gebietsansprüche direkt mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, doch ist er durch entsprechende Regelungen territorialer Fragen zugunsten Japans eng mit dieser Problematik verbunden. Insbesondere mit Südkorea und der Volksrepublik China streitet Japan zudem auch über zahlreiche historische Fakten (u. a. Nanking-Massaker, Zwangsprostitution, Invasionskrieg) und die Bewertung dieser (u. a. in Geschichtsbüchern, Museen und Gedenkstätten) innerhalb der modernen Geschichte Ostasiens. Auch diese haben meist nur indirekt mit dem Ersten Weltkrieg und Japans Beteiligung daran zu tun. Dessen eigentliche Geschichte ist nämlich schnell erzählt: Als Verbündeter Englands erklärte Japan im August 1914 dem Deutschen Reich den Krieg und erreichte im September die deutsche Kolonie Jiaozhou (Kiautschou) um die Stadt Qingdao (Tsingtau) in der Provinz Shandong (Shantung) an der Nordostküste Chinas. Mit der Kapitulation des deutschen Kommandanten Alfred Meyer-Waldeck im November 1914 endete der militärische Teil des Ersten Weltkrieges in Ostasien im engeren Sinne, lange bevor die Schlacht um Verdun überhaupt begonnen hatte. Bereits zuvor hatten Japan, Australien und Neuseeland die deutschen Besitzungen im Pazifik erobert. Die mehr als 4.000 deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen verbrachten nach der Kapitulation eine vergleichsweise angenehme Zeit in verschiedenen Lagern in Japan, von denen das in Bando auf der Insel Shikoku besonders bekannt wurde. Dort wurde nicht nur Kuchen gebacken, Tennis gespielt und eine Lagerzeitschrift gedruckt, sondern im Juni 1918 auch zum vermutlich ersten Mal in Japan Beethovens Neunte Symphonie komplett mit Schlusschor aufgeführt. Das Deutsche Institut für Japanstudien (DIJ) Tokyo verfügt über eine umfassende Sammlung zum Bando-Lager, die online zugänglich ist (bando.dijtokyo.org).

Tsingtau und Umgebung
Die Folgen des schnellen japanischen Erfolges vor allem gegen die deutsche Kolonie in China beflügelten die Expansionspläne des japanischen Militärs. Im Januar 1915 übergab die japanische Regierung dem chinesischen Präsidenten Yuan Shikai die berüchtigten „21 Forderungen“, mit denen sich Japan langfristig wirtschaftliche und politische Kontrolle über China verschaffen wollte. Der Tag der Annahme der Forderungen wurde als „Tag der nationalen Demütigung“ (9. Mai) in China über Jahrzehnte in Erinnerung gehalten. Der Ausdruck „nationale Demütigung“ (guochi) spielt bis heute in China eine wichtige Rolle in der patriotischen Erziehung und im öffentlichen Diskurs. Allerdings wird er heute selten mit den „21 Forderungen“ in Verbindung gebracht, sondern bezieht sich auf verschiedene historische Ereignisse oder auf die japanische Invasion Chinas insgesamt. Auch in den anti-japanischen Demonstrationen der vergangenen Jahre, die sich zumeist gegen japanischen Geschichtsrevisionismus und die Besuche hochrangiger japanischer Politiker des umstrittenen Yasukuni-Schreins in Tokio richten, dient „Vergesst niemals die nationale Demütigung“ (wuwang guochi) als Slogan der Demonstranten. Diese nationalistischen Massendemonstrationen stehen nicht nur rhetorisch in engem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Die Entscheidung der Versailler Friedenskonferenz, die japanischen Kriegseroberungen in China nicht direkt an China zurückzugeben, sondern zunächst unter japanische Verwaltung zu stellen, riefen im Frühjahr 1919 die ersten umfangreichen Massenproteste in chinesischen Städten hervor. Die darauf folgende Vierte-Mai-Bewegung gilt als Geburtsstunde des populären politischen Nationalismus in China. Sie hat zu einer massiven und nachhaltigen Verschlechterung des Japanbildes in weiten Teilen der chinesischen Bevölkerung geführt.
Ähnlich liegt der Fall Koreas, das seit dem Ende des Russisch-Japanischen Krieges 1905 unter weitgehender japanischer Kontrolle stand und 1910 von Japan annektiert wurde. Lenins und Wilsons Proklamationen des Selbstbestimmungsrechtes der Völker weckten hier wie in weiten Teilen der übrigen kolonialisierten Welt hohe Erwartungen. Doch der „Wilsonsche Moment“ (Manela) verstrich, und die Neugestaltung der Weltordnung in Versailles ließ das Leid und die Interessen der Kolonialisierten weitgehend außer Acht. Enttäuschungen darüber führten in Korea wie in China zu Massendemonstrationen. Am 1. März 1919 versammelten sich bis zu zwei Millionen Koreaner, um landesweit für die Unabhängigkeit von Japan zu demonstrieren. Die Bewegung wurde von den japanischen Besatzern brutal unterdrückt, Korea blieb bis 1945 unter Japans Herrschaft. Der 1. März ist heute nationaler Feiertag in Südkorea, der 4. Mai wird als „Tag der Jugend“ in der Volksrepublik China in Erinnerung gehalten.
Ähnlich liegt der Fall Koreas, das seit dem Ende des Russisch-Japanischen Krieges 1905 unter weitgehender japanischer Kontrolle stand und 1910 von Japan annektiert wurde. Lenins und Wilsons Proklamationen des Selbstbestimmungsrechtes der Völker weckten hier wie in weiten Teilen der übrigen kolonialisierten Welt hohe Erwartungen. Doch der „Wilsonsche Moment“ (Manela) verstrich, und die Neugestaltung der Weltordnung in Versailles ließ das Leid und die Interessen der Kolonialisierten weitgehend außer Acht. Enttäuschungen darüber führten in Korea wie in China zu Massendemonstrationen. Am 1. März 1919 versammelten sich bis zu zwei Millionen Koreaner, um landesweit für die Unabhängigkeit von Japan zu demonstrieren. Die Bewegung wurde von den japanischen Besatzern brutal unterdrückt, Korea blieb bis 1945 unter Japans Herrschaft. Der 1. März ist heute nationaler Feiertag in Südkorea, der 4. Mai wird als „Tag der Jugend“ in der Volksrepublik China in Erinnerung gehalten.
Auch in Japan selbst wurden während des Krieges und in dessen unmittelbarer Folge Rufe nach sozialen, politischen und ökonomischen Reformen lauter: 1918 demonstrierten Hunderttausende gegen steigende Reispreise, 1919 wurde das Wahlrecht reformiert, 1920 eine sozialistische Partei gegründet ebenso wie eine Gesellschaft für Frauen, die sich erfolgreich für deren Recht auf politische Betätigung einsetzte. Zahlreiche kulturelle und politische Publikationen und Organisationen entstanden, wie die Frauenzeitschrift Fujin Koron (1916 bis heute) und die Gesellschaft für Aufklärung (Reimeikai, 1918), die offen für die Rechte der von Japan kolonialisierten Völker eintrat. Die vom Wilsonschen Idealismus und der Russischen Revolution inspirierten Bewegungen für Gleichheit, Freiheit, Demokratie und Pluralismus sorgten so für eine gesellschaftliche, kulturelle und intellektuelle Blüte in der Nachkriegszeit – blieben aber ohne nennenswerten Einfluss auf die japanische Kolonialpolitik.

Deutsche Kriegsgefangene
in Bando
Die japanische Geschichtswissenschaft hat in den vergangenen Jahren im Zuge transnationaler Forschungen oft kollaborativ mit chinesischen und koreanischen Kolleginnen und Kollegen wichtige Werke zur Aufarbeitung der japanischen Kolonialgeschichte vorgelegt und damit zur wissenschaftlichen Stabilisierung historischer Narrative beigetragen. Gleichzeitig hat allerdings die japanische Regierung durch Maßnahmen, die wohlwollend als ungeschickt, anders aber auch als provokativ eingestuft werden können, schwelende Konflikte um das historische Bewusstsein und die Aufarbeitung der Kriegsvergangenheit weiter verschärft. Die ambivalenten und oft auch offen apologetischen Äußerungen führender japanischer Politiker zum japanischen Imperialismus sowie der öffentlich vorgetragene Geschichtsrevisionismus müssen Chinesen und Koreaner fast zwangsläufig an die historisch erlittenen nationalen Demütigungen durch Japan erinnern. Diese langen Schatten des „kurzen 20. Jahrhunderts“, das als „Zeitalter der Extreme“ in mancher Hinsicht auch für Japan und Ostasien im Ersten Weltkrieg begann, reichen noch heute sogar bis in Fußballstadien. Dort zeigten südkoreanische Fans während eines Spiels ihrer Mannschaft gegen Japan beim Ostasien-Cup im Juli 2013 ein übergroßes Banner mit der Aufschrift „Ein Volk, das seine Geschichte nicht kennt, hat keine Zukunft“. Ein gemeinsames Erinnern an den Ersten Weltkrieg und dessen vielfältige – auch positive – Folgen für Japan und Ostasien könnte einen großen Schritt in Richtung Aussöhnung und friedlicher Koexistenz bedeuten.
Torsten Weber ist seit April 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIJ Tokyo. Er forscht zur modernen Geschichte Ostasiens mit Schwerpunkt auf Asiendiskursen und Geschichtspolitik. Am DIJ leitet er das Forschungsprojekt „Sozio-politische Glücksdiskurse im imperialen Japan“.
Quelle: http://grandeguerre.hypotheses.org/1418