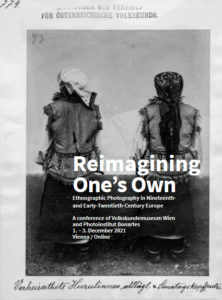Die freie Zugänglichkeit und dauerhafte Nachnutzung von Forschungsdaten nach den derzeit hoch im Kurs stehenden FAIR-Prinzipien sind nicht nur für aktuelle Forschungsprojekte bedenkenswerte Ziele. Sie können genauso für alternde digitale Projekte Anwendung finden, bei denen eine Datenkuratierung im Hinblick auf Verknüpfung mit Metadaten und Zugänglichkeit notwendig ist und die verwendete Weboberfläche zur Abfrage nicht mehr den Konsultations- und Ergonomiestandards des gegenwärtigen Web entspricht. Am DHIP gibt es gleich mehrere solcher Projekte: über die in Kooperation mit dem Institut für Digital Humanities in Köln neu aufgesetzte Datenbank “Adressbuch der Deutschen von 1854” wurde hier im Blog schon berichtet. Im Folgenden geht es um die Erschließungsdatenbank der Korrespondenz der Constance de Salm (1767-1845).

Das Schicksal dieser Projekte ist aus meiner Sicht deshalb interessant, weil es in mancher Hinsicht typisch sein dürfte für digitale Projekte aus den 2000er und frühen 2010er Jahren.
[...]