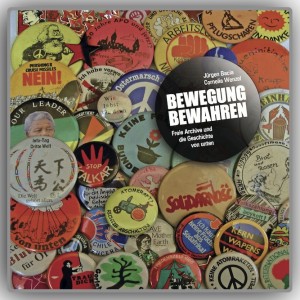Straßennamen sind Orte der Erinnerung. Sie halten Personen, Orte und Ereignisse im öffentlichen Raum gegenwärtig. An wen oder was erinnert wird – das liegt nahe – steht bei Untersuchungen von Straßennamen folglich im Vordergrund. Genauso interessant ist der Zeitpunkt der Benennung, gibt er doch über die spezifische Erinnerungspolitik der Epoche Auskunft und über die “ideologisch-didaktische[n] Zwecke”, die damit verbunden waren1. Hinzu kommen weitere Elemente für eine Analyse, wie z.B. die geographische Lage und Länge der Straße. Bei meinen Recherchen zu den deutschen Einwanderern in Paris wurde mir klar, dass das Bild jedoch erst komplett ist, wenn auch berücksichtigt wird, welcher Name durch die Umbenennung einer Straße im öffentlichen Raum gelöscht wird.
So bekam Paris am 15. August 1914 seine Avenue Jean-Jaurès. Auf diesen Tag datiert die Verordnung des Präfekten der Seine, die am 19. August 1914 von Raymond Poincaré, Präsident der Republik, und Louis Malvy, Innenminister Frankreichs, per Erlass bestätigt wurde. Im Bulletin municipal officiel vom 22. August 1914 wurde diese Entscheidung veröffentlicht und der Innenminister mit der Durchführung beauftragt2. Mit diesem Erlass sollte nicht nur der erst rund zwei Wochen zuvor ermordete sozialistische Politiker und Historiker Jean Jaurès geehrt und in das öffentliche Gedächtnis der Stadt und ihrer Einwohner gerückt werden. Jaurès war am 31. Juli 1914, nur einen Tag vor Beginn des Ersten Weltkriegs, in einem Pariser Café bei einem Attentat ums Leben gekommen.
Es ging auch darum, alles, was an den erneuten Kriegsgegner Deutschland und seine Einwanderer erinnerte aus dem öffentlichen Raum der französischen Hauptstadt zu streichen. Das zeigt die Wahl der Straße, die umbenannt wurde: die Rue d’Allemagne im Viertel La Villette, im Norden von Paris, oben auf der Postkarte zu sehen.
In La Villette hatten sich im 19. Jahrhundert zahlreiche deutschsprachige Arbeiter und Tagelöhner niedergelassen, um in den umliegenden Chemie- und Zuckerfabriken oder in den Schlachthöfen zu arbeiten. Das Viertel hatte bis zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 den Spitznamen „Petite Allemagne“. Nach der Niederlage von Sedan wurden die über 60.000 deutschen Einwanderer aus der Stadt ausgewiesen. Die Zahl der deutschsprachigen Einwanderer stieg zwar nach dem Krieg wieder an, diese lebten aber “zerstreut und zurückgezogen” und wagten es vielfach nicht, in der Öffentlichkeit deutsch zu sprechen3.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wartete man nicht wie 1870 die Niederlage ab, um die deutschen Einwanderer des Landes zu verweisen. Gleich zu Beginn des Krieges erging der Ausweisungsbefehl. Die deutschen Schulen, Wohnheime und Einrichtungen in Paris wurden geschlossen, einige der Gebäude später beschlagnahmt. Aus der Rue d’Allemagne wurde – wie erwähnt – die Avenue Jean-Jaurès, die Metrostation Allemagne wurde in Jaurès umbenannt. Die Porte d’Allemagne erhielt den Namen Porte de Pantin. Und mit demselben Dekret vom 15.8.1914 wurde aus der Rue de Berlin die Rue de Liège, womit man den Widerstand der grenznahen belgischen Stadt honorierte, die gerade von deutschen Truppen überfallen worden war.
Bei diesem schnellen Verfahren hielt man sich nicht an die sonst übliche Vorgehensweise bei Umbenennungen von Straßen4. Nach diesem Verfahren können Vorschläge für neue Namen aus der Bevölkerung kommen. Diese werden von der 4. Kommission des Pariser Stadtrats (Enseignement – Beaux arts) geprüft und dann der 3. Kommission (Voirie de Paris, Travaux affectant la voi publique) vorgelegt, die entscheidet, welche Straße den neuen Namen erhalten soll. Der Conseil municipal berät anschließend darüber, bevor die Entscheidung vom Präfekt der Seine ratifiziert wird. Die Zustimmung des Innenministers oder gar des Präsidenten wie im vorliegenden Fall, bei dem die Umbenennung auf nationaler Ebene bestätigt wurde, war eigentlich nicht notwendig. Auch entfiel hier die Debatte im Conseil municipal, der während der Monate August, September, Oktober und November 1914 nicht tagte.
Die Begründung für den Erlass des Präfekten konnte ich bisher nicht ausfindig machen. Im Recueil des actes administratifs de la Seine ist er nicht abgedruckt und es bleibt bisher im Dunkeln, auf wen die Idee der Umbenennungen ursprünglich zurückzuführen ist. In der für solche Forschungen sehr nützlichen, aber oftmals nicht funktionierenden Datenbank Nomenclature officielle des voies de Paris gibt es dazu keine Informationen und auch im Dictionnaire historiques des rues de Paris von Jacques Hillairet stehen keine weiteren Hinweise. Aber eines ist bekannt: Seit dem Jahr 2000, nachdem Berlin deutsche Hauptstadt geworden war, taucht zumindest der Name Berlin wieder im Pariser öffentlichen Raum auf: Im 8. Arrondissement gibt es einen – wenn auch ziemlich kleinen – “Square de Berlin“. Wie dieser vorher hieß? Gar nicht, er hatte keinen Namen und gehörte einfach mit zu den Jardins des Champs-Elysées…
Literatur
Gersmann, Gudrun, Der Streit um die Straßennamen. Städtische Gedenkpolitik zwischen Französischer Republik und III. Republik, in: Dies. ua (Hg.), Frankreich 1848-1870, Stuttgart 1998, S. 43-57.
Hillairet, Jacques, Dictionnaire historiques des rues de Paris, Paris : Éd. de Minuit, 1997.
König, Mareike, Brüche als gestaltendes Element: Die Deutschen in Paris im 19. Jahrhundert, in: Dies. (Hg.), Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstmädchen in Paris. Eine vergessene Migration im 19. Jahrhundert, München 2003, S. 9-26. <http://www.perspectivia.net/content/publikationen/phs/koenig_handwerker/koenig_brueche>
Nomenclature officielle des voies de Paris, Online Datenkbank.
Posthaus, Renate, Französische Autoren in Straßenverzeichnissen (Paris, Montreuil, Saint-Etienne, Perpignan). Untersuchungen über politische und historische Gründe literarischer Kanonisierung im öffentlich-kommunalen Bereich, Staatsexamen Universität Düsseldorf 1975.
Abbildung
Postkarte: Rue et Pont d’Allemagne, Privatbesitz Mareike König, CC-BY.
- Vgl. Gudrun Gersmann, Der Streit um die Straßennamen. Städtische Gedenkpolitik zwischen Französischer Republik und III. Republik, in: Dies. ua (Hg.), Frankreich 1848-1870, Stuttgart 1998, S. 43.
- Bulletin municipal officiel, 22.8.1914, 3e trimestre, S. 1. Leider ist der Jahrgang 1914 noch nicht bei Gallica online verfügbar http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343512457/date
- Mareike König, Brüche als gestaltendes Element: Die Deutschen in Paris im 19. Jahrhundert, in: Dies. (Hg.), Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstmädchen in Paris. Eine vergessene Migration im 19. Jahrhundert, München 2003, S. 9-26
- Vgl. dazu Renate Posthaus, Französische Autoren in Straßenverzeichnissen (Paris, Montreuil, Saint-Etienne, Perpignan). Untersuchungen über politische und historische Gründe literarischer Kanonisierung im öffentlich-kommunalen Bereich, Staatsexamen Universität Düsseldorf 1975, S. 35.
Quelle: http://19jhdhip.hypotheses.org/119