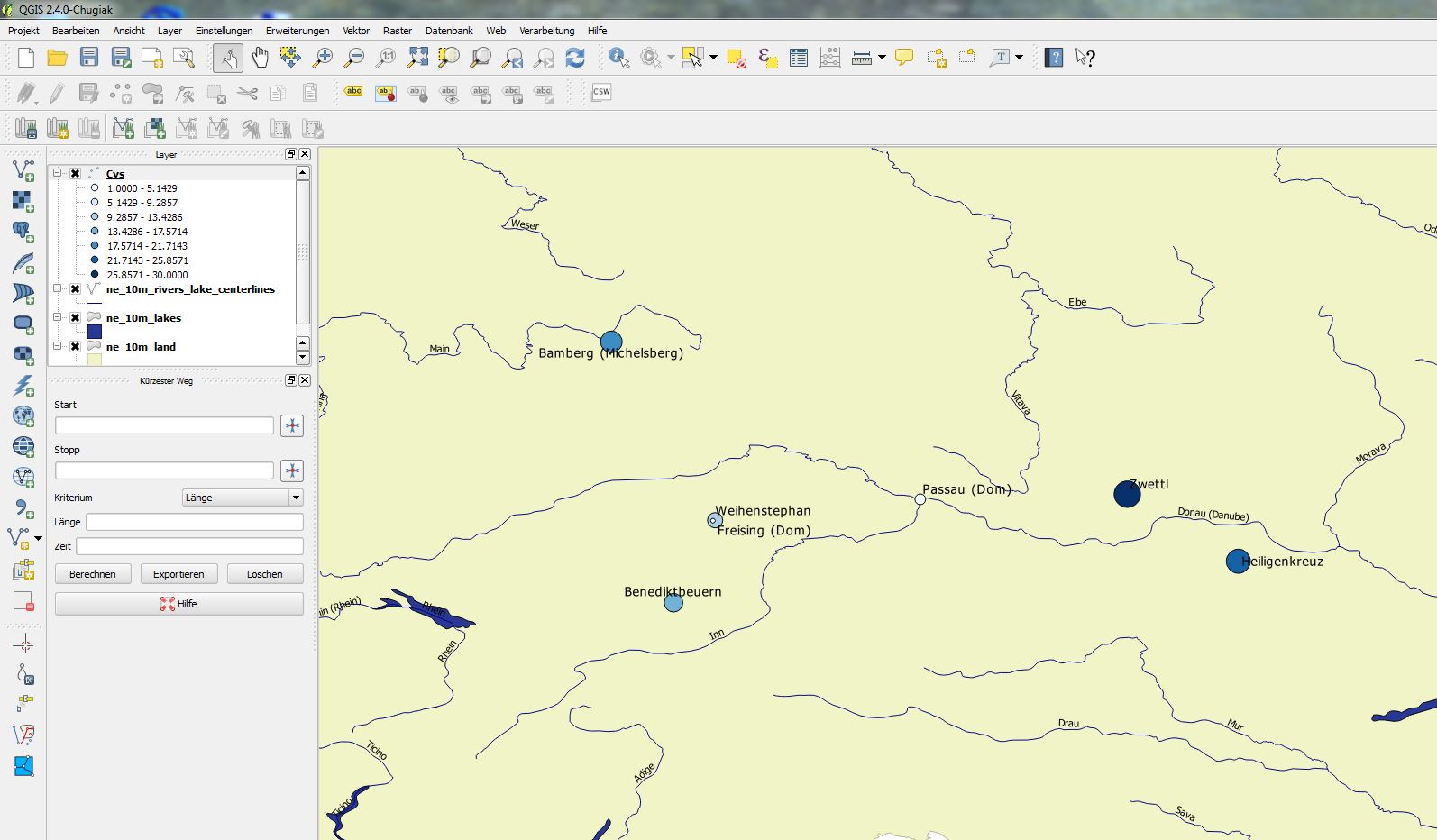Sagenhaft, dass im polnischen Sprachgebrauch das Wort „Promotion” (poln. Promocja) primär eine andere Bedeutung hat, als im deutschen. Selbst wenn man einen Akademiker fragen würde, als erste Bedeutung käme wahrscheinlich: „Das Sonderangebot“. Zwei verschiedene Inhalte auf den ersten Blick, zwei verschiedene Welten – der Handel und die Wissenschaft. Doch manchmal können sich diese im realen Leben vermischen oder sogar ergänzen. Klingt böse, aber ist es nicht tatsächlich so?
Nicht nur in Deutschland geht durch die Medien und die Gesellschaft eine Diskussion über Doktortitel. Doch in Polen ist die Debatte anders gefärbt als hier. Es ist zwar auch ein Versuch, die mutmaßliche Entwertung des Doktortitels zu diagnostizieren, doch der Auslöser der ganzen Auseinandersetzung war kein Plagiat. In den letzten Jahren beobachtet man an den polnischen Unis einen rapiden Zuwachs der Doktoranden. Im Vergleich zu den Jahren 2000/2001 (über 25.000) gab es im akademischen Jahr 2013/2014 um 72% mehr Promovierende[1]. Der Drang nach Doktortiteln hat vor allem das eine als Folge: Devaluation des Titels. Allgemein wird behauptet, dass die Uniausbildung an Wert verloren hat. Ungefähr 50% der Jahrgänge in den letzten Jahren machte Abitur, die meisten davon fingen an zu studieren, die Zahlen der Studierenden wachsen zwar nicht mehr, aber nur, weil die Jahrgänge nicht mehr so zahlreich sind. Die Unis sind überfüllt und nicht mehr elitär. Sagt man das nicht auch auf dieser Seite der Oder?
Es kommt jetzt aber nicht auf die Frage an, ob es stimmt, dass die Absolventen vor 20 Jahren besser ausgebildet waren, oder nicht. Die Gesellschaft muss sich vor allem eine andere Frage stellen: Welche Bedeutung hat diese Tendenz für unsere Verhältnisse? Die Antwort, wie auf die meisten schwierigen Fragen der heutigen Gesellschaft, ist nicht „binär“ – „ja“ oder „nein“, schwarz oder weiß. Die sich verbreitende Meinung ist durchaus berechtigt, wenn man an die Sache quantitativ herangeht. Mehr Menschen mit einem Doktortitel bedeuten einen Verlust der Aura der Auserwählten und edlen Spitzenintellektuellen. Die zwei Buchstaben vor dem Namen werden langsam fast zu Allgemeingut. Der „Drang nach Promotion“ hat als negative Folge den Anschein, dass die Doktoren immer schlechter ausgebildet werden. Es gibt kein Meister-Schüler Verhältnis mehr, die Bologna-Reform hätte aus dem akademischen Prozess der Dissertationsverfassung ein vereinfachtes Studium des dritten Grades – Promotionsstudium gemacht. Die Wahrnehmung des Doktoranden wurde dadurch entwertet. Vom anerkannten Akademiker, der seine Sachgebiete gründlich erforscht und einen Nimbus des Experten hat, zum bejahrten, ewigen Studenten, der etwas beweisen möchte, anstatt auf den Arbeitsmarkt zu gehen und für das BIP zu schuften, wie alle anderen Vernünftigen.
Interessanterweise ist die Lust am promovieren nur in der Generation der um „die Wende“ herum Geborenen erkennbar. Für die heute 40-jährigen und älteren bleibt ein Doktortitel immer noch eine besondere Auszeichnung, die nicht allen zugänglich ist. Eben das ist der Ansatz der Konflikte und Skepsis. Mehr Doktoranten sollen automatisch die schlechtere Qualität der Kandidaten in Bezug auf den Doktortitel voraussetzen. Aber die Älteren, die das sagen, spüren vielleicht auch etwas Neid – ihnen wurde die Möglichkeit zu promovieren angeblich nicht gewährt, im Gegensatz zu den Nachfolgern. Insofern könnte man diese Lage als einen neuen Aufzug des ewigen Konflikts - Jung vs. Alt - deuten. In diesem „Kampf“ „fallen“ vor allem aber die Jungen, leider auch deshalb, weil sie sich selbst in den Fuß schießen.
Die Promovierenden, statt sich über ihre Chance, einen Titel zu bekommen, zu freuen, meckern ebenfalls massiv. Früher fanden die meisten einen Arbeitsplatz an der Uni, und zwar während und nach der Promotion. Heute ist es anders. Der Doktorand wird immer öfter „Promotionsstudent“ genannt und dementsprechend wie ein Student, nicht wie ein Assistent, behandelt. Die Karriereperspektiven in der Wissenschaft sehen eher mager aus. Das ruft eine starke Stimme der Kollegen hervor, die schreien: „Wir wollen Arbeit!“. Sie sehen es aber nicht ein, dass die Zeiten der Vollbeschäftigung längst vorbei sind. Und wenn wir uns entscheiden, mehr Doktoranden auszubilden, bei gleichen Arbeitsstellenkapazitäten an den Universitäten, so muss das bedeuten, dass nicht alle an diesen noblen Institutionen Karriere nach dem gleichen Muster wie vor 30 Jahrenmachen werden. Es kommt zu einer paradoxen Erscheinung: Der junge Bürger, in den Freiheiten des Rechtstaates verwurzelt, ruft nach einem zentralisierten System der Beschäftigung nach dem Motto: Der Staat hat mich ausgebildet, dann soll er mich auch einstellen. Man verwechselt die akademische Bildung mit einer Berufsausbildung. Diese neue Lage verlangt von uns Doktoranden ein Umdenken, was aber unglaublich schwierig wird.
Nicht, weil die junge Generation stur und unflexibel auf der schon genannten Position beharrt, sondern, weil die ganze Gesellschaft nicht auf so viele junge Leute mit einem Doktortitel vorbereitet ist. Die Wirtschaft scheut sich, einen angeblich besserwisserischen jungen Doktor einzustellen, sie behauptet, ihm fehle nicht nur die Bescheidenheit, sondern auch die Erfahrung. Man muss aber der neuen Situation die Stirn bieten. Keine Arbeit an der Uni zu haben muss nicht unbedingt die Arbeitslosigkeit und Herabsetzung der Lebensansprüche bedeuten. Im Gegenteil, das kann und soll in einen Erfolg verwandelt werden. Man sollte vielleicht die Sache selbst in die Hand nehmen und etwas tun. Aber was?
Wie schon am Anfang erwähnt, die Antwort auf solche Fragen fällt nie einfach und es gibt keine sicheren Rezepte für alle. Die Zeiten verlangen von uns Kreativität und keine typische Vorgehensweise. Dessen muss sich ein junger Wissenschaftler vor allem vergewissern. Wer sich jetztalso die Hoffnung macht, dass ich hier einen Zaubertrick zeige, wie man aus der Dissertation einen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg macht, der wird enttäuscht sein. Doch eines scheint mir entscheidend zu sein: Dem Doktoranden fehlt es heute am gesunden Selbstbewusstsein. Einerseits will er einen Anspruch auf die traditionelle Anstellung an der Uni haben, andererseits schleicht er in die Büros für Vorstellungsgespräche und entschuldigt sich, dass er den „Dr.“ vor seinem Namen führt.
Der Wert der Dissertation ist nicht zu unterschätzen – das sollen sowohl die Promovierenden als auch die Arbeitgeber sehen. In Melancholie zu geraten und zu bereuen, dass man nach dem Studium doch nicht sofort auf den Arbeitsmarkt wollte, ist keine Lösung, sondern ein Anfang der wirklichen Probleme. Warum aber nicht aus dem Doktorat eine Triebkraft für die spätere Karriere machen? Möglichkeiten gibt es schon. Die Gelder für kreative junge Wissenschaftler und Unternehmer sind vorhanden, man muss sie nur ergreifen. Warum nicht aus der eigenen Dissertation ein Geschäftsmodell machen? Natürlich, eine wissenschaftliche Arbeit ist wirtschaftlich nicht immer zukunftsfähig. Doch sich in dem Elfenbeinturm der Wissenschaft zu verschließen und in die Verbitterung darüber zu geraten, das weder an der Uni noch woanders eine Arbeit möglich ist, ist kein besserer Ausweg. Man muss - leider, oder vielleicht auch zum Glück - selbst nach Möglichkeiten suchen. Ausland, Projekte, Drittmittel… das sind nur Stichworte.
Zurück zum Titel dieses Beitrags: Soll ein Doktorand sich nicht vielleicht besser „verkaufen“? Ein „Sonderangebot“ für seine Fähigkeiten ausrufen? Vielleicht doch! Das ist eine Frage der Einstellung. Die Lage ist nicht einfach. Der Arbeitsmarkt ist nicht immer auf die Doktoren vorbereitet, die Unis bieten auch nicht viel an, aber die Doktoranden legen sich doch selbst die Schlinge um den Hals, indem sie ihre Ansprüche nicht mit realen Chancen vergleichen.
Es scheint mir selbst, dass ich hier fast zu optimistisch wurde. Doch muss ein Doktorand oder junger Doktor tatsächlich bedauern, dass er den falschen Weg gegangen ist? Taxi fahren muss nicht der einzige Ausweg sein. Und obwohl ich diesen Text am Beispiel eines anderen Landes aufgebaut habe, weichen die beschriebenen Verhältnisse von den hiesigen nicht besonders dramatisch ab.
Quelle: http://unibloggt.hypotheses.org/382