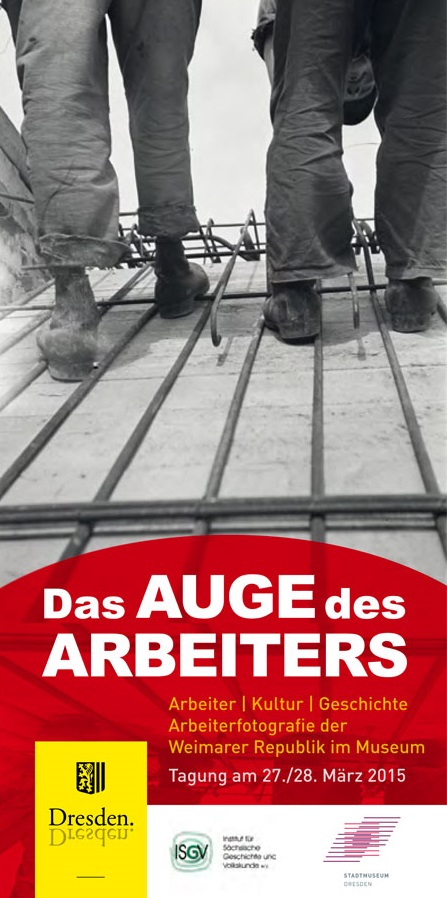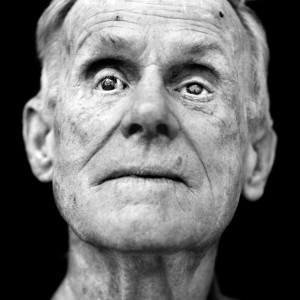Zwei Tendenzen haben innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte in der Geschichtswissenschaftan Gewicht gewonnen die „Wiederkehr des Raums“[1] – der so genannte spatial turn – und die „Wiederkehr der Bilder“ [2], auch als Iconic oder Visual Turn bezeichnet. Ein Ausstellungsprojekt im Braunschweiger Museum für Photographie führt diese beiden Strömungen nun in einer Ausstellung zusammen und fragt nach der Bedeutung des Mediums Fotografie als Mnemotechnik einer Gesellschaft. Im Vordergrund steht dabei die Region als Leitkategorie für Identitäten und Gedächtnisse. 17 Fotografinnen und Fotografen haben ihren persönlichen Zugang zur Geschichte und Gegenwart der Region Niedersachsen fotografisch festgehalten. Die Resultate werden derzeit im Museum für Photographie Braunschweig ausgestellt und parallel dazu online archiviert – als digitaler Grundstock für ein regionales Bild-Gedächtnis, das in den nächsten Jahren sukzessive wachsen soll.
Lucia Halder sprach mit der Museumsleiterin und Kuratorin der Ausstellung Dr. Gisela Parak über das Projekt.
Lucia Halder: Der vollständige Titel der Ausstellung lautet „Das regionale Gedächtnis Teil 1 – Ausstellung und Webarchiv. Ein zweiteiliges Ausstellungsprojekt mit den Mitgliedern, Freunden und Gästen des Museums für Photographie Braunschweig e. V. – was war die Ausgangsidee für das Projekt?
Gisela Parak: Wir wollten damit das Wissen unserer Mitglieder für diese Region – Braunschweig, Wolfsburg, Hannover – abrufen, um ein fotografisches Gedächtnis der Region aufzubauen. Niedersachsen ist auf der Fotolandkarte nicht so präsent. Wir schauen in diesem Zusammenhang oft etwas neidisch auf das Ruhrgebiet. Im Laufe des Projektes haben wir aber festgestellt, dass es hier zahlreiche Fotografinnen und Fotografen und auch eine beeindruckende fotografische Tradition gibt. Zum Beispiel Heinrich Heidersberger aus Wolfsburg, oder Peter Keetmann, der im Jahr 1953 inzwischen ikonisch gewordene Bilder des VW-Werks aufgenommen hat. Oder schauen Sie sich die bedeutenden Fotografien des Fagus-Werks in Alfeld an der Leine von Albert Renger-Patzsch an. Das sind Bilder, die aus dem visuellen Gedächtnis nicht mehr wegzudenken sind. Und zwischen diesen historischen Positionen und der Region, so wie sie sich heute darstellt, wollten wir mit der Fragestellung der Ausstellung eine Brücke schlagen.
Lucia Halder: Und wie generiert man ein visuelles Gedächtnis in der Praxis?
Gisela Parak: Das Projekt ist partizipativ aufgebaut. Wir haben aus dem Kreis unserer Mitglieder 17 ganz unterschiedliche Persönlichkeiten ausgewählt, die dann in drei Workshops ihr jeweiliges Konzept erarbeitet haben. Manche hatten schon genau im Kopf, was sie abbilden wollen, andere haben sich – wie im Ausstellungstitel angedeutet – auf Spurensuche begeben. Herausgekommen sind beeindruckende Auseinandersetzungen mit der Region und Ihrer Geschichte. Es gibt in der Ausstellung künstlerische Positionen, die zum um die Ecke denken einladen. Aber auch dokumentarische Fotografien. Timo Hoheisel zum Beispiel hat das Atommüll-Endlager Asse fotografiert und sich dabei von außen nach innen vorgearbeitet. Fotos erleichtern die Auseinandersetzung mit einem Ort, mit seiner Geschichte. Die Frage, was ein Ort für ein Individuum bedeutet und wo sich diese Bedeutung zeigt nutzt sich nicht ab und kann zu jeder Zeit immer wieder neu gestellt werden.

© Photomuseum Braunschweig
Das Online-Archiv beherbergt auch die historischen Sammlungen des Photomuseum Braunschweig.
Lucia Halder: Die Bilder werden archiviert und online zugänglich gemacht, es soll ein „dauerhaftes fotografisches Gedächtnis“ sein. Gedächtnis und Geschichte sind untrennbar miteinander verbunden. Welche Rolle spielt Geschichte in Ihrem Projekt?
Gisela Parak: Auf der Seite http://dasregionalegedaechtnis.de werden die Bilder eingespeist, ausführlich kommentiert und sind jederzeit abrufbar. Wir haben dort aber auch historische Bestände aus unserer Sammlung eingearbeitet. Mit den Fotografien aus der Ausstellung wollen wir nicht einfach Geschichte illustrieren, sondern einen persönlichen Zugang schaffen. Es geht nicht darum, die Region möglichst flächendeckend zu kartieren, sondern sie individuell und selektiv zu entdecken. Aber die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Region ist natürlich zentral. Braunschweig liegt im einstigen so genannten Zonenrandgebiet. Mit der ersten Ausstellung haben wir einen spannungsreichen Grundstock vorgelegt. Aber ich sehe auch Entwicklungspotential für eine weitere Ausstellung. Eine Fotografinhat eine Wagenkolonie aufgespürt, die sich exakt auf dem ehemaligen Grenzstreifen niedergelassen hat. Ein Weiterer zeichnete Spuren der Protestkultur im Wendland auf. Ein anderer Fotograf setzt sich seit Jahren mit historisch belasteten Orten aus der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. So funktioniert das Gedächtnis, man erinnert sich an etwas und findet einen eigenen Zugang, das kann ein spielerischer Zugang sein, das Resultat kann aber auch ein subjektiv-alternatives Geschichtsbild ergeben, das durchaus subversiv sein kann.
Lucia Halder: Sie sprechen also von Fotografie als sozialer Praxis…
Gisela Parak: Genau. Es geht darum, dass die Fotografinnen und Fotografen bildlich ihre Sichtweisen vorstellen. Eine der Rubriken in unserer Ausstellung ist „Architektur“. Das wiederaufgebaute Schloss in Braunschweig ist da ein prominentes Beispiel. Das Gebäude wurde rekonstruiert, im Innern befindet sich jedoch eine Shopping-Mall. Daran spalten sich natürlich die Meinungen. Durch die fotografische Dokumentation dieses Prozesses entstehen Statements. Die Fotografierenden erörtern in ihren künstlerischen Kommentaren wichtige Ereignisse, Momente und Orte der kulturellen Identität der Region.
Lucia Halder: Produktions- und Firmengeschichten stehen oft in enger Beziehung zur regionalen Erforschung von Geschichte. In Braunschweig waren einst so prägende Firmen wie Voigtländer und Rollei ansässig. Werden sie als Teil des regionalen Gedächtnisses wahrgenommen?
Gisela Parak: Die Firmengeschichten sind noch unheimlich präsent. Braunschweig bezeichnet sich gerne selbst als Fotostadt. Wichtige Firmen – Sie haben sie bereits genannt – haben hier Fotoapparate hergestellt und in alle Welt verkauft.Technikgeschichte ist jedoch aus Fotomuseen zugunsten künstlerischer Annäherungen an das Medium weitest gehend ausgegliedert. Was nicht heißen muss, dass der Aspekt komplett ausgeblendet wird. Die Deichtorhallen Hamburg widmen ihre aktuelle Ausstellung beispielsweise dem 100. Geburtstag der Leica-Kamera. Aber uns in Braunschweig geht es bei dem Projekt eher darum, zu hinterfragen, was eigentlich dran ist, an diesem Selbstbild der Fotostadt.
Lucia Halder: Der Medienwissenschaftler Knut Hickethier stellte fest, regionale Forschung gehe davon aus, „daß sich Geschichte in den lokalen und regionalen Besonderheiten manifestiert. Gegenüber dem überregionalen Allgemeinen behauptet die Region ihren Eigensinn.“[3] Was ist das besondere an der Kategorie Region?
Gisela Parak: Ich glaube, dass Ereignisse der Regionalgeschichte oftmals stellvertretend für übergeordnete Prozesse stehen können, sie tun dies aber viel persönlicher und zu Herzen gehend. Das haben wir auch schon vor zwei Jahren in der Ausstellung „Gift-Gegengift“ von Franz Wanner zeigen können. Die Fragestellung war ähnlich. Franz Wanner hat sich auf Spurensuche in dem bayerischen Kurort Bad Tölz gemacht und hat erstaunliches gefunden: Spuren der NS-Geschichte und Hinweise auf Spionageaktivitäten aus der Zeit des Kalten Krieges – Bad Tölz wurde plötzlich zum Prototyp bundesdeutscher Nachkriegsgeschichte. Und zwar nur, weil sich der Fotograf voll und ganz auf das Regionale eingelassen hatte. In jeder Region gibt es solche Beispiele, in denen sich das große Ganze wiederspiegelt, die aber auch eine gewisse Einzigartigkeit bewahrt. Regionaler Eigensinn ist etwas ganz wunderbares.
Lucia Halder: Sind historische Fotoprojekte wie beispielsweise die französischen „Mission héliographique“ von 1851, oder das Fotoprogramm der „Farm Security Administration“ in den USA der 1930 und 40-er Jahre Ideengeber für eine solche „Vermessung der Region“?
Gisela Parak: Als Historikerin habe ich natürlich ein ausgeprägtes Interesse daran, wie eine Stadt oder eine Region in der Vergangenheit funktioniert hat und wie sie heute funktioniert. Da drängen sich mir viele Fragen auf: Was ist Strukturwandel? Welche Teile der Geschichte sind noch lebendig? Was für spezifische Erinnerungsorte gibt es hier? Fotografie ist ein Medium, dass soziale Themen begleitet und reflektiert. Wir wollen unsere Mitglieder als fotografische Feldforscher in Land schicken. In der Art der Ausführung gibt es somiteine gewisse Nähe zu den von Ihnen erwähnten historischen Programmen, wenngleich die Intentionen jeweils völlig andere waren.
Lucia Halder: Ende 2015 wird das Projekt fortgesetzt. Wie geht es weiter?
Gisela Parak: Wir werden eine weitere Gruppe von Fotografinnen und Fotografen einladen, ihre Erinnerung aufzuzeichnen und auszustellen. Der Bestand soll sukzessive wachsen. Im Jahr 2016 soll das Projekt dann in eine offene Ausschreibung überführt und das Archiv geöffnet werden. Jeder ist herzlich eingeladen am Gedächtnis der Region mitzuarbeiten.
Lucia Halder: Vielen Dank für das Gespräch!


Der Fotograf Timo Hoheisel fotografierte das Endlager Asse (links). Andreas Gießelmann machte sich auf Spurensuche im ehemaligen OP-Bunker in der Celler Straße in Braunschweig (rechts). Mit freundlicher Genehmigung des Photomuseum Braunschweig.
[1] Osterhammel, Jürgen: Die Wiederkehr des Raumes: Geopolitik, Geohistoire und historische Geographie, in: Neue Politische Literatur, Jg. 43, 1998, Heft 3, S. 374–397.
[2] Boehm, Gottfried: Die Wiederkehr der Bilder. In: Gottfried Boehm (Hrsg.): Was ist ein Bild? München 1994, S. 11–38.
[3] http://www.massenmedien.de/allg/spur/hicke.htm
Quelle: http://www.visual-history.de/2015/02/16/das-regionale-bild-gedaechtnis/