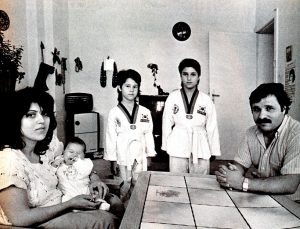Entstehung – Verbreitung – Rezeption
Jede Fotografie hat ihre eigene Entstehungsgeschichte. Eine Person drückt mit einer individuellen Intention auf den Auslöser einer Kamera: Die Linse ist dabei auf ein Motiv gerichtet, das für den Bruchteil einer Sekunde abgelichtet und konserviert wird. Vielleicht zeigt es Menschen, Tiere, Landschaften, einen Straßenzug, Gebäude oder den Wimpernschlag eines historischen Ereignisses. Als entwickelte oder digitale Fotografie begibt sich diese Momentaufnahme auf eine Reise an andere Orte und in neue Bedeutungszusammenhänge. Sie wird mit anderen Fotos in ein Album geklebt oder als Pressefotografie veröffentlicht, versehen mit einer Bildunterschrift, eingebettet in einen Text oder andere Bilder. Sie wird eingespeist in die Datenbank einer Bildagentur zusammen mit einer kurzen Notiz zu Urheber:in und Motiv, auf einer Festplatte oder in einer Cloud gespeichert, in sozialen Netzwerken geteilt, sie wird Teil eines Ausstellungsnarrativs, vielleicht auch einer Werbekampagne. Oder sie landet ganz unrühmlich schließlich als analoge Fotografie ohne Beschriftung in einer Schublade alter Erinnerungsstücke und nach vielen Jahren in einer Kiste auf dem Flohmarkt.
[...]