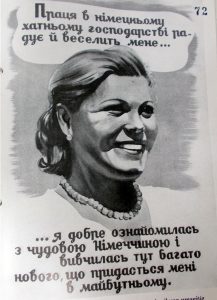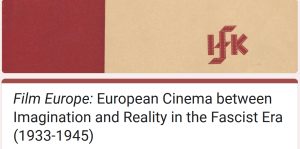Quelle: https://visual-history.de/2024/04/29/agde-bildsprache-der-besatzer/
Die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln in der NS-Zeit
 Der an der Universität zu Köln am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin lehrende Medizinhistoriker Ralf Forsbach legt eine beachtliche Monographie über die Geschichte der Kölner Medizinischen Fakultät während der NS-Zeit vor. Das mehr als 300 Seiten umfassende, reichlich bebilderte Werk ist 2023 im Böhlau-Verlag erschienen. Es ist in Bezug auf die Kölner Medizinische Fakultät die erste Gesamtdarstellung der Zeitspanne von 1933 bis 1945.
Der an der Universität zu Köln am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin lehrende Medizinhistoriker Ralf Forsbach legt eine beachtliche Monographie über die Geschichte der Kölner Medizinischen Fakultät während der NS-Zeit vor. Das mehr als 300 Seiten umfassende, reichlich bebilderte Werk ist 2023 im Böhlau-Verlag erschienen. Es ist in Bezug auf die Kölner Medizinische Fakultät die erste Gesamtdarstellung der Zeitspanne von 1933 bis 1945.
Die Studie ist klug strukturiert. Besonders erwähnenswert sind die Übersichtstabellen, die unter anderem die Parteimitgliedschaften der involvierten Akteure penibel dokumentieren. Die innerhalb des Haupttextes angebrachten Steckbriefe sorgen für Übersichtlichkeit.
Das Buch gibt Aufschluss über die Haltung der Fakultät, der einzelnen Kliniken, Institute und Fächer, beschreibt die maßgeblichen Verantwortlichen und erklärt die enge Verstrickung zwischen Fakultät, Stadt und Ministerium bei der Umstrukturierung nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Die Kölner Medizinische Fakultät entstand 1919 aus der „Akademie für praktische Medizin” als zur gleichen Zeit die Wiedergründung der Universität stattfand.
[...]
Film Europe: European Cinema between Imagination and Reality in the Fascist Era (1939-1945)
Hamburgs „Führer“ Karl Kaufmann (1900-1969). Ein Leben zwischen Macht, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Krankheit
 In der Verlagsfassung seiner 2022 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn eingereichten Dissertation beschäftigt sich der Historiker Daniel Meis mit dem Wirken des Nationalsozialisten Karl Kaufmann, der als Gauleiter Hamburgs zu den wichtigsten Akteuren der „zweiten Reihe“ in der NSDAP gehörte. Geboren allerdings wurde der Katholik Kaufmann am 10. Oktober 1900 in Krefeld und verbrachte seine prägenden Jahre in Elberfeld, war also ebenso wie sein Berliner „Kollege“ Joseph Goebbels urspünglich Rheinländer.
In der Verlagsfassung seiner 2022 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn eingereichten Dissertation beschäftigt sich der Historiker Daniel Meis mit dem Wirken des Nationalsozialisten Karl Kaufmann, der als Gauleiter Hamburgs zu den wichtigsten Akteuren der „zweiten Reihe“ in der NSDAP gehörte. Geboren allerdings wurde der Katholik Kaufmann am 10. Oktober 1900 in Krefeld und verbrachte seine prägenden Jahre in Elberfeld, war also ebenso wie sein Berliner „Kollege“ Joseph Goebbels urspünglich Rheinländer.
Zunächst ist positiv anzumerken, dass Daniel Meis darauf verzichtet, seine Einleitung umständlich mit methodischen Anmerkungen zu belasten um den biografischen Zugriff zu rechtfertigen, wie es leider in vielen biografischen Qualifikationsarbeiten geschieht. Gerade in totalitären Staaten oder Organisationen kommt man um diesen Zugang kaum herum, handelt es sich doch um Systeme, in denen individuelle Machtentfaltung einerseits und strukturelle Zwänge andererseits wesentlich stärker wirken und miteinander verschränkt sind, als es in freieren Gesellschaften der Fall ist. Im Prinzip ist Daniel Meis‘ Arbeit, wie er selber anmerkt, als Teil einer Kollektivbiografie des nationalsozialistischen Führungspersonals zu verstehen, so dass sich im Vergleich mit anderen Akteuren Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten lassen, die unser Verständnis von der Herrschaftsausübung im Nationalsozialismus schärfen können. Und dies, ohne in der Gegenüberstellung von „Polykratie“ und „Führerstaat“ zu verharren.
Der Text ist chronologisch in drei Teile gegliedert: In Kaufmanns Zeit im Rheinland, in der nach seiner Kindheit und Jugend die Karriereleiter in der regionalen NSDAP erklomm.
[...]
Quelle: http://histrhen.landesgeschichte.eu/2023/09/rezension-karl-kaufmann-kuehne/
Zwischen Kunstkonstrukt und der Tradition historischer Landschaften: Der NSDAP-Gau „Moselland“ unter Gustav Simon
Die Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr im Nationalsozialismus. Auswirkungen nationalsozialistischer Politik auf die Stadtverwaltung anhand ausgewählter Dienstbiografien

Das 2020 erschienene Werk von Kyra Sontacki befasst sich erstmals mit den personellen Folgen der nationalsozialistischen Politik auf die Stadtverwaltung von Mülheim an der Ruhr. Anspruch der Studie ist es aufzuzeigen, „wie der Nationalsozialismus Einfluss auf die Aufgaben sowie den Arbeitsalltag der Mülheimer Stadtverwaltung hatte und inwieweit die politischen Umstände in das Arbeitsleben einzelner Bediensteter hineingewirkt und die Entscheidungen der Beschäftigten beeinflusst haben“ (S. 1-2). Veröffentlicht als Band 45 der „Wissenschaftlichen Beiträge aus dem Tectum Verlag, Reihe Geschichtswissenschaft“ gliedert die Verfasserin ihre Arbeit zur Klärung dieses Themas auf insgesamt 98 Seiten logisch und sinnvoll; das übliche Problem von Struktur- und Personengeschichte, das beim Nationalsozialismus als totalitärem System besonders schwierig zu bearbeiten ist, löst sie mit einem systematischen Zugriff auf die Stadtverwaltung: Der Hauptteil zwischen obligatorischer Einleitung, historischem Kontext zu Beginn und Fazit, Interview-Anhang sowie Verzeichnissen zu Ende besitzt vier Kapitel, die strukturelle Bereiche wie das Oberbürgermeisteramt, die Feuerwehr, das Schulamt und die Stadtkasse anhand ausgewählter Dienstbiografien untersuchen.
Sontacki zeigt hierbei sehr deutlich auf, wie stark der Nationalsozialismus seinem Anspruch gemäß bis in kleinste Bereiche hineinwirken konnte. Auswirkungen hatte das sowohl auf Bedienstete der Stadtverwaltung, die selbst dem Nationalsozialismus distanziert bis negativ gegenüberstanden, als auch auf genuin durch den Nationalsozialismus ins Amt Gekommene, die mit ihm sympathisierten. Hierbei zeigt sich die Stärke der Auswahl der Dienstbiografien durch Sontacki: Sie bringt überzeugte Nationalsozialisten wie den Oberbürgermeister von 1933 bis 1936 genauso ein, wie eine Stück für Stück verdrängte jüdische Lehrerin und einen vermeintlich nur mit technischen Fragen befassten Rechnungsführer der Mülheimer Gas- und Stromversorgung. Ersichtlich wird, dass eine Einteilung in schwarz und weiß, Systemtreue und -feindschaft, nicht einfach möglich ist. Die Verfasserin kommt zum Ergebnis, „dass der Nationalsozialismus den Verlauf von Karrieren innerhalb der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr stark beeinflusste“ (S.
[...]
Ausstellung zur Haltung der deutschen Minderheit in Nordschleswig zur Besetzung 1940
Impulse zur Polizeigeschichte im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
 Im November 2022 startete im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen am Standort Duisburg die Ausstellung “Die Kommissare – Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950”. Die Ausstellung begleiten Veranstaltungen, Vorträge und Podiumsdiskussionen, deren Ergebnisse und maßgeblichen Inhalte hier dokumentiert und kirtisch kommentiert werden sollen, um so den wissenschaftlichen Diskurs um eine Polizeitgeschichte aus landesgeschichtlicher Perspektive weiter anzuregen.
Im November 2022 startete im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen am Standort Duisburg die Ausstellung “Die Kommissare – Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950”. Die Ausstellung begleiten Veranstaltungen, Vorträge und Podiumsdiskussionen, deren Ergebnisse und maßgeblichen Inhalte hier dokumentiert und kirtisch kommentiert werden sollen, um so den wissenschaftlichen Diskurs um eine Polizeitgeschichte aus landesgeschichtlicher Perspektive weiter anzuregen.
Duisburger Polizisten vor und nach der „Stunde Null“. Ein Überblick – Vortragsabend im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Standort Duisburg, am 15.11.2022
Am Abend des 15. November 2022 fanden sich knapp vierzig Interessierte im Vortragssaal des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen in Duisburg ein, um den Ausführungen des Referenten Dr.
[...]
Hefte und Zeitschrift des AKENS komplett online
Frank Omland vom Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in SH meldet, dass sämtliche Info-Hefte und Bände der „Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte“ nun online verfügbar sind.
„ich habe jetzt alle Hefte des AKENS komplett online gestellt. Sie sind nach den einzelnen Aufsätzen abrufbar, dasselbe gilt für die Berichte und Rezensionen. Heft 1 bis Heft 61, von 1983 bis 2022. Außerdem noch eine Reihe von Beiheften und Online-Veröffentlichungen.
2.274 Seiten umfassten die ersten 30 Hefte, 3.340 Seiten die nächsten 20 Hefte und seitdem in 11 Heften weitere 2.
[...]
Quelle: https://geschichtsblogsh.wordpress.com/2022/12/05/hefte-und-zeitschrift-des-akens-komplett-online/
Forschung zur Geschichte von Frauen in Nordschleswig während der NS-Zeit
Der „Nordschleswiger“ berichtete auch zuvor schon über die Arbeit von I. Friis:
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig/kriegsgeschichten-frauen-sollen-juengere-ansprechen