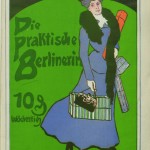Kommt Ihnen Folgendes irgendwie vertraut vor? Hier ein stark gekürzter Ausschnitt der Rede:
“Wir leben […] unter einer Verfassung, [und] dienen [uns] selber eher als Vorbild, als dass wir andere nachahmen […]. Der Name, den sie trägt, ist zwar der der Demokratie, weil die Macht nicht in den Händen weniger, sondern einer größeren Zahl von Bürgern liegt; ihr Wesen aber ist, dass nach den Gesetzen zwar alle persönlichen Vorzüge niemandem ein Vorrecht verleihen, hinsichtlich seiner wirklichen Geltung aber jeder, wie er sich in etwas auszeichnet, […] seine volle Anerkennung [finden kann]: eine Anerkennung, die nicht auf Parteigetriebe, sondern auf wirklichem Verdienst ruht. Mag daher jemand arm sein, so ist ihm doch [beispielsweise] durch keine [Chancenungleichheit wegen der] Geburt der Weg zur Auszeichnung verschlossen.
Genießen wir aber so als Bürger die volle Freiheit, so beschränken wir uns auch in unserem täglichen Tun und Treiben durch keine gegenseitige Beargwöhnung; wir betrachten unseren Mitbürger nicht mit Missmut, wenn er frei seiner Neigung folgt […]. Während wir uns aber so in unserem persönlichen Verkehr nicht belästigen, enthalten wir uns in unserem öffentlichen Leben […] jeder Übertretung der Gesetze und hören willig auf die jeweilige Obrigkeit und auf die Gesetze, und vornehmlich auf die unter ihnen, die zum Schutz der [Benachteiligten] bestimmt sind […].
Sodann haben wir für die Seele zahlreiche Erholungen von der Anstrengung geschaffen.
[...]