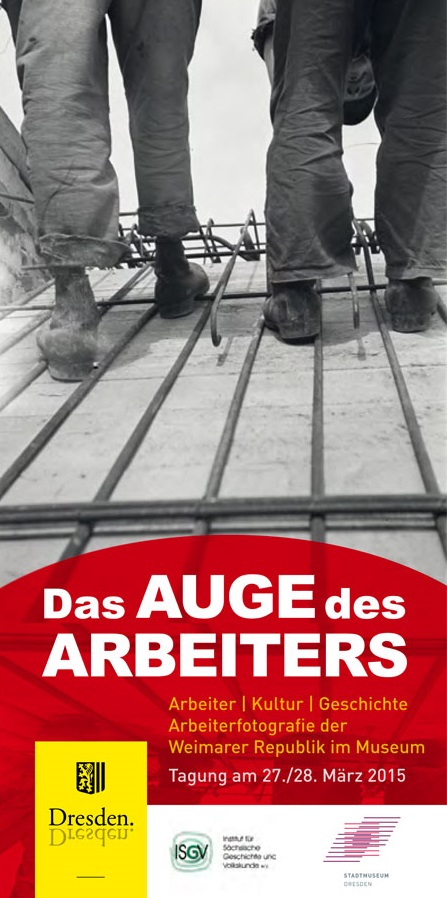Es könnte alles so einfach sein. Es war alles so einfach, bis 1809, dem Geburtsjahr des Traumschiff-Superstars und Forschers Charles Robert Darwin, dem unangepasstesten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, dem Kopernikus der Biologie. Robert entwickelte nämlich eine Theorie, die die gesamte Wissenschaft auf den Kopf stellten sollte, auch die Philosophie (ja, Philosophie ist eine Wissenschaft (ja, sie ist die Wissenschaft schlechthin)). Aber was hat er angestellt, um in die Geschichtsbücher einzugehen? Warum waren seine Beobachtungen so wichtig, dass Sie sie leicht verändert auch heute noch lehren? Wie konnten Tagebücher über Korallenriffe und Forschungen an Tieren am anderen Ende der Welt zu den bedeutendsten Werken der Wissenschaft führen?
Die Antwort ist: „The survival of the fittest“. Das müsste Ihnen ein Begriff sein. Und hier trennt sich nun die Spreu vom Weizen: Sind Sie nämlich im Investmentbanking oder im Finanzsektor tätig, dann verstehen Sie unter fittest „Bester“. Nur die Besten kommen weiter. Und Sie gehören zu den Besten, weil Sie besonders durchsetzungsstark sind. Keine Teilnehmerurkunde, eine Siegerurkunde oder gar nichts ist die Lehre, die Sie aus der Natur schöpfen können. “Du bes ne ganz welde Tiger”. Sind Sie hingegen Absolvent eines Englischstudiums oder besitzen ein Wörterbuch, wissen Sie, fittest bedeutet Angepasstester. Die Angepasstesten überleben also. Ein Hurra auf die kommende Generation!
Und warum ist das jetzt eine Revolution? Empedokles (philosophierte von 492 v. Chr. – 432 v. Chr.) hatte doch schon vor 2300 Jahren eine Evolutionstheorie entwickelt. Was hat Darwin also, was Empedokles nicht hatte? – Ich sage es Ihnen. Robert hat die platonisch-aristotelische Philosophie im Hintergrund. Anders als Empedokles hatte er die etablierte Einsicht der platonisch-aristotelsichen Ideen und Formenlehre evolviert (super passendes Wort, ne?).
Trotz der gravierenden Unterschiede der Ontologien (der Lehren vom Sein) unserer beiden zentralen Büsten waren Sie sich in einem Punkt sicher einig. Die Arten, also Mensch, Hund, Pferd, Baum, Gras, Moos waren ewig. Sie manifestierten sich in immer neuen Individuen, waren aber an sich wesentlich unveränderbar und kamen schlichtweg immer wieder auf immer gleiche Weise immer hervor. Die kleinen Unterschiede haben eine andere Erklärung (auf die wir vielleicht im nächsten Eintrag eingehen können). Dafür dass es so ist spricht zwar einiges, Darwin hat aber gezeigt, dass diese Annahmen falsch sind. Und damit hat er eine Einsicht auf den Kopf gestellt, die sich sehr lange Zeit gehalten hat. Diese Leistung kann Empedokles nicht vorweisen. Er war offenbar angepasster an seine Zeit.
Nun, wäre jemand altra-antik eingestellt, könnte er mit zwei Strategien doch noch versuchen die Ideenlehre zu retten. Nein, nicht indem er hirnlos gegen Darwin poltert. Aber wäre es nicht möglich, die Entwicklung einer Art, sagen wir des Menschen aus dem Affen als Realisierung der Idee des Menschen zu begreifen? Die antiken Mittelbüsten meinten, dass jedes Individuum zuerst wachse und dann vergehe. Die Realisierung einer Idee oder Form in einem Individuum geschehe ja nicht plötzlich, sondern bedürfe der Zeit. Wenn jemand diese Ansicht nicht auf das Individuum, sondern auf die Art als Ganze anwendet, könnte er irgendwie die Ideenlehre mit dem Darwinismus zu vereinbaren suchen. Sicherlich ein schwieriges Unterfangen.
Leichter ist der andere Versuch. Denn laut Platon gibt es über den Ideen eine weitere Stufe von „Ideen“. Diese sind die sogenannten höchsten Gattungen (Obacht, auf Griechisch: megista genê). Alle fünf höchsten Gattungen sind notwendige Bedingungen für jede andere Existenz. Es handelt sich dabei um: Sein, Identität, Differenz, Bewegung, Stillstand. Diese höchsten Gattungen (lesen Sie mal den Dialog Sophistês) gehen allem anderen voraus, jeder Existenz, jedem Lebewesen, jedem Naturgesetz. Ohne diese höchsten Gattungen kann man keine Mathematik formulieren, keinen Urknall annehmen, keine Existenz begründen. Sie sind notwendig und plausibler Weise immer da. Könnte man so eine Teilvereinbarung zwischen Darwin und den Antiken bewerkstelligen? Möchten Sie sich nicht dieser Aufgabe annehmen?
Fällt Ihnen noch eine andere Weise ein, die Ideen und Formenlehre mit dem Darwinismus zu vereinigen? Es müsste sicher Tonnen an Literatur geben, oder?
Einen guten Start in die Woche.
D.
Quelle: http://philophiso.hypotheses.org/470