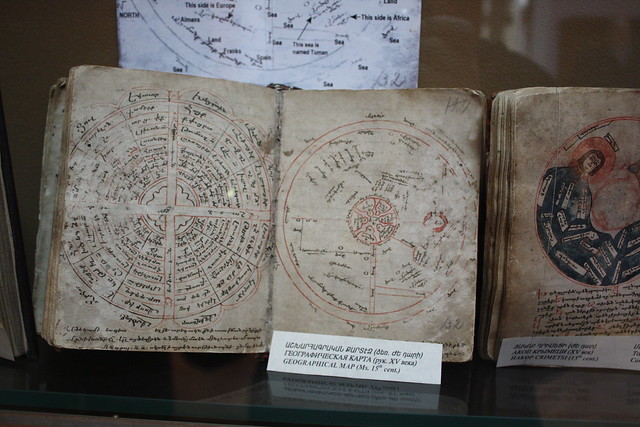Vorbemerkung
Dieser Text entspricht weitgehend den neuen Erschließungsrichtlinien des Universitätsarchivs Bayreuth, deren Erarbeitung im Juni dieses Jahres vorläufig abgeschlossen wurde. Sie sind den konkreten Umständen geschuldet, die die Praxis im Universitätsarchiv beeinflussen und können sicher nicht ohne Weiteres auf die Verhältnisse anderer Archive unverändert übertragen werden. Das Universitätsarchiv in Bayreuth ist sehr jung, das vierzigjährige Jubiläum der Universität steht 2015 ins Haus und will gefeiert werden, die laufenden Aussonderungen sind jeweils die ersten überhaupt und der Personalbestand, aus dessen Reichtum die damit verbundenen Aufgaben zu bewältigen sind, ließe sich aus medizinisch-anatomischen Gründen kaum noch reduzieren. Das Provisorium des Leistbaren auf eine solide und strategisch zielorientierte methodisch einwandfreie Basis zu stellen, war die große Herausforderung der vergangenen sechzehn Monate, und das insbesondere hinsichtlich des Gebiets der archivischen Erschließung. Mit einem gewissen Stolz konnte das Archiv Anfang Mai bekannt geben, dass mit Ausnahme der ältesten Bestände das gesamte Archiv, also alle Zugänge seit seiner Errichtung, mit Hilfe von Online-Findmitteln recherchier- und benutzbar ist. Dies war nur dadurch möglich, dass das Archiv mit einem parallelen Findmittelsystem arbeitet, das sich in Archivrepertorien und Akzessionsverzeichnisse unterteilt, wobei beide akkurat und für die Öffentlichkeit bestimmt geführt werden. Auf diese Weise konnte das Universitätsarchiv mittels eines umfassenden Akzessionsverzeichnisses und eines zusätzlichen vorläufigen Findbuchs für die Verwaltungsbestände den Zugriff auf alle Bereiche seines Magazins innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die Findmittel befinden sich auf der Internetpräsenz des Universitätsarchivs www.uni-bayreuth.de/universitaetsarchiv und im Archivportal Europa (www.archivesportaleurope.net).
Da im Universitätsarchiv aus mehreren stichhaltigen Gründen bislang keines der großen Archivinformationssysteme eingeführt wurde, muss es sich bei der Erschließung mit einer Übergangslösung behelfen. MidosaXML heißt das „Zauberwort“, das diese Not zur Tugend werden ließ. Dutzende von Archiven haben in den letzten beiden Jahrzehnten diese für kleinere und mittlere finanzschwache Archive entwickelte und modernen Erschließungsstandards als Minimallösung weitgehend entsprechende Software bei sich eingeführt. Im Universitätsarchiv Bayreuth wurde nun ein Versuch unternommen, die eigenen Ansprüche an eine moderne Methode der Erschließung mit den Möglichkeiten einer weitverbreiteten, allein auf die Erschließungstätigkeit fokussierten Standardsoftware in Einklang zu bringen. Natürlich konnte das Ergebnis nur ein Kompromiss sein. Die Ergebnisse aus der Anwendung dieses Kompromisses sind so angelegt, dass sie von Software mit umfassenderen Möglichkeiten auf der Grundlage erprobter Austauschformate nachnutzbar sind und weiter vervollkommnet werden können.
A. Einleitung
Die Grundlage für die Erschließung im Universitätsarchiv Bayreuth ist ein Metadatenmodell, das auf der obersten Ebene aus den Entitäten „Akteure“, „Funktionen“, „Archivgut“ und „Repositorium“ besteht. Für jede der Entitäten hat der Internationale Archivrat (ICA) Beschreibungsstandards veröffentlicht. Sie bilden den Orientierungsrahmen für die Erschließungsrichtlinien. 
Institutionelles Provenienzprinzip
Mit der ISAD(G)-konformen oder an diesen Standard angelehnt normierten Erschließungspraxis wird Archivgut in Kontextkategorien beschrieben und präsentiert. Traditionell bildet die Erschließung primär den Kontext der körperschaftlichen Provenienz ab, indem die Abgrenzung und Gliederung der Archiveinheiten der unterschiedlichen Verzeichnungsstufen von der Absicht bestimmt ist, die Einheit und Struktur von Schrifgutbildnern im Archiv und in den Findmitteln zu spiegeln. Auf diese Weise verfolgt die Erschließung das Ziel, den Entstehungszusammenhang von Archivgut transparent und methodisch einfach nachvollziehbar zu machen, woraus sich für den Nutzer eindeutige Kriterien für eine erfolgreiche Recherche ableiten lassen.
Durch die Integration von Angaben zu Vorprovenienzen in die Verzeichnung nähert sich die Erschließung einer weiteren Kontextbeschreibung. Das Augenmerk richtet sich dabei auf die Dokumentation der historischen Entwicklung des ursprünglichen Gebrauchs der Unterlagen, bevor sie ins Archiv gelangten. So geben die Informationen über Provenienzen Auskunft über die Entstehung und Nutzungsgeschichte des Archivguts.
Funktionen im Findmittelsystem
Fragt man danach, wofür Archivgut ursprünglich gebraucht wurde, so fragt man nach Funktionen und Aufgaben der Schriftgutbildner, deren Wahrnehmung die Entstehung von Unterlagen verursacht hat. Johannes Papritz forderte, dass die archivische Titelaufnahme „allein auf Erkenntnis und Wiedergabe des Entstehungszweckes ausgehen“ dürfe.[1] Diese Form der Verzeichnung kommt der Beantwortung der Frage schon sehr nahe. Indem bei der Verzeichnung der Betreff einer Archiv- oder Archivalieneinheit wiedergegeben wird, spiegeln sich dabei idealerweise die Funktionen, die der Schriftgutbildner im Einzelnen wahrgenommen hat, und zwar unabhängig davon, ob er dazu ein Mandat hatte oder nicht. Funktionen und Mandate bilden einen Kontextbereich, den zu kennen für das Verständnis von Archivgut essentiell ist. Auf seine Darstellung und Recherchierbarkeit muss die archivische Erschließung daher besonderen Wert legen. Eine Annäherung in der Formulierung der Titel reicht dafür nicht aus. Die Funktion muss klar und einheitlich an einer dafür bestimmten Stelle im Findmittel(system) benannt werden. Um sie übergreifend recherchierbar zu machen, muss ihre Bezeichnung und Beschreibung in standardisierter Weise erfolgen. Die traditionelle Erschließung sieht das nicht vor.[2] Auch ISAD(G) beinhaltet außerhalb des weiten Sektors der Verwaltungsgeschichte (Abschnitt 3.2.2) keinen klar definierten Bereich für die Aufnahme von Funktionen. Im derzeitigen EAD-Profil der Software MidosaXML ist seit einiger Zeit ein „Kompetenzenindex“ verfügbar, der in XML als <function> kodiert wird. Im APEx-Projekt wird die Integration von Funktionen ins Findmittelsystem diskutiert. Ein EAC(CPF)-Profil, das derzeit für das Archivportal Europa erarbeitet wird, beinhaltet demnächst ebenfalls ein <function>-Feld. Jedoch hat sich die parallele Erschließung von Archivgut in EAD- und Beschreibung von Schriftgutbildnern in EAC-Normdateien in Deutschland bislang nicht ansatzweise durchgesetzt. Als Instrumentarium müsste demnach zur Beschreibung jenes Kontextbereichs bis auf Weiteres eine geeignete Stelle innerhalb des klassischen Findbuchs dienen, möglicherweise in einer Art, die der derzeitigen Lösung in MidosaXML ähnelt oder entspricht.
Die skizzierten und in gegenseitiger Wechselwirkung stehenden Kontextbereiche „Entstehung“, „Gebrauch“, „Funktionen“ werden bei der traditionellen Erschließung in der Findbucheinleitung dargestellt. Die Entstehungs- oder Verwaltungsgeschichte (bei Nachlässen die Biographie), die Bestandsgeschichte sowie der Abschnitt über die Ordnung des Bestands sind die dafür einschlägigen Kapitel.
Den Hauptteil des klassischen Findbuchs bildet die Titelliste oder das Inhaltsverzeichnis eines Bestands. Durch seine klassischerweise hierarchische Strukturierung priorisiert es bestimmte Kontextkategorien gegenüber anderen. Ist der Bestand nach solcher Manier äußerlich durch die Gemeinsamkeit der institutionellen Provenienz abgegrenzt, so wird er nach innen gewöhnlich entweder nach oder in Orientierung an dem Registratur- oder dem Fondsprinzip gegliedert.
Bestand als beziehungsbegründetes Konzept
Ob zuerst der Auftragsnehmer oder der Auftrag existierten, ist so unerheblich wie der gleichartige Streit über die Existenz von Henne und Ei, wenn es darum geht, Bestandsabgrenzungskriterien zu formulieren. Immerhin ist es nicht vorstellbar, dass Archivgut nicht aus der Wahrnehmung einer definierbaren Aufgabe oder Funktion entstanden ist. Genauso unvorstellbar ist es, dass bei der Entstehung des Archivguts – und damit bei der Ausübung einer entstehungsursächlichen Funktion – kein Akteur beteiligt gewesen sei. Die Abgrenzung eines Bestands nach institutioneller oder funktionaler Provenienz sollte demnach zwei gleichberechtigte, sich gegenseitig ergänzende Alternativen für die Tektonik eines Archivs bedeuten. Indem diese Gleichberechtigung anerkannt wird, wird offenbar, dass es letztlich Beziehungen und Beziehungsformen sind, die einen Bestand als solchen abgrenzen und definieren. Die vielseitigen Entstehungs- und Nutzungskontexte eröffnen aber eine Vielzahl weiterer provenienzbegründeter Kontextkategorien, so dass die Tatsache, dass ein Archivale einer kaum begrenzbaren Zahl von Beziehungsgemeinschaften angehören kann, zur Kausalität dafür wird, dass der Bestandsbegriff ein konzeptualer ist, nicht aber eine fixe physische Aggregation von Archivgut meint. Es ist nicht zwingend nötig, seitens des Archivs bestimmte Kontextkategorien durch die Bildung von Tektonikstrukturen zu priorisieren. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, kann die Generierung von Textoniken, von Beständen und Bestandsstrukturen auf der Grundlage von nutzungsvorhabensspezifischen Beziehungspriorisierungen weitgehend oder ganz dem Nutzer überlassen werden.[3] Bis auf weiteres wird das Universitätsarchiv aber Tektoniken erzeugen und sie als (Einstiegs-)Angebote zur Verfügung stellen.
Indexierung und Charakter der Verzeichnungsstufen
Um Beziehungsgemeinschaften visualisierbar mit Hilfe einfacher Erschließungswerkzeuge zu erfassen, kann man sich mit einer umfänglicheren Indexierung behelfen. So sollte jede Verzeichnungseinheit mindestens mit Angaben zu End- und zu Vorprovenienzen sowie zu Funktionen, Subfunktionen und Aufgaben, die für die Entstehung des Archivale ursächlich waren, versehen werden. Damit wird gewährleistet, dass eine virtuelle Ordnung des Bestands wenigstens nach Funktionen und Provenienzen auch bestandsübergreifend und auf der Basis der Verzeichnungsdaten jedes einzelnen Archivale (und nicht nur auf der Grundlage von Verzeichnungsdaten auf der Ebene des Bestands) ermöglicht werden kann. Auch ist das die Basis dafür, dass die Archivalien in ein Recherchesystem eines Conceptual Reference Model (CRM) sinnvoll einbezogen werden können, was bei der Bereitstellung der Erschließungsdaten in Portalanwendungen eine Rolle spielen kann. Um Archivgut zahlreichen Relationen eindeutig und darstellbar zuordnen zu können, ist es wichtig, die Verzeichnungseinheiten nicht zu weitläufig abzugrenzen, sondern eine Definition in eher kleineren Einheiten vorzunehmen, ggf. mit Untereinheiten wie File und Subfile oder Akt und Vorgang zu arbeiten. Es sollte bedacht werden, dass die Einrichtung einer Klasse oder Gliederungsstufe nach Möglichkeit nicht den Rang einer Serie einnimmt, sondern dass sie der angewandten Seriendefinition gerade nicht entspricht. Während eine Serie als archivalische Kompositionsstufe eine genuine Archivalien- oder Archivguteinheit darstellt, ist die Klasse oder Gliederungsstufe eine sekundär definierte Archiveinheit. Wird eine Registraturtektonik als Bestandstektonik übernommen, ist zu prüfen, ob die dadurch entstehenden Klassifikationseinheiten den Rang von Archivgutkompositionen haben. Dann sollen sie wie Kompositionsstufen behandelt und ggf. als Serien verzeichnet werden. Andernfalls dienen sie der Erhellung des weiteren Nutzungskontexts und spiegeln die Verwaltung und Organisation des Records Management und seine Grundsätze.[4] Als solche sind sie keine Kompostionsstufen von Archivgut, sondern Kontextinformation zur Bestandsgeschichte, die der Erläuterung der ursprünglichen Ordnung und Nutzung dient. Sie werden bei der Verzeichnung als Altsignaturen mit den dazu gehörenden Erläuterungen und in den Verweisen auf Registraturschemata festgehalten. Sobald der Archivar demnach eine Einheit zu verzeichnen hat, die als Ganze eine Komposition darstellt, die selbst als Archivale (und nicht als Tektonikeinheit) verstanden werden soll bzw. muss, soll er in MidosaXML mit den Verzeichnungsstufen Serie, Akt und Vorgang arbeiten und Klasse und Teilbestand nicht verwenden. Die Klassifikation aus Tektonikeinheiten des Archivs bzw. der Registratur soll sich im Index und in den Sortierfeldern befinden (analog einer externen Klassifikation, wie sie teilweise in anderen Softwareprodukten üblich ist; vgl. das frühere MidosaOnline).
Kleinste funktionale Einheit als kleinste Identifikationseinheit
Als nächstes gilt es abzuwägen, ob das Verhältnis von Serie und Akt oder von Akt und Vorgang jeweils besser geeignet ist, um dem Ziel der Verzeichnung im Einzelfall zu entsprechen. Dabei muss man sich von der Vorstellung lösen, dass die deutsche Bezeichnung dieser drei Verzeichnungsstufen mit den gleichnamigen Kompositionsstufen von Archivgut identisch sein müsse. Besser entsprechen die englischen Begriffe Series, File und Subfile einer neutralen Terminologie der Verzeichnungsstufen. In der Praxis werden die für Signaturen vorgegebenen Einstellungen der benützten Erschließungssoftware Einfluss auf diese Entscheidung haben. Daher sollte man sich mit seinem Softwareanbieter abstimmen, ob Signaturfelder auf den Ebenen Serie, Akte und Vorgang vorhanden sind und ob sie – idealerweise – optional aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Vergabe von Signaturen ist geeignet, ein Archivale im Findmittelsystem als nicht mehr weiter aufzuspaltende Einheit zu konstituieren. Das kann Folgen für die Zuordnungen von Funktionen und Beziehungen haben. Sie können für tiefere Kompositionsebenen des mit einer Signatur versehenen Archivale nicht mehr mit eindeutig identifizierbarem Archivgut verknüpft werden. In der digitalen Archivierung ist dies bei der Abgrenzung der AIPs zu bedenken. Geht man von der Annahme aus, dass es das Wesen von Akten (records) sei, einzelne Handlungen (transactions) oder bloße Informationsfixierungen (documents) in eine inhaltliche und zielgerichtete Beziehung zueinander zu setzen, ja dass dadurch erst Akten entstehen und als solche bezeichnet werden können, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit, als kleinste unteilbare archivalische Einheit den Umfang vorgangs- oder gar nur dokumentenartigen Niederschlags zu identifizieren (und demzufolge mit einem Identifikator zu versehen), der vollständig aus der Wahrnehmung je einer von potentiell gleichzeitig beliebig vielen ebenso zutreffenden Funktionen (oder Subfunktionen) entstanden ist. Die Vielzahl der möglichen Relationen, die auf eine solche Archivalieneinheit zugreifen, ergeben die Vielzahl der „archival bonds“, in denen sie steht, und damit die Vielzahl konzeptualer Akten (records), die die Handlungen und Handlungskontexte der sich darin findenden Akteure greifbar machen.[5] Diese Zusammenhänge der Identifizierung von Archivalien- und Archiveinheiten lassen sich auch auf andere Kompositions- und Verzeichnungsstufen übertragen. Die Identifikation von kleinsten funktional bestimmten Kompositionsformen und die Identifikation ihrer archival bonds können als die beiden Pfeiler gelten, die die Praxis der archivischen Erschließung bestimmen sollen. Archivische Erschließung schafft auf diese Weise die Voraussetzungen für ein endnutzerorientiertes digitales Informationsmanagement. Hier werden pragmatische Kompromisse einzugehen sein, so dass diese Wegweiser eher strategischen oder Grundsatzcharakter hinsichtlich der Formulierung der Richtlinienspezifikationen für die jeweiligen Erschließungsvorhaben beweisen werden.
Instrumente für die Erschließungspraxis
Um archivische Erschließung in der Praxis (bereits kurzfristig) ausführen zu können, werden folgende Instrumente benötigt:
- Identifikation von Funktionen:
Die Funktionen und Subfunktionen des Schriftgutbildners müssen ermittelt und beschrieben werden. Es muss festgelegt werden, mit welchem Begriff oder Sigel sie einheitlich in der Archivgutbeschreibung zitiert werden, zum Beispiel bei der Indizierung. Die Beschreibungen der Funktionen dienen als Normdatensätze. Deshalb ist es wichtig, den Prozess der Funktionsidentifikation mit gleichartigen Archiven oder Repositorien ähnlicher Schriftgutbildner zusammen anzugehen und die so entstandenen Normdateien übergreifend verfügbar zu machen (linked open data, ISDF). - Identifikation von Akteuren und Akteursgruppen:
Vor und während der Archivgutverzeichnung sind Akteure zu kennzeichnen, die in Normdatensätzen beschrieben und mit dem Archivgut verknüpft werden sollen. Die ausgewählten Akteure werden Beschreibungsobjekte des Findmittelsystems, indem ihre Beziehungen zu Funktionen und Archivgut ebenfalls beschrieben werden. - Relationenkatalog:
Zur Beschreibung der Beziehungen zwischen Funktionen, Akteuren und Archivgut untereinander und innerhalb der eigenen Gruppe ist ein Katalog von Eigenschaften und Handlungen vonnöten. Zahlreiche Ansätze dafür sind in den traditionellen Findmitteln bereits in anderer Gestalt enthalten. So bedeutet die Inbeziehungsetzung von Provenienzstelle und Archivgut beispielsweise, dass eine Institution bei der Ausübung einer Funktion das Archivgut erzeugt hat. Wird hier die betreffende Funktion in den Kompetenzenindex aufgenommen, so sind die wichtigsten Aussagen über das Verhältnis zwischen einem Akteurs, einer Funktion und einem Archivale getroffen. Komplizierter wird es bei einer ebensolchen Beschreibung für einen Akteur, der nicht Schriftgutbildner ist und damit in die klassischen, den traditionellen Findmitteln inhärenten konkludenten Beziehungsmodelle nicht hineinpasst. Spätesten hier erscheint es sinnvoll, RDF-Komponenten in die Erschließungspraxis zu übernehmen.
Um mit der Erschließung im dargelegten Sinne kurzfristig beginnen zu können, kann zunächst auf den Relationenkatalog verzichtet und die wichtigsten Relationen über die Nutzung der üblichen Indextypen und Felder zur Provenienzangabe festgehalten werden. Insofern kann der Relationenkatalog zunächst mit einem Thesaurus der möglichen Indexbegriffe kompensiert werden.
[1] „Für die archivische Titelaufnahme bedeutet das, daß sie im Sinne des Provenienzprinzips und der sich daraus ergebenden Konsequenzen allein auf die Erkenntnis und Wiedergabe des Entstehungszweckes ausgehen darf. Entsprechen alte Titel ausnahmsweise dieser Forderung nicht, so müssen sie entsprechend verändert oder ergänzt werden.“ (Johannes Papritz, Archivwissenschaft, Bd. 3, Marburg, 2. Aufl., 1983, S. 265 (Nachdruck von 1998 = Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Nr. 3).
[2] Dies ist angesichts der großen Bedeutung, die den Funktionen Im Rahmen der Archivgutbeschreibung in der Archivwissenschaft seit langem zugemessen wird, umso erstaunlicher (vgl. u.a. bereits Jenkinson, Scott und viele andere).
[3] Vgl. hierzu den Hinweis Greg Bak’s (Continuous classification: capturing dynamic relationships among information resources, Archival Science (2012) 12:287-318; hier: S. 308) auf die Rekonzeptualisierung von Provenienz in Chris Hurley’s Theorie von der parallelen Provenienz („parallel provenance“), nachzulesen u.a. in: Hurley, Parallel provenance (if these are your records, where are your stories?). – Online-Publikation des Autors, 2005: http://infotech.monash.edu/research/groups/rcrg/publications/parallel-provenance-combined.pdf.
[4] Peter Horsman bezeichnet die beiden Kontextbereiche als „Documenting“ einerseits und „Recordkeeping System“ andererseits und weist auf ihre gegenseitige Nähe und Verschränkung hin (Horsman, Wrapping Records in Narratives. Representing Context through Archival Description. – Bad Arolsen, 2011: https://www.its-arolsen.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Archivtagung/Horsman_text.pdf).
[5] Vgl. Luciana Duranti: „Documents that are expressions of a transaction are not records until they are put into relation with other records, while documents that are not expressions of a transaction become records at the moment when they acquire an archival bond with other documents participating in the same activity.“ Die Generierung konzeptualer Akten findet sich bereits 1996 in der Argumentation von David Bearman, der forderte, dass Akten in elektronischen Dokumentenmanagementsystemen (DMS) erst auf eine spezifische Anfrage hin aus den einzelnen Dokumenten zusammengesetzt werden sollten (Bearman, Item level control and electronic recordkeeping. Arch Mus Info 10(3): 195-243). Clive Smith beschrieb den digitalen „virtual file“ bereits 1995: „In such an electronic environment, the correspondence file or dossier takes on a new dimension. It no longer exists physically, but only as a collection of electronic documents that are assembled through some search criteria, and it exists only as long as the search is maintained. A single document may participate in several such virtual files.” (Smith, The Australian series system. Archivaria 40:86-93; hier: S. 92). Dazu ist zu ergänzen, dass es entscheidend für die Aussagekraft des „virtual file“ ist, dass den von Smith erwähnten „search criteria“ geeignete und bei den „search“-Vorgängen fortzuschreibende Metadaten zugrunde liegen. In ähnlicher Tradition vertrat zuletzt u.a. Greg Bak die Ansicht, elektronischem Records Management und digitaler Archivierung entspräche wesensmäßig ein “item-level management” am besten (Bak, Continuous classification: capturing dynamic relationships among information resources, Archival Science 12.2012, S. 287-318).