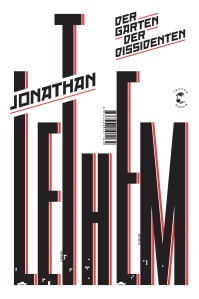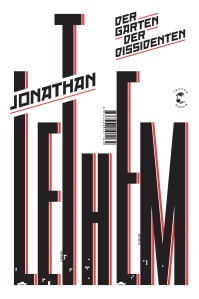An das Vergessen erinnern
Kaum scheint uns alles zuhanden, müssen wir es auch schon wieder loswerden. Kaum ist die jüngste Medienrevolution entlarvt worden, doch nicht der Eintritt ins Paradies gewesen zu sein, müssen wir uns auch schon mit ihren höllischen Folgewirkungen herumschlagen. Kaum scheint es uns gelungen, schier endlose Mengen an Daten und Informationen halbwegs dauerhaft für einen erheblichen Teil der Menschheit verfügbar zu machen, sind wir uns nicht mehr sicher, ob das auch wirklich alles gewusst werden soll. Kaum glauben wir die Möglichkeiten an der Hand zu haben, an alles erinnern zu können, fällt uns auf, wie wichtig es ist, auch mal vergessen zu dürfen.
Am Beispiel des Rechts auf Vergessenwerden im Internet, das nun schon seit geraumer Zeit vor allem unter juristischen Vorzeichen diskutiert wird, lässt sich nicht nur einiges über unser Verhältnis zum „Neuland“-Medium lernen, sondern werden auch die temporalen Probleme offenbar, die jede Verschiebung im medialen Ensemble mit sich bringt.
Das Recht auf Vergessenwerden entweder einzufordern oder vehement abzulehnen, zeigt nicht zuletzt die widersprüchlich erscheinenden Folgewirkungen einer Demokratisierung von Informationen an (von Wissen würde ich hier ausdrücklich noch nicht sprechen wollen). Bei dem Versuch, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung an der res publica, an den öffentlichen Angelegenheiten teilhaben zu lassen, setzt man nicht ganz zu Unrecht auf den Zugang und die Verbreitung entsprechender Informationen durch geeignete Medien. Mit dem Internet verband sich ja die Hoffnung, auf eben diesem Weg einen gehörigen Schritt weitergekommen, wenn nicht sogar bereits am Ziel angekommen zu sein. Wie sehr sich eine solche Hoffnung inzwischen als Illusion herausgestellt hat, können wir seit Jahren auf unterschiedliche Art und Weise erfahren. Erstens gibt die Kontrolle über das Medium immer noch ausreichende Möglichkeiten an die Hand, um zu bestimmen, was eine wie auch immer geartete Öffentlichkeit erfahren darf und was nicht. Zweitens bringt das Internet ganz neue Formen zur Herstellung von Arkanpolitik und Geheimwissen hervor, die zuvor überhaupt nicht möglich gewesen waren (worauf wir dann wieder durch Whistleblower hingewiesen werden). Und drittens schlägt die Demokratisierung von Informationen weniger bei den res publica als vielmehr bei den res privata durch. Und genau hier, bei den intimen Angelegenheiten, die nicht von allen problemlos in Erfahrung gebracht werden sollen, wird das Recht auf Vergessenwerden akut – beim peinlichen Partyfoto, dem Urlaubsvideo in allzu leichter Bekleidung oder einem despektierlichen Blogeintrag.
Stellt sich natürlich die Frage, was man höher bewertet wissen möchte, den freien und demokratischen Zugang zu Informationen oder die Wahrung der Privatsphäre. Zur Diskussion steht dann eine Grenzziehung, die sich niemals endgültig fixieren lässt, nämlich zwischen dem Beginn des Privaten und dem Ende des Öffentlichen. Müssen es sich Prominente gefallen lassen, dass ihre Urlaubsbilder im Netz verfügbar sind, weil es sich um Personen des öffentlichen Lebens handelt? Haben Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an den gefilmten Alkoholexzessen ihrer Angestellten, weil davon ihr Unternehmen unmittelbar betroffen ist? Hier steht nichts weniger auf dem Spiel als die Frage nach der Entgrenzung jedes einzelnen Lebens in die Allgemeinheit hinein.
Forget it!
Aber das ist ja nur die aktualitätsfixierte Seite des Themas, nur derjenige Aspekt, der Schlagzeilen zu produzieren verspricht, weil Semi- oder Vollprominente Gerichtsprozesse anstrengen oder in der Rubrik „Vermischtes und Skurriles“ junge Menschen auftauchen, die beim Bewerbungsgespräch mit ihrer nicht lebenslauftauglichen Vergangenheit konfrontiert werden. Daneben und darunter spielen sich aber andere Auseinandersetzungen um Grenzziehungen ab, die weniger das Private/Öffentliche, sondern eher das Gestern/Heute/Morgen und das Vergessensollen/Erinnernmüssen betreffen. Kann man also Vergessen dekretieren? Schließlich kennen wir alle diesen Gag aus der Psychologen-Trickkiste für blutige Anfänger: Was passiert, wenn man jemanden auffordert, auf gar keinen Fall an den rosa Elefanten zu denken? Eben…
Alle Formen der Zensur können von diesem Dilemma ein Lied singen. Gerade dann, wenn man es sich als Wahrer von guter Ordnung, Moral und Sitte zum Ziel gesetzt hat, eine bestimmte Verlautbarung, die gegen diese selbst gesetzten Prinzipien verstößt, in ihre Schranken zu weisen, gerade dann erfährt diese Verlautbarung besondere Aufmerksamkeit. Wenn man auf gar keinen Fall vergessen werden will, sollte man sich also intensiv darum bemühen, dass einen andere vergessen machen wollen – dann erhöht sich die Chance deutlich, erinnert zu werden. Womit wir auch schon beim nächsten Problem angelangt wären, inwieweit nämlich Vergessen entweder ein aktiver oder passiver Vorgang ist. Kann man sich tatsächlich dazu zwingen, etwas zu vergessen (siehe rosa Elefant) oder muss man nicht warten, bis bestimmte Erinnerungen durch andere überlagert werden?
Weil das aktive Vergessen auf einer individuellen und kognitionstheoretischen Ebene füglich zu bezweifeln ist, konnte Umberto Eco in einem viel zitierten Beitrag (aber welcher Beitrag von ihm wäre nicht viel zitiert?) auch zurecht behaupten, dass man eine Kunst des Vergessens vergessen könne. [1] Die Befürworter eines Rechts auf Vergessen könnten dem entgegnen, dass es ihnen darum auch gar nicht gehe. Die Kunst zur Auslöschung bestimmter individueller Gedächtnisinhalte interessiere sie gar nicht, vielmehr gehe es darum, bestimmte Inhalte für das kollektive Gedächtnis unzugänglich zu machen. Und damit wäre dann auch eine wichtige Präzisierung in der gesamten Diskussion um das Recht auf Vergessenwerden im Internet erreicht. Um das Vergessen geht es nämlich überhaupt nicht. Es geht nur darum, die Verbindungen zu kappen und die Spuren zu löschen, die zu bestimmten Inhalten hinführen könnten, und das vor allem bei der wichtigsten Suchmaschine Google. Vergessen wird hier also gar nichts, es wird höchstens das Suchen erschwert.
Aber das Signal ist natürlich trotzdem nicht zu unterschätzen, denn schon seit halben Ewigkeiten bemühen sich Kulturen darum, unliebsame Inhalte per Dekret aus dem kollektiven Gedächtnis zu entfernen. Bedeutsam wurde ein solches Vorgehen regelmäßig nach Kriegen, wenn in Friedensverträgen festgehalten wurde, dass alle Erinnerungen an begangene Grausamkeiten und Freveltaten ausgelöscht werden sollten. (Dieses Vergessensgebot hat sich erst im Verlauf der Kriege des 20. Jahrhunderts in das Gegenteil eines Erinnerungsgebots verkehrt.) Sollte bei solchen Bemühungen also die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit aufrecht erhalten werden, um den gewesenen Krieg nicht in das Heute hineinschwappen zu lassen, handelt es sich in Zeiten des Internet eher um den Versuch, die alles umfassende Technik nicht vollständig das eigene Leben bestimmen zu lassen. Aber um ein wirkliches Vergessen kann es natürlich nicht gehen. Es kann nur um eine symbolisch aufzurufende Markierung gehen, entsprechende Grenzziehungen einzuhalten. Wer sich daran nicht gebunden fühlt, wird problemlos Wege finden, das Recht auf Vergessenwerden zu vergessen.
Heute das Gestern von morgen bestimmen
Historisch interessant ist die gesamte Angelegenheit, weil wir es hier auch mit einem Versuch zu tun haben, Grenzen zwischen den Zeiten zu ziehen. Schließlich steckt hinter dem Recht auf Vergessenwerden ganz wesentlich der Versuch, ein bestimmtes Stück Vergangenheit im Orkus verschwinden zu lassen, und damit heute schon bestimmen zu wollen, was man morgen noch über das Gestern wissen kann. Das hat bereits diverse Menschen und Gruppen auf den Plan gerufen, die sich gegen eine Zensur der Vergangenheit und damit einhergehende Konsequenzen für die historische Forschung gewendet haben.
Dieser Aspekt ist wahrlich nicht zu unterschätzen. Denn in der Tat ist hier das Bemühen zu beobachten, schon heute eine Vergangenheit zu kreieren, die erst morgen relevant werden dürfte. Zugleich ist die gesamte Diskussion in einen größeren Rahmen einzuordnen. Menschen und Kulturen waren zu allen Zeiten mittels unterschiedlicher Techniken darum bemüht, nicht nur Erinnerungen zu bewahren, sondern auch das Vergessen aktiv zu befördern (damnatio memoriae). Und auch wir, hier und heute, in den vergangenheitsseligen Zeiten des frühen 21. Jahrhunderts, sind auf vielfachem Weg darum bemüht, die Vergangenheit von morgen zu produzieren. Sehen wir uns doch nur die Praxis derjenigen an, die aus durchaus berechtigten Gründen das Recht auf Vergessenwerden fürchten: In Archiven werden die Konsequenzen diskutiert, die mit entsprechenden juristischen Regelungen einhergehen könnten. Aber was tun denn die Archive selbst, wenn nicht als Vergessensmaschinen zu fungieren? Im Gegensatz zu der zuweilen immer noch anzutreffenden Überzeugung, dass Archive vor allem dazu da seien, Dokumente übe die Zeiten hinweg aufzubewahren, die für Institutionen und Kollektive von Bedeutung sind, muss man festhalten, dass das weniger als die halbe Wahrheit ist. Archive sind in wesentlich größerem Maß damit beschäftigt, Erinnerungen zu tilgen, weil sie das allermeiste Material, das ihnen zugeführt wird (deutlich über 90%) vernichten müssen. Hier geht es vielleicht weniger um die Frage, ob man vergessen darf (oder muss), sondern eher um die Frage, wer darüber entscheiden kann, was vergessen werden darf.
Das Recht auf Vergessenwerden allein auf Internetsuchmaschinen zu delegieren, ist also reichlich kurz gesprungen. Denn es sind nicht Maschinen, die vergessen, sondern es sind Menschen, die vergessen sollen. Das menschliche Vergessen steht aber nicht nur unter einem gewissen kognitiven Vorbehalt, sondern hängt auch von der Benutzung anderer Medien als dem Internet ab (die soll es ja geben!) sowie von den Anstrengungen, die man auf sich zu nehmen bereit ist. Denn sich zu erinnern, erfordert tatsächlich Mühe. Unterlässt man diesen Energieaufwand, ist dem Vergessen kaum Einhalt zu gebieten.
Würde man den Versuch einer quantifizierenden Bestandsaufnahme unternehmen, würde sich wohl ohne weiteres herausstellen, dass im Umgang mit der Vergangenheit das Vergessen ohnehin der wesentlich normalere Vorgang als das Erinnern ist. Geht wohl auch gar nicht anders, denn wie schon Jorge Luis Borges wusste, würde das vollkommene Gedächtnis zur ebenso vollkommenen Lebensunfähigkeit führen. [2] Möglicherweise werden solche Überlegungen gemieden, weil sie das unumgängliche Paradox vor Augen führen, das unser Verhältnis mit der Vergangenheit prägt, es nämlich mit einer anwesenden Abwesenheit zu tun zu haben. Die Vergangenheit existiert nicht mehr, und gerade deswegen müssen wir zumindest einige letzte Spurenelemente davon gegenwärtig halten. Das Recht auf Vergessenwerden scheint in diesem schütteren Rest von Vergangenem noch mehr weiße Flecken produzieren zu wollen. Vielleicht ist die Diskussion darum aber auch nur ein Ausdruck unseres Unbehagens, das uns angesichts der medialen Möglichkeiten umfassender Geschichtsproduktion auf allen gesellschaftlichen Ebenen überfällt. Vielleicht wollen wir nur das Paradox einer Vergangenheit zurückhaben, die wirklich vergangen und nur deshalb gegenwärtig ist.
[1] Umberto Eco: An Ars Oblivionalis? Forget it!, in: Publications of the Modern Language Association (PMLA) 103 (1988) 254-261.
[2] Jorge Luis Borges: Das unerbittliche Gedächtnis, in: ders., Fiktionen. Erzählungen 1939-1944, 6. Aufl. Frankfurt a.M. 1999, 95-104.
Einsortiert unter:Geschichtskultur, Geschichtsmedien, Geschichtspolitik Tagged: Archiv, Erinnerung, Gedächtnis, internet, Recht auf Vergessenwerden, Vergessen
Quelle: https://achimlandwehr.wordpress.com/2015/02/13/34-rosa-elefanten-oder-das-recht-auf-vergessenwerden/