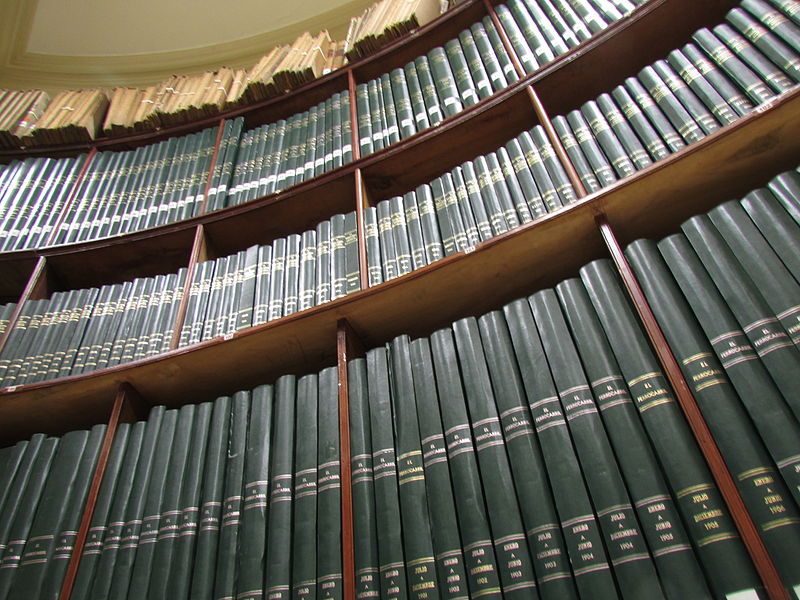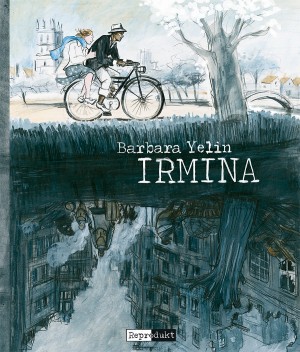Christian Wieland: Nach der Fehde. Studien zur Interaktion von Adel und Rechtssystem am Beginn der Neuzeit: Bayern 1500–1600 (= Frühneuzeit–Forschungen 23), Epfendorf/Neckar: bibliotheca academica Verlag 2014, 564 S., ISBN 978–3–928471–92–3
Von Hansdieter Körbl (Wien)
Das vorliegende Buch enthält die überarbeitete Fassung der von Christian Wieland vorgelegten Habilitationsschrift, die von der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg 2009 angenommen wurde. Das Thema ist ein historisches, gleichzeitig aber auch ein juristisches, da – wie der Titel zum Ausdruck bringt – die Beziehungen einer Gesellschaftsgruppe zu dem sich verfestigenden Rechtsystem untersucht werden. Dass dabei Bayern die Grundlage der Studien bildet, bedeutet nicht, dass es sich um eine rein bayrische Materie handelt. Problemlos können die grundsätzlichen Aussagen auf andere Länder des Kaisers umgelegt werden.
Die Fragestellung, die den Studien zugrunde liegt, widmet sich dem Aufbau eines Gewaltmonopols des Kaisers und der Landesfürsten sowie der Rezeption des Römischen Rechts.
[...]
Quelle: http://fnzinfo.hypotheses.org/622
 Schulz teilt kräftig aus. Immer drauf auf die ehemaligen Kollegen. Seine These: Redakteure und Verleger haben nicht verstanden, was Facebook und Google mit ihnen machen, und noch viel weniger, was eigentlich ihre Aufgabe wäre.
Schulz teilt kräftig aus. Immer drauf auf die ehemaligen Kollegen. Seine These: Redakteure und Verleger haben nicht verstanden, was Facebook und Google mit ihnen machen, und noch viel weniger, was eigentlich ihre Aufgabe wäre.