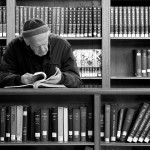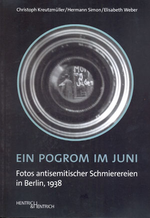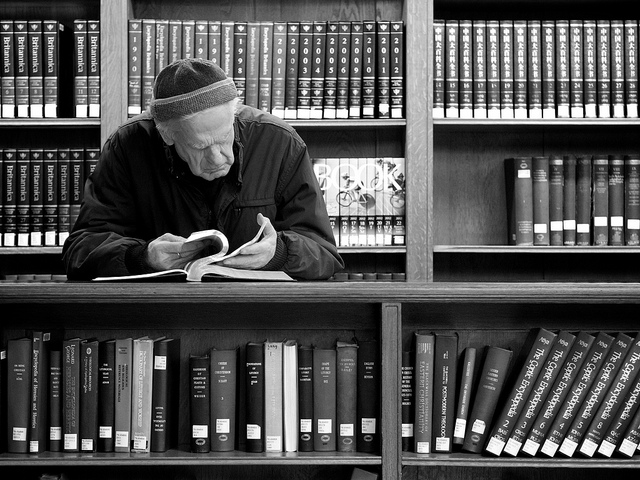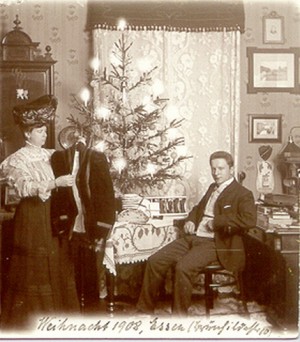Katrin Keller: Rezension von: Judith P. Aikin: A Ruler’s Consort in Early Modern Germany. Aemilia Juliana of Schwarzburg-Rudolstadt. Farnham/Surrey 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/aikin_keller
Thomas Maissen: Rezension von: Edward G. Andrew: Imperial Republics. Revolution, War, and Territorial Expansion from the English Civil War to the French Revolution. Toronto 2011, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/andrew_maissen
Lena Oetzel: Rezension von: Sarah Apetrei / Hannah Smith (eds.): Religion and Women in Britain, c. 1660-1760. Aldershot 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/25798.html
Gvido Straube: Rezension von: Matthias Asche / Werner Buchholz / Anton Schindling (Hg.): Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500–1721. Teil 3 u. 4 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 71 u. 72). Münster 2011, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
David Bitterling: Rezension von: Pierre-Yves Beaurepaire (dir.): La communication en Europe. De l’âge classique au siècle des Lumières. Paris 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Johan Lange: Rezension von: Alain Becchia: Modernités de l’Ancien Régime (1750–1789). Rennes 2012, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/becchia_lange
Pascal Firges: Rezension von: Anna Bellavitis / Laura Casella / Dorit Raines (dir.): Construire des liens de famille dans l‘Europe moderne (Changer d’époque, 26). Mont-Saint-Aignan 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Christian Wenzel: Rezension von: Philip Benedict / Hugues Daussy / Pierre-Olivier Léchot (éd.): L’Identité huguenote. Faire mémoire et écrire l’histoire (XVIe–XXIe siècle) (Publications de l’Association suisse pour l’histoire du Refuge huguenot. Publikationen der Schweizerischen Gesellschaft für Hugenottengeschichte, 9). Genève 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Christine Schneider: Rezension von: Stefan Benz: Frauenklöster Mitteleuropas. Verzeichnis und Beschreibung ihrer Geschichtskultur 1550–1800 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 160). Münster 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/benz_schneider
Charlotte Backerra: Rezension von: Jeremy Black: Politics and Foreign Policy in the Age of George I, 1714-1727. Aldershot 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/25801.html
Charlotte Backerra: Rezension von: Jeremy Black: British Politics and Foreign Policy, 1727-44. Aldershot 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/25801.html
Martin Gierl: Rezension von: Thorsten Burkard / Markus Hundt / Steffen Martus u.a. (Hgg.): Natur – Religion – Medien. Transformationen frühneuzeitlichen Wissens. Berlin 2013, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/22519.html
Martin Stuber: Rezension von: Florence Catherine: La pratique et les réseaux savants d’Albrecht von Haller (1708–1777). Vecteurs du transfert culturel entre les espaces français et germaniques au XVIIIe siècle (Les Dix-huitièmes siècles, 161). Paris 2012, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Michael Ehrhardt: Rezension von: Jessica Cronshagen: Einfach vornehm. Die Hausleute der nordwestdeutschen Küstenmarsch in der Frühen Neuzeit. Göttingen 2014, in: H-Soz-Kult, 27.03.2015
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23563
Klaus Deinet: Rezension von: Jörg Feuchter / Johannes Helmrath: Parlamentarische Kulturen vom Mittelalter bis in die Moderne. Reden – Räume – Bilder (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 164; Parlamente in Europa, 2). Düsseldorf 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Erik Midelfort: Rezension von: Claire Gantet: Der Traum in der Frühen Neuzeit. Ansätze zu einer kulturellen Wissenschaftsgeschichte (Frühe Neuzeit, 143). Berlin/New York 2010, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Nina Schweisthal: Rezension von: Tim Harris / Stephen Taylor (Hg.): The Final Crisis of the Stuart Monarchy. The Revolutions of 1688–91 in their British, Atlantic and European Contexts. Woodbridge 2013, in: H-Soz-Kult, 17.03.2015
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-22705
Annalena Müller: Rezension von: Jennifer Hillman: Female Piety and the Catholic Reformation in France (Religious Cultures in the Early Modern World, 17). London 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/hillman_mueller
Yaman Kouli: Rezension von: Moritz Isenmann (Hg.): Merkantilismus. Wiederaufnahme einer Debatte. Stuttgart 2014, in: H-Soz-Kult, 20.03.2015
http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23233
Marc Mudrak: Rezension von: Bent Jörgensen: Konfessionelle Selbst- und Fremdbezeichnungen. Zur Terminologie der Religionsparteien im 16. Jahrhundert (Colloquia Augustana, 32). Berlin/New York 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Monika Frohnapfel-Leis: Rezension von: Linda Maria Koldau: Teresa von Avila. Agentin Gottes. 1515-1582. München 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/25802.html
Michael Rohrschneider: Rezension von: Matthias Schnettger: Der Spanische Erbfolgekrieg. 1701-1713/14. München 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/25403.html
Dominic Schumann: Rezension von: W. Gregory Monahan: Let God Arise. The War and Rebellion of the Camisards. Oxford 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Frank Göttmann: Rezension von: Martin Ott: Salzhandel in der Mitte Europas. Raumorganisation und wirtschaftliche Außenbeziehungen zwischen Bayern, Schwaben und der Schweiz, 1750–1815 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 165). München 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/ott_goettmann
Marion Kintzinger: Rezension von: Ann Marie Plane / Leslie Tuttle (ed.): Dreams, Dreamers, and Visions. The Early Modern Atlantic World. Philadelphia/Pennsylvania 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Mona Garloff: Rezension von: Jules Racine St-Jacques: L’honneur et la foi. Le droit de la résistance chez les réformés français (1536–1581) (Cahiers d’Humanismet et Renaissance, 107). Genève 2012, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Adrian Gmelch: Rezension von: Volker Reinhardt: De Sade oder Die Vermessung des Bösen. Eine Biographie. München 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Andrew L. Thomas: Rezension von: Susanne Rode-Breymann / Antje Tumat (Hg.): Der Hof. Ort kulturellen Handelns von Frauen in der Frühen Neuzeit (Musik-Kultur-Gender, 12). Köln/Weimar/Wien 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Franz Waldenberger: Rezension von: Thomas Max Safley (ed.): The History of Bankruptcy. Economic, Social and Cultural Implications in Early Modern Europe (Routledge Explorations in Economic History, 60). Routledge/New York 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Klaus Deinet: Rezension von: Christina Schröer, Republik im Experiment. Symbolische Politik im revolutionären Frankreich (1792–1799) (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Studien zur Geschichte, Literatur und Kunst). Köln/Weimar/Wien 2014, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/schroeer_deinet
Susanne Häcker: Rezension von: Herman J. Selderhuis / Martin Leiner / Volker Leppin (Hg.): Calvinismus in den Auseinandersetzungen des frühen konfessionellen Zeitalters (Reformed Historical Theology, 23). Göttingen 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Philipp Rössner: Rezension von: Gabriela Signori (Hg.): Das Schuldbuch des Basler Kaufmanns Ludwig Kilchmann (gest. 1518). Herausgegeben und kommentiert von Gabriela Signori. Stuttgart 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/26623.html
Harald Heppner: Rezension von: Norbert Spannenberger / Szabolcs Varga (Hgg.): Ein Raum im Wandel. Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Stuttgart 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/25164.html
Christoph Nebgen: Rezension von: Sieglind Storck: Das Theater der Jesuiten in Münster (1588-1773). Mit Editionen des ‘Petrus Telonarius’ von 1604 und der ‘Coena magna’ von 1632. Münster 2013, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/24811.html
Michael Maurer: Rezension von: Wolfgang Treue: Abenteuer und Anerkennung. Reisende und Gereiste in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (1400-1700). Paderborn 2014, in: sehepunkte 15 (2015), Nr. 3, 15.03.2015
http://www.sehepunkte.de/2015/03/24808.html
Sven Externbrink: Rezension von: Wouter Troost: Sir William Temple, William III and the Balance of Power in Europe (New Directions in Diplomatic History, 3). Dordrecht 2011, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
Simon Karstens: Rezension von: Carmen Winkel: Im Netz des Königs. Netzwerke und Patronage in der preußischen Armee 1713–1786 (Krieg in der Geschichte, 79). Paderborn/München/Wien/Zürich 2013, in: Francia-Recensio 2015/1 | Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500-1815), 11.03.2015
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-1/FN/winkel_karstens