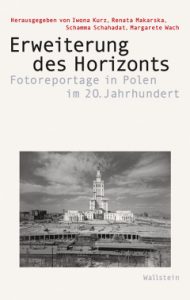„Das Ruhrgebiet neu denken“ oder auch „Tradition neu denken.“ Floskeln, die ...
Neu erschienen: Fotoreportage in Polen
Band 4 der Reihe: Visual History: Bilder und Bildpraxen in der Geschichte, herausgegeben von Jürgen Danyel, Gerhard Paul und Annette Vowinckel
Cover: Iwona Kurz/Renata Makarska/Schamma Schahadat/Margarete Wach (Hg.), Erweiterung des Horizonts. Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert, Göttingen 2018
Fotografische Bilder können enthüllen oder dokumentieren, zugleich aber geben sie die Realität nicht unverzerrt wieder. Diese Doppeldeutigkeit verkörpert die Fotoreportage auf besondere Weise. Die polnische Fotoreportage wiederum gewährt ungewöhnliche Einblicke in die ästhetischen und sozialen Diskurse eines Landes, dessen Geschichte exemplarisch ist für das krisengeschüttelte (Ost-)Mitteleuropa des 20. Jahrhunderts.
[...]
Quelle: https://www.visual-history.de/2018/08/23/fotoreportage-in-polen/
Testfall Thesaurus: lässt sich die jüdische Geschichte beschreiben?
Den Wunsch nach einem gemeinsamen und mehrsprachigen Thesaurus für die jüdische Geschichte...
Testfall Thesaurus: lässt sich die jüdische Geschichte beschreiben?
Den Wunsch nach einem gemeinsamen und mehrsprachigen Thesaurus für die jüdische Geschichte gibt es nicht erst seit gestern, er hat aber im Kontext der Digital Humanities und des Semantic Webs neuen Aufwind erfahren. Die Verfügbarkeit von digitalisierten Quellen und Metadaten einerseits, die Notwendigkeit, Digitalisate zu verschlagworten und Online-Angebote mithilfe einer strukturierten Tektonik im Idealfall projektübergreifbar durchsuchbar oder maschinenlesbar zu machen andererseits, zeigen den Bedarf und verweisen zugleich auf das Potenzial geeigneter Deskriptoren.
So wünschenswert ein fachspezifisches Vokabular erscheint, so groß sind die Herausforderungen. Verwiesen sei hier etwa auf die Mehrsprachigkeit und Mehrschriftlichkeit, die eine Vereinheitlichung ebenso erschweren wie der transnationale und interdisziplinäre Charakter der jüdischen Studien. Zugleich haben die bewahrenden Einrichtungen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, der Erschließung und damit auch der Indexierung. Hinzu kommen unterschiedliche Traditionen innerhalb der verschiedenen Gedächtnisorganisationen: Archive ordnen überwiegend nach dem Provenienzprinzip, Museen Objektbezogen, während Bibliotheken für die inhaltliche Beschreibung ihrer Bestände sowohl hierarchische Klassifikationen (RVK, DDC) als auch kontrollierte Schlagwortsysteme (SWD, LCSH) einsetzen.[1]
Wenig sinnvoll erscheint es zudem, einen Thesaurus nur innerhalb eines Projektes zu entwickeln, die Herausforderung ist vielmehr ein möglichst verallgemeinerbares und dennoch spezifisches Vokabular zu erarbeiten, das die Besonderheiten der jüdischen Geschichte abdeckt und ebenso religiöse Begrifflichkeiten, wie innerjüdische Strömungen, NS-Terminologie oder Vokabular aus der Gedenkpolitik umfasst.
[...]
OPEN PEER REVIEW — Adelheid Heftberger zu einem möglichen Experiment
«And therein lies the paradox of OPR: We won’t know if it works until more of us try....
#durchsichten Jugend – Pop – Kultur. Eine transnationale Geschichte, vsl. Berlin 2019, vf. v. Bodo Mrozek
Stellenanzeige Ruhr-Uni Bochum, „Digitale Edition der Kniffler-Briefe“
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland. Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort. Das dynamische Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden gleichermaßen besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
In der Fakultät für Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum, Sektion für Geschichte Japans, ist zum 01.10.2018 für die Laufzeit von einem Jahr eine Stelle als
[...]
Quelle: https://dhd-blog.org/?p=10379
GAG152: Ernest Shackleton und die Endurance-Expedition
Die Abstracts zur Tagung “Die Stadt und die Anderen”
 Mit einer Sektion zu aktuellen Projekten und Perspektiven wurde im vergangenen Jahre ein neues Format in die Herbsttagungen der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte integriert, das auf überaus positive Resonanz gestoßen ist. Daher werden auch in diesem Jahr ausgewählte Forschungen, die nicht dem Generalthema der Tagung zugeordnet sind, mit kurzen Projektvorstellungen präsentiert.
Mit einer Sektion zu aktuellen Projekten und Perspektiven wurde im vergangenen Jahre ein neues Format in die Herbsttagungen der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte integriert, das auf überaus positive Resonanz gestoßen ist. Daher werden auch in diesem Jahr ausgewählte Forschungen, die nicht dem Generalthema der Tagung zugeordnet sind, mit kurzen Projektvorstellungen präsentiert.
Hierbei handelt es sich sowohl um langfristige Vorhaben (Wolfgang Rosen zum Nordrheinischen Klosterbuch) als auch um laufende Abschlussarbeiten bzw. Dissertationen, die an der Universität Bonn angesiedelt sind (Philipp Gatzen, Thomas Fuchs und Keywan Klaus Münster). Darüber hinaus werden die aktuellen Aktivitäten des Kölner Frühneuzeit-Lehrstuhls zur Erforschung und digitalen Vermittlung des Lebens und Wirkens Ferdinand Franz Wallrafs vorgestellt, der als letzter Rektor der alten Kölner Universität und bedeutender Sammler jüngst die besondere Aufmerksamkeit der interessierten Öffentlichkeit gefunden hat (Kim Opgenoorth, Elisabeth Schläwe und Sebastian Schlinkheider). In epochaler Hinsicht umfassen die vorgestellten Projekte den Zeitraum vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Auch in inhaltlicher Hinsicht ist eine große Breite zu konstatieren: Untersuchungen zur politischen Geschichte finden sich ebenso wie Themen der Kirchen-, Universitäts- und Sammlungsgeschichte. Wir hoffen, dass die Sektion auch dieses Mal so lebhaften Zuspruch erhält, wie dies im vergangenen Jahr der Fall war!
[...]
Quelle: http://histrhen.landesgeschichte.eu/2018/08/die-stadt-und-die-anderen-sektion-vier/