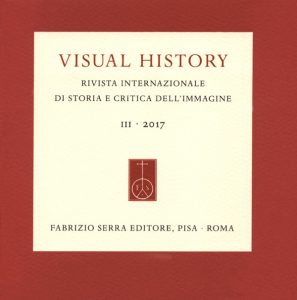Schon ein erster vorsichtiger Versuch der Recherche macht jedem deutlich, dass Forschungsdatenmanage...
Rebellen, Nietzsche und Game of Thrones – Von der Untersuchung mittelalterlicher Herrschaftskonzeptionen
“As for their breed and nature, they [the English] are readily disposed to treason, holding, a...
Rezension: „Visual History. Rivista internazionale di storia e critica dell’immagine”
Der erste Band der 2015 von Costanza D’Elia gegründeten Zeitschrift „Visual History. Rivista internazionale di storia e critica dell’immagine” wird mit einem Zitat aus „L’orologio“ („Die Uhr“) eingeleitet, einer der bedeutendsten politischen Romane der italienischen Nachkriegszeit, den der Schriftsteller und Maler Carlo Levi 1950 veröffentlichte. Die Auswahl der Zeilen erfolgte nicht zufällig: Ein Mensch, verzweifelt ob der „Unfähigkeit zu leben“,[1] stößt „in immer neue Wissensgebiete vor, auf der ständigen Suche nach etwas, das ihm hoffnungslos verborgen bleiben würde“.[2]
Cover: Visual History. Rivista internazionale di storia e critica dell’immagine
Neu ist auch das Terrain, das diese junge italienische Zeitschrift sondieren möchte, nämlich – wie schon ihr Titel verrät – das der visual history. Und ähnlich wie der Romanfigur bleibt es dem Historiker, der Historikerin letztendlich verborgen, Geschichte eindeutig und definitiv zu beschreiben. Selbst dann, wenn er sich bei seinen Überlegungen nicht nur auf „traditionelle“ Quellen, sondern auch auf Bilder stützt.
[...]
GAG218: Die Pazzi-Verschwörung und der Aufstieg der Medici
Ein unbekanntes Bildnis von G.F. Händel (1685-1759). Zum Wandel der Augenfarbe in den Händel-Porträts
Deutscher Meister, G.F. Händel, Öl/ Lwd, Maße 35 x 28 cm, braune Augen Chandos-Po...
Fellowships für Doktoranden und Postdoktoranden am Trier Center for Digital Humanities: Ausschreibung für 2020
Im Rahmen der vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Forschungsinitiative sind am Trier Center for Digital Humanities (TCDH / Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere
Fellowships für Doktoranden und Postdoktoranden
mit einer Laufzeit von jeweils 6-12 Monaten zu vergeben, je nach Bedarf des vorgeschlagenen Projekts. Die Fellowships sind mit dem Vorhaben „Mining and Modeling Text: Interdisziplinäre Anwendungen, informatische Weiterentwicklung, rechtliche Perspektiven” (MiMoText) verbunden.
Das Trierer Kompetenzzentrum hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 zu einem national und international etablierten Zentrum für Digital Humanities entwickelt. Sein Ziel ist es, durch die (Weiter-)Entwicklung und Anwendung innovativer informatischer Methoden und Verfahren geistes- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten, neue Forschungsansätze in diesen Fachdisziplinen zu entwickeln und gleichzeitig zur Ausbildung neuer Forschungsfelder und Methodologien in den informatiknahen Fächern beizutragen. Das Zentrum forscht schwerpunktmäßig in den Bereichen Digitale Wörterbücher, Digitale Edition, Forschungssoftware und quantitative Analyse.
Ziel des Projektes „MiMoText“ ist es, den Bereich der quantitativen Methoden zur Extraktion, Modellierung und Analyse geisteswissenschaftlich relevanter Informationen aus umfangreichen Textsammlungen konsequent weiterzuentwickeln und aus interdisziplinärer (geistes-, informatik- und rechtswissenschaftlicher) Perspektive zu erforschen.
[...]
Quelle: https://dhd-blog.org/?p=12623
Warum Friedenschließen so schwer ist
 Die aktuelle weltpolitische Lage mit den anhaltenden Konflikten im Nahen und Mittleren Osten, im Südsudan, in der Ukraine und Kolumbien, aber auch den jüngsten Eskalationen in Bolivien sowie zwischen den USA und dem Iran, um nur einige medial sehr prominente Beispiele zu nennen, zeigen vor allem eines: wie schwierig es ist, (kriegerische) Auseinandersetzungen zu beenden und Frieden zu schließen.
Die aktuelle weltpolitische Lage mit den anhaltenden Konflikten im Nahen und Mittleren Osten, im Südsudan, in der Ukraine und Kolumbien, aber auch den jüngsten Eskalationen in Bolivien sowie zwischen den USA und dem Iran, um nur einige medial sehr prominente Beispiele zu nennen, zeigen vor allem eines: wie schwierig es ist, (kriegerische) Auseinandersetzungen zu beenden und Frieden zu schließen.
Im August/September 2017 nahm die internationale und transdisziplinäre Tagung „Warum Friedenschließen so schwer ist“ (Organisation: Dr. Dorothée Goetze/Dr. Lena Oetzel) ebendiesen Befund zum Anlass und fragte am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses nach den allgemeinen Dimensionen des Friedenschließens, also dessen politischen, ökonomischen, sozialen und diskursiven Rahmenbedingungen.
Die Ergebnisse dieser Tagung dokumentiert nun der gleichnamige von Dorothée Goetze und Lena Oetzel herausgegebene Sammelband „Warum Friedenschließen so schwer ist: Frühneuzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses“, der im Oktober 2019 beim Verlag Aschendorff erschienen ist.
 Das oft langwierige Ringen um Frieden ist kein Phänomen der Moderne. Die vielschichtigen “Staaten”beziehungen der Frühen Neuzeit waren nicht nur durch die epochenspezifische Bellizität (Johannes Burkhardt), sondern auch komplementär dazu durch stetes Bemühen um Frieden geprägt.
Das oft langwierige Ringen um Frieden ist kein Phänomen der Moderne. Die vielschichtigen “Staaten”beziehungen der Frühen Neuzeit waren nicht nur durch die epochenspezifische Bellizität (Johannes Burkhardt), sondern auch komplementär dazu durch stetes Bemühen um Frieden geprägt.
[...]
Quelle: http://histrhen.landesgeschichte.eu/2019/11/bonn1648-sammelband/
Warum Friedenschließen so schwer ist
 Die aktuelle weltpolitische Lage mit den anhaltenden Konflikten im Nahen und Mittleren Osten, im Südsudan, in der Ukraine und Kolumbien, aber auch den jüngsten Eskalationen in Bolivien sowie zwischen den USA und dem Iran, um nur einige medial sehr prominente Beispiele zu nennen, zeigen vor allem eines: wie schwierig es ist, (kriegerische) Auseinandersetzungen zu beenden und Frieden zu schließen.
Die aktuelle weltpolitische Lage mit den anhaltenden Konflikten im Nahen und Mittleren Osten, im Südsudan, in der Ukraine und Kolumbien, aber auch den jüngsten Eskalationen in Bolivien sowie zwischen den USA und dem Iran, um nur einige medial sehr prominente Beispiele zu nennen, zeigen vor allem eines: wie schwierig es ist, (kriegerische) Auseinandersetzungen zu beenden und Frieden zu schließen.
Im August/September 2017 nahm die internationale und transdisziplinäre Tagung „Warum Friedenschließen so schwer ist“ (Organisation: Dr. Dorothée Goetze/Dr. Lena Oetzel) ebendiesen Befund zum Anlass und fragte am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses nach den allgemeinen Dimensionen des Friedenschließens, also dessen politischen, ökonomischen, sozialen und diskursiven Rahmenbedingungen.
Die Ergebnisse dieser Tagung dokumentiert nun der gleichnamige von Dorothée Goetze und Lena Oetzel herausgegebene Sammelband „Warum Friedenschließen so schwer ist: Frühneuzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses“, der im Oktober 2019 beim Verlag Aschendorff erschienen ist.
 Das oft langwierige Ringen um Frieden ist kein Phänomen der Moderne. Die vielschichtigen “Staaten”beziehungen der Frühen Neuzeit waren nicht nur durch die epochenspezifische Bellizität (Johannes Burkhardt), sondern auch komplementär dazu durch stetes Bemühen um Frieden geprägt.
Das oft langwierige Ringen um Frieden ist kein Phänomen der Moderne. Die vielschichtigen “Staaten”beziehungen der Frühen Neuzeit waren nicht nur durch die epochenspezifische Bellizität (Johannes Burkhardt), sondern auch komplementär dazu durch stetes Bemühen um Frieden geprägt.
[...]
Quelle: http://histrhen.landesgeschichte.eu/2019/11/bonn1648-sammelband/
Ein Blick nach Deutschland und Südkorea: WEICHENSTELLUNG für Ausbildung und Beruf: Mentoring für neuzugewanderte Auszubildende
Dies ist der zweite Teil der Blogreihe zu Menschenrechtspädagogik. Den ersten Beitrag dazu find...
Quelle: https://hse.hypotheses.org/2050
9. November 1938!? Wie das öffentliche Pogromgedenken individuelle Erinnerung überschreibt
Von Daniel Ristau Frau Z. war gerade einmal acht Jahre alt, als die Pogromgewalt im November 1938 di...