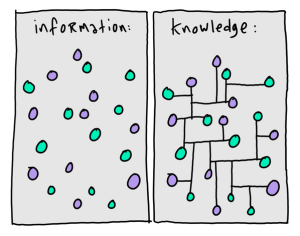Wer sich aktenkundliches Rüstzeug für eigene Archivstudien zulegen will, wird mit einer hochspezialisierten Forschung konfrontiert, deren Wege nicht immer geradlinig waren. Die Serie "Forschungsgeschichte der Aktenkunde" soll diese Wege abschreiten. Parallel entsteht eine aktenkundliche Basisbibliografie, die die besprochenen Werke systematisch nachweist.
Ich verstehe diese Serie auch als Exempel zur Blogparade "Wissenschaftsbloggen: zurück in die Zukunft" (#wbhyp). Hier verwerte ich Material aus einem Buchprojekt, das aufgrund der bekannten Krise des wissenschaftlichen Buchmarkts nicht zustande gekommen ist. Ganz abgesehen davon, dass die Darstellung im Blog-Format nicht mehr an physische Grenzen stößt: Umfang, Links usw. – in diesem Format
- kann eine Wissenschaftsgeschichte einer Spezialdisziplin überhaupt erscheinen,
- kann sie das angestrebte Publikum am besten erreichen und
- kann sie fortgeführt und ergänzt werden.
Auf Frau Königs Aufruf, herauszufinden warum sich das Bloggen "trotzdem" lohnt, kann ich für mein Exempel nach der Umstellung von Papier auf digital nur mit eigener Überraschung entgegnen: So etwas lohnt sich eigentlich nur im Wissenschaftsblog! Wer sich seiner Sache sicher ist, kann sich auch dem Medium anvertrauen. Wo Blogs weiße Flecken füllen, die das Papier auf seinem Rückzug hinterlässt, werden sie rezipiert werden.
Nun aber zur Sache!
* * *
Die Aktenkunde ist eine praktische Wissenschaft. Aus der praktischen Beschäftigung mit Akten in Archiven ist sie auch entstanden: einerseits aus der Ordnung und Verzeichnung von Archivgut, andererseits aus kritischen Editionen von Aktenstücken. Den Anstoß gab die Bewältigung frühneuzeitlichen Materials im charakteristischen Kanzleistil des Ancien Régime, der nach den Reformen des 19. Jhs. der aktiven Generation von Historikern und Archivaren fremd geworden war und deshalb mit wissenschaftlicher Methodik durchdrungen werden musste.
Wurzeln in der Urkundenforschung
Die Methodenlehre des Fachs ist freilich nicht vom Himmel gefallen. Den Boden hat die Diplomatik bereitet, die zur selben Zeit vom Werkzeug der Quellenkritik hoch- und frühmittelalterlicher Urkunden zu einer umfassenderen Lehre von urkundlicher Schriftlichkeit auch im Spätmittelalter weiterentwickelt wurde. Methodisch rückte dabei der Entstehungszusammenhang der Schriftstücke in den Fokus.
Als Zentralorgan der neuen Diplomatik wurde 1908 das Archiv für Urkundenforschung (AUF, heute: Archiv für Diplomatik) begründet. Die neue Zeitschrift sollte auch Raum für Studien bieten, "die sich mit dem Register-, Akten- und Behördenwesen im Übergang zur Neuzeit beschäftigen" und sich neben Urkunden im engeren Sinne auch mit "Entwürfen und Konzepten, [...] Briefen, Akten und Büchern der gleichen Behörden oder Schreibstuben" befassen sollte. Für die Herausgeber, die dieses Programm in der Einleitung zum ersten Band des AUF aufstellten, war außerdem klar, dass "mit den Urkunden und Akten stets auch die Geschichte der entsprechenden Behördenorganisation erforscht [...] werden soll" (Brandi/Bresslau/Tangl 1908: 2 f.).
Michael Tangl (1861–1921), einer der Herausgeber, trug als akademischer Lehrer zur Verbreitung dieses Ansatzes bei, der (wie Henning 1999: 110 bemerkt) seine eigentliche Verwirklichung in der Aktenkunde fand, auch wenn aufseiten der Diplomatik noch hervorragende, auch aktenkundlich einschlägige Studien wie Spangenbergs Arbeit zu den Kanzleivermerken (1928) erschienen. Tangl war aus dem österreichischen Archivdienst hervorgegangen und lehrte zunächst in Marburg und dann in Berlin mittelalterliche Geschichte.
Marburg und Berlin sind die beiden Orte, mit denen die Forschungsgeschichte der Aktenkunde vielfach verknüpft ist. Maßgeblich, aber nicht ausschließlich, hängt dies mit der Ansiedlung der Ausbildungseinrichtungen für Archivare in Preußen, der DDR und der Bundesrepublik zusammen. Wichtig ist, dass diese Orte im Laufe der Zeit auch begannen, für unterschiedliche Denkschulen zu stehen.
Friedrich Küch: Aktenkunde in der Archivarbeit
Zum 400. Geburtstag Landgraf Philipps des Großmütigen von Hessen legte Friedrich Küch (1863–1935), Archivar am preußischen Staatsarchiv Marburg, den ersten Band von dessen "Politischen Archiv" vor. Küch hatte aus einer zersplitterten archivalischen Überlieferung den Zustand auf dem Papier rekonstruiert, den der Aktenbestand des Landgrafen zu außenpolitischen Angelegenheiten zu seinen Lebzeiten hatte. Die Aktenstücke hatte Küch, nach Vorgängen zusammengefasst, durch ausführliche Regesten in einer heute kaum noch vorstellbaren Tiefe erschlossen. Dennoch handelt es sich beim "Politischen Archiv" noch um ein archivisches Findmittel, nicht schon um eine Edition (Kretzschmar 2013: 93).
Küch legte die zeitgenössische Behördenorganisation zugrunde. Eine besondere Schwierigkeit ergab sich daraus, dass Akten zu derselben Angelegenheit sowohl in der Kasseler Zentrale als auch bei den hessischen Gesandten an anderen Höfen angefallen sein konnten – klassische Spiegelakten also: Was in Kassel als Konzept zu den Akten ging, liegt in denen des Gesandten als Ausfertigung vor, usw. Küch schreibt (1904: XXIV):
"Eine notwendige und wohltätige Folge der gewählten Anordnung war der Zwang jedes [...] Schriftstück [...] an dem Orte unterzubringen, wohin es seiner kanzleimäßigen Entstehung nach gehörte".
Somit war "die möglichst scharfe Feststellung des kanzleimäßigen Zustandes, in dem das betreffende Stück überliefert ist" (ebd. XXX) die Voraussetzung für die sachgerechte Verzeichnung des Bestands. Indem Küch über die dazu berücksichtigten Grundsätze Rechenschaft ablegte, führte er bis heute zentrale Forschungsbegriffe zu Entstehungsstufen und Überlieferungsformen von Schriftstücken ein: Schreiben in Akten können als Konzept, als Mundum (Ausfertigung) oder in Abschrift vorliegen; zentrale Bearbeitungsschritte waren die Revision des Konzepts und der Vollzug der Ausfertigung.
Auch gebührt Küch das Verdienst, als erster konsequent den neutralen Begriff Schreiben für Korrespondenzen in Akten benutzt zu haben. Seine Terminologie ist noch nicht trennscharf, seine Ausführungen sollten aber auch keine Methodologie begründen, sondern nur vor den Benutzern des Repertoriums Rechenschaft über die Arbeitspraxis ablegen (ebd. XII).
In der Summe ist genau das, eine Methodologie zu begründen, Küch unbeabsichtigt aber dennoch gelungen. Schon Haß und Meyer, den nächsten Pionieren der Aktenkunde, dienten seine Erkenntnisse zur kanzleimäßigen Entstehung von Schriftstücken als Leitfaden und Kontrastfolie für andere Epochen der Kanzleigeschichte.
Martin Haß: Aktenkunde als Editionsmethode
Um die Edition der politischen Korrespondenz eines anderen wirkungsmächtigen Herrschers, Friedrichs des Großen, zu ergänzen, wurden 1887 die Acta Borussica begründet, eine momumentale Editionsreihe von Aktenstücken zur inneren Entwicklung Preußens. Das umfasste auch die Verwaltungsgeschichte, deren Erforschung zudem die Grundlage für das Verständnis anderer Zweige der inneren Entwicklung war. Die Acta Borussica waren Grundlagenforschung, die in die Hände erfahrener Editoren gelegt war.
Einer dieser Editoren – und verantwortlich für die Editionsgrundsätze v war der Tangl-Schüler Martin Haß (1883–1911). Er veröffentlichte 1909 eine Studie "über das Aktenwesen und den Kanzleistil im alten Preußen", die in ihrer Verbindung von verwaltungsgeschichtlicher und hilfswissenschaftlicher Betrachtung wegweisend für die Aktenkunde war. Haß stand auf diesem Feld nicht allein: Auch Granier (1902), Klinkenborg (1915) und andere befassten sich mit dem, was zum brandenburgisch-preußischen Referenzmodell der Aktenkunde werden sollte; dieser Berliner Urgrund der Aktenkunde wird von Henning (1999) genau untersucht. Haß' Studie sticht durch ihren Umfang und den Versuch, Neuland zu kartieren, heraus:
"Die historische Aktenkunde ist ein weites, schier unübersichtliches Feld, das fast noch in seiner ganzen Ausdehnung wüst liegt und nur erst von ein paar Hauptwegen durchzogen ist."
(Haß 1909: 521 - zitiert nach der durchgehenden Seitenzählung des Bandes.)
Die Studie konzentriert sich auf die "Formalien in den Schriftsätzen" (ebd. 522), also auf innere Merkmale, und erklärt sie als Spuren der dahinter abgelaufenen Verwaltungsvorgänge. Im Grunde ging es Haß um ein Spezialproblem: Welche im Namen des Fürsten ergangenen Weisungen stammten wirklich von ihm und welche ergingen in seinem Namen von Behörden? Damit war die Rekonstruktion von Entscheidungsprozessen und die Zuschreibung von Verantwortung als ein Hauptzweck der Aktenkunde formuliert worden.
"Es konnte vorkommen, daß Friedrich Wilhelm als Kammer eine Verfügung ergehen ließ, die Friedrich Wilhelm als Generaldirektorium tadelte, und daß dann Friedrich Wilhelm als König, wenn die Sache an ihn gelangte, womöglich noch eine andere Entscheidung fällte."
(Haß 1909: 541.)
In einem aktenkundlichen locus classicus wies Haß (1909: 531 f.) nach, dass der auf Schriftstücken häufig anzutreffende Vermerk "Auf Seiner Majestät allergnädigsten Specialbefehl" oder "ad mandatum speciale regis", entgegen dem Wortsinn gerade keinen speziellen Befehl des Königs, sondern eine selbständige Behördenweisung anzeigte.
Richtungsweisend verknüpfte er die verwaltungsgeschichtliche Rekonstruktion der Behördenorganisation mit der Analyse normativer Texte wie Kanzleiordnungen und dem empirischen Befunde der Schriftstücke. Sein besonderes Interesse galt dem Kanzleistil als "Staatsgrammatik" (ebd. 522).
Die Forschung kann ihm dankbar dafür sein, dass er seiner eigentlichen Argumentation Anhänge beigab, die von den 55 Seiten allein 24 einnehmen. Ohne verfrühte Systematisierung stellte Haß darin seine gesammelten Beobachtungen an Aktenstücken zur Verfügung. Herausragend ist der Exkurs "über die Entstehung eines Aktenstücks" (ebd. 554–559), der die Entstehungsstufen unter den Bedingungen des voll entwickelten kollegialen Verwaltungstyps nachvollzieht und sich dazu bereits mit Küchs Befund aus dem 16. Jahrhundert auseinandersetzt. Der Anhang "Musterbeispiele" (ebd. 568–575) bringt eine Zusammenstellung der für einzelne Schriftstücktypen charakteristischen Formularbestandteile.
Man würde Haß Unrecht tun, ihn nur als überholten Vorgänger Heinrich Otto Meißners zu sehen. Hier wurde nicht nur reiches Material für die nachfolgende Forschung ausgebreitet und vieles angedeutet, was Meißner später ausführen sollte, sondern Haß demonstrierte am Beispiel des Spezialbefehls auch, dass die Aktenkunde zu allgemeinen historischen Fragen, wie eben der Verantwortlichkeit des frühneuzeitlichen Fürsten, einen originären Beitrag leisten konnte – wozu also der ganze Aufwand gut war.
Hermann Meyer: Aktenkunde aus der Verwaltungspraxis
Hermann Meyer (1883–1943) war mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Im Auftrag der Reichsregierung wurde 1919 eine vierbändige kritische Edition der "deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch" 1914 veröffentlicht. Zur archivtechnischen Unterstützung des Vorhabens wurde der Archivar Meyer von der preußischen Archivverwaltung an das Auswärtige Amt abgeordnet.
Obwohl Meyer nicht zu den Editoren zählte, hoben diese doch hervor, dass "dessen fachmännische Spuren der Leser überall wahrnehmen wird" (Montgelas/Schücking 1919: VII). In erster Linie wird man dazu die saubere Bestimmung der Entstehungsstufen, die Zuweisung von oft schwer leserlichen Randbemerkungen und die zeitliche Einordnung, wer wann wovon Kenntnis hatte, verstehen können. Auch hier ging es also um das Problem der Feststellung von Verantwortlichkeit nach Aktenlage, das Haß beschäftigt hatte - nur eben nicht am grünen Tisch, sondern im Rahmen der heißen Kriegsschulddebatte. Selten fanden Akteneditionen eine derart weite Verbreitung. Meyers schmale Monografie von 1920 über "das politische Schriftwesen" des Auswärtigen Amts wandte sich als Hilfe zur Lektüre der edierten Dokumente ebenfalls an ein breites Publikum.
Das Problem, die pragmatische Schriftlichkeit einer vergangenen Epoche zu rekonstruieren, stellte sich Meyer, der jederzeit die Registratoren und Sekretäre des Amts befragen konnte, nicht. Die Herausforderung der zeitgeschichtlichen Edition lag in der Masse und Verschiedenheit der Überlieferungsformen, an der moderne technische Verfahren mitschuldig waren. Meyer bleibt bis heute maßgeblich zu Bereichen, die der Mainstream der Aktenkunde nicht im Blick hat, insbesondere zur Übermittlung per Telegraf oder Fernschreiber und zu Chiffrierverfahren (1920: 83–97).
Aus der Praxis schreibend, gelang Meyer das vielleicht plastischste und prägnanteste Buch zur Aktenkunde überhaupt. Die Leser erhalten einen umfassenden Überblick, wie Schriftstücke im Auswärtigen Amt entstanden, versandt und bearbeitet wurden, wie der Kaiser eingebunden war, wie Staatsverträge abgeschlossen wurden und wie der ganze Betrieb organisiert war. Der Zeitdruck bei der Erstellung des im Dezember 1919 abgeschlossenen Manuskripts und die Nähe der Praxis forderten aber ihren Tribut, indem sie Meyer die systematische Durchdringung des Stoffs verboten.
Bei der Behandlung der Entstehungsstufen konnte er noch, mit Küchs Terminologie gewappnet, die wirren Begriffe der Kanzleipraxis bändigen:
"In der modernen Registratur und Kanzlei ist die Terminologie des Schriftverkehrs nicht immer unbedingt feststehend. So werden Ausdrücke wie Original, Entwurf, Konzept, Ausfertigung, Minüte und Grosse, zumal in den verschiedenen Ländern, in sehr verschiedener Bedeutung angewandt. Um so wichtiger ist es, hier klar zu sehen."
(Meyer 1920: 38.)
Bei der Beschreibung der Schriftstücktypen hatte Meyer darauf, wie er selbst beklagt (ebd. 3 f.) verzichten müssen:
"Andererseits bedeutete es eine wirkliche Entsagung, auf die Darstellung der historischen Entwicklung der […] Schriftstücke zu verzichten, also etwa von Noten oder Handschreiben zu sprechen, ohne deren Geschichte und nicht zuletzt die ihrer äußern [sic] Form zu behandeln."
(Meyer 1920: 3.)
Die dazu angekündigten Spezialstudien kamen nicht mehr zustande, nachdem er 1920 zum ersten Leiter des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts berufen wurde; 1926 wechselte er in den diplomatischen Dienst. So scheiterte Meyer schon daran, die Entstehung und Behandlung der telegrafischen und schriftlichen Korrespondenz zwischen den Auslandsvertretungen an die Berliner Zentrale in ein logisches Verhältnis zu setzen, und behandelte beides an entgegengesetzten Enden der Darstellung. Vor lauter Bäumen verschwindet ein wenig der Wald.
Methodisch hat Meyer die Aktenkunde also nicht vorangebracht, aber es war sein Verdienst, die erste zeitgeschichtliche Aktenkunde geschrieben und den Ansatz Küchs auf frühe Verfahren der elektronischen Kommunikation angewandt zu haben.
Literatur
Außer den mit * gekennzeichneten werden alle Titel auch in der Basisbibliografie zur Aktenkunde nachgewiesen
Besprochene Werke
Brandi, Michael/Bresslau, Harry/Tangl, Michael 1908. Einführung. In: Archiv für Urkundenforschung 1. S. 1–4.
Online
Granier, Hermann 1902. Ein Reformversuch des preußischen Kanzleistils im Jahre 1800. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 15. S. 168–180.
Online
Haß, Martin 1909. Über das Aktenwesen und den Kanzleistil im alten Preußen. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 22. S. 521–575.
Online
Klinkenborg, Melle 1915. Die Stellung des Königlichen Kabinetts in der preußischen Behördenorganisation. In: Hohenzollern-Jahrbuch 19. S. 47–51.
Online
Küch, Friedrich 1904. Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Großmütigen von Hessen: Inventar der Bestände. Bd. 1. Publikationen aus den Preußischen Staatsarchive 78. Leipzig.
Online
Meyer, Hermann 1920. Das politische Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst. Ein Leitfaden zum Verständnis diplomatischer Dokumente. Tübingen.
Online
Spangenberg, Heinrich 1928. Die Kanzleivermerke als Quelle verwaltungsgeschichtlicher Forschung. In: Archiv für Urkundenforschung 10. S. 469–525.
Weitere Literatur
Henning, Eckart 1999. Wie die Aktenkunde entstand. Zur Disziplingenese einer Historischen Hilfswissenschaft und ihrer weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert. In: Ders. 2004. Auxilia Historica. Beiträge zu den historischen Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen. 2. Aufl. Köln. S. 105–127.
Kretzschmar, Robert 2013. Akten- und Archivkunde im Tübinger Netzwerk Landesgeschichte: Ein Plädoyer für eine zeitgemäße Archivalienkunde. In: Bauer, Dieter R. u. a., Hg. 2013. Netzwerk Landesgeschichte. Gedenkschrift für Sönke Lorenz. Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte 21. Ostfildern. S. 91–109.
*Montgelas, Max Graf/Schücking, Walter, Hg. 1919. Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. Bd. 1. Charlottenburg 1919.
Online
*Neugebauer, Wolfgang 1998. Martin Hass 1883–1911. Beiträge zur Biographie eines preußischen Historikers und Wegbereiters der Aktenkunde als Historischer Hilfswissenschaft. In: Herold-Jahrbuch, Neue Folge 3. S. 53–71.
Quelle: http://aktenkunde.hypotheses.org/306