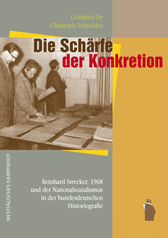In den vergangenen Monaten habe ich zusammen mit Kolleg/inn/en die Geschichte einer Umweltorganisation erarbeitet, die 2013 ihr 100jähriges Gründungsjubiläum beging. Was Historiker/innen kaum überrascht, war für viele Verantwortliche und Mitglieder dieser Organisation, die in den 1970er Jahren eine Wende vom staatsnahen Heimatverein zum kritischen Umweltverband durchlief, in der letztendlichen Deutlichkeit unerwartet.
Der Verband war auf organisatorischer, ideologischer und personeller Ebene mit dem Nationalsozialismus verflochten – er war ein integraler, wenn auch nicht unbedingt wichtiger Teil des NS-Machtapparats. Was mich als akademischen Historiker überrascht hat, waren die praktischen Fragen, die sich aus dieser neuen Sicht der Verbandsgeschichte ergaben und immer noch ergeben. Diese Überraschung möchte ich hier reflektieren und nehme dabei Friedrich Nietzsches Essay “Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben” [1] zu Hilfe.
Stolpersteine
Hier steht ein Gedenkstein für einen Naturschützer, der ein Moor vor dem Zugriff des Reichsarbeitsdienstes gerettet hat – durch seine guten Beziehungen. Er war NSDAP-Mitglied seit 1922, Teilnehmer am Hitler-Putsch von 1923 und „Alter Kämpfer“. Er hielt Naturschutz für “Rasseschutz”. Dort ist eine Straße nach einem Naturschützer benannt, der in den 1960ern den Ortsverband aus der Taufe hob und über Jahre am Leben hielt. Bis 1945 war erObersturmbannführer der SA in deren Propagandastab. Und dann ein Naturschutz-Funktionär, der die Belange von Natur und Umwelt in einem ganzen süddeutschen Bundesland fast allein verteidigte, ganz gegen den Trend der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit. Dadurch wurde er zur Identifikationsfigur für eine ganze Generation von Naturschützern/innen der 1960er und 1970er Jahre. Karriere als Wissenschaftler hatte er vor 1945 gemacht, in dem er opportunistisch die Klaviatur des NS-Wissenschaftssystems bespielte und natürlich den einschlägigen Parteigliederungen beitrat.
Gedenksteine, Straßennamen, historische Identifikationsfiguren sind allesamt praktische Stolpersteine für eine kritische Neufassung deutscher Geschichten. Sie sind nicht nur Mittel des Erinnerns und der Traditionsbildung. Oft sind sie zum Selbstzweck geworden, zu eigenen Erinnerungsorten, die Anspruch auf “Denkmalpflege” erheben. Die Menschen, die konkret und vor Ort mit ihnen Umgehen, die sie in ihre eigene Biografien – häufig durchaus als gesellschaftskritische Bürger – eingebunden haben, fordern das Urteil des/r Historikers/in heraus. Und das zu Recht. Die Fakten stehen keineswegs zur Diskussion. Die besagten Naturschützer/innen wollen lediglich eines genauer wissen: was sollen wir nun mit diesem Wissen anfangen? Sollen wir die Plaketten abmontieren, die Straßen umbenennen, die Gründerfiguren durch neue ersetzen? Ist es das, was daraus folgt? Ist das die Antwort?
Nietzsche und Kritische Geschichte
Spätestens hier wird einem der Unterschied zwischen einer/m Historiker/in und einer/m Richter/in deutlich. Dieser setzt nach dem Urteil das Strafmaß fest, jener ist mit solch einer Frage weitestgehend überfordert. Die intuitive Reaktion einer/s Historikers/in wäre vielleicht, sich möglichst zurückzuziehen und allenfalls ein weiteres Projekt anzustoßen, das Gedenkpraxis aus dem Blickwinkel der Erinnerungskulturforschung untersucht. Mehr fällt mir eigentlich auch nicht mehr ein, außer vielleicht nochmal über die Frage des praktischen Werts kritischer Geschichte nachzudenken. Das möchte ich im Folgenden kurz tun, mit Hilfe von Friedrich Nietzsches Reflexion „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“.
Friedrich Nietzsche unterschied in dem Essay von 1874 drei Grundformen von Geschichtsschreibung – die monumentalische, die antiquarische und die kritische (siehe v.a. Kap. 2/3). Die monumentalische Geschichte versuche die vergangenen Heldentaten, die Heroen und ihre Siege in Erinnerung zu rufen; sie sei die Geschichte der Sieger, der Mächtigen und könne im vernünftigen Maß Vorbilder herausstellen und die Fähigen der Gegenwart zu großen Taten motivieren. Im Übermaß betrieben verleite sie dazu, den Niedergang zu beklagen und ob des eigenen Epigonentums in Lethargie zu verfallen. Die antiquarische Variante sei, so Nietzsche, insofern ihr Gegenpol, als sie sich auf den kleinen Raum, die nächste Umgebung und das Gewordensein lokaler Beziehungen konzentriere. Sie rufe dazu auf, den eigenen Nahraum, die jeweilige Lebenswelt als die bestmögliche zu begreifen, es sich in ihr gemütlich zu machen, sich selbst in eine Familien-, Stadt- oder Vereinsgeschichte gleichsam hinein zu erzählen. Nietzsche erkennt die stabilisierende, praktische Lebenshilfe, die aus solch einer fast selbsttherapeutischen Herangehensweise erwächst, warnt aber vor einer ganzen antiquarischen Kultur, die zuletzt überhaupt nichts Neues mehr zulassen will, weil der eigene Ort bereits in der Vergangenheit perfekt eingerichtet worden ist.
Im Gegensatz zu diesen beiden Formen stehe eine dritte, die kritische Geschichte. Sie sei nicht nur die Geschichte der Besiegten, der Unterdrückten und Ausgebeuteten, sie sei destruktiv, indem sie die Fehler vergangener Generation aufsuche und diese zu richten trachte – eine sehr notwendige Funktion, wie Nietzsche meint:
[Der Mensch] muss die Kraft haben und von Zeit zu Zeit anwenden, eine Vergangenheit zu zerbrechen und aufzulösen, um leben zu können: dies erreicht er dadurch, dass er sie vor Gericht zieht, peinlich inquirirt, und endlich verurtheilt […]. Mitunter aber verlangt eben dasselbe Leben, das die Vergessenheit braucht, die zeitweilige Vernichtung der Vergessenheit; dann soll es eben klar werden, wie ungerecht die Existenz eines Dings, eines Privilegiums, einer Kaste, einer Dynastie zum Beispiel ist, wie sehr dieses Ding den Untergang verdient. Dann wird seine Vergangenheit kritisch betrachtet, dann greift man mit dem Messer an die Wurzeln, dann schreitet man grausam über alle Pietäten hinweg (33-34).
Sicherlich muss man sich Nietzsches düsterer Kategorisierung von kritischer Geschichte nicht anschließen. Nicht zuletzt ist seine philosophisch-systematische Charakterisierung auch zirkulär bzw. in der eigenen Systematik verhangen; der kritische Ansatz ist düster, weil er von den Besiegten und Entrechteten per definitionem ausgeht und dementsprechend auf die Dekonstruktion der monumentalischen und antiquarischen Geschichte ausgerichtet ist. Dennoch, denke ich, weist Nietzsche auf einige Gefahren historischer Kritik hin, z.B. was das „Richten“ betrifft (siehe v.a. Kap. 6).
“Wer zwingt euch zu richten?”
Einerseits sieht er die Gefahr des umfassenden Historismus, der alles versteht und sich anverwandelt, der „eine solche Zartheit und Erregbarkeit der Empfindung ausbildet, dass ihm gar nichts Menschliches fern bleibt; die verschiedensten Zeiten klingen sofort auf seiner Lyra in verwandten Tönen nach: er ist zum nachtönenden Passivum geworden“ (56). Dieses radikale Historisieren – also des Verstehens aus dem jeweiligen zeitlichen Horizonts heraus und des sich Entäußern der eigenen Werte und Maßstäbe, arte zur „Toleranz, zum Geltenlassen des einmal nicht Wegzuläugnenden, zum Zurechtlegen und maassvoll-wohlwollenden Beschönigen“ (57) aus. Ebenso problematisch sieht er andererseits die billige Selbstgerechtigkeit derjenigen, „die im naiven Glauben [...], dass gerade ihre Zeit in allen Popularmeinungen Recht habe“, die „Vergangenheit“ der eigenen „Trivialität“ (58) anpassten: „Als Richter müsst ihr höher stehen, als der zu Richtende; während ihr nur später gekommen seid“ (63). Es ist wohl typisch für Friedrich Nietzsche, dass er ein wahres, gerechtes und vor allem dem Leben nützliches Urteil nur von ganz wenigen Berufenen mit „jener innerlich blitzenden, äusserlich unbewegten und dunklen Ruhe des Künstlerauges“ zutraut und den anderen entgegenhält: „Wer zwingt euch zu richten?“ (63) Das gibt Helmut Kohls Spruch von der „Gnade der späten Geburt“ (1984 vor der Knesset), die einen vor Schuld bewahre, noch einmal eine neue Bedeutung. Nämlich: hütet euch zu richten, denn ihr seid lediglich später geboren.
Der Historikerstreit und die Frage von Kollektivschuld versus Kollektivverantwortung muss hier nicht rekapituliert werden. Eins wird jedoch deutlich. Nietzsche selbst liefert eine zeitgebundene Analyse vom Ende des 19. Jahrhunderts her. Nach 1945 wollen und können wir nicht mehr auf eine kleine Gruppe genialer Künstler-Historiker warten, die mit sicherem Auge Gerechtes von Ungerechtem unterscheidet und ihre Urteile fällt, während sich der Rest der Zunft und der Gesellschaft mit der Gnade der späten Geburt zufrieden gibt. Nicht nur, dass sich ein nietzscheanischer Virtuosen-Kult überlebt hat. Die Geschichte der Shoa, des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, fordert eine wertende Analyse von den späteren Generationen. Eine streng historisierende Bewertung kann natürlich Ereignisse und Handlungen ebenfalls bewerten; vieles war einfach auch nach den damaligen Wertmaßstäben ein juristisches wie moralisches Verbrechen. Aber unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, hat neue Maßstäbe produziert – demokratische, pazifistische, inklusive und tolerante. Auch diese muss man an die Vergangenheit anlegen können, ohne selbstgerecht zu werden. Bloß, wie geht das? Das zumindest ist eine der Fragen, die sich mir ganz praktisch angesichts der NS-Geschichte des besagten Naturschutzverbandes stellen, weniger im Bezug auf konkret verurteilbare Verbrechen, als hinsichtlich seiner instrumentellen Funktion für eine antisemitisch, rassistisch, sexistisch und auf viele weitere Weisen ausschließende “Volksgemeinschaft”.
Vergangenes Geschehen und zu erinnernde Geschichte
Was kann man nun als Historiker/in auf die Frage nach den praktischen Konsequenzen neuer Erkenntnis antworten? Man kann darauf hinweisen, dass die Arbeit des/r Historikers/in sich von der des Staatsanwalts, Verteidigers oder Richters unterscheidet. Dass es um ein historisches Urteil geht, dass die Horizonte, die Kontexte und die Alternativen einer historischen Person und ihrer Handlungen berücksichtigen muss, und nicht um eine juristische Verurteilung – dazu ist unsere historische Methode nicht geeignet. Dass aber eine Frage energisch zurückgespiegelt werden muss: Taugen die historischen Akteure als Vorbild für unsere Zeit? Haben sie etwas Lehrreiches für Gegenwart und Zukunft zu sagen? Will man sich in ihre Tradition stehen? Und dass wir Material für eine Antwort liefern, die wir oft nicht alleine geben können.
Analytisch gesehen bedeutet das eine Trennung von Geschichte als vergangenem Geschehen, das mit Hilfe klassischer historischer Methoden rekonstruiert wird, und zu erinnernder Geschichte (explizit nicht erinnerter G., denn dies wäre erneut eine Frage der Rekonstruktion). Letzteres wirft eben die Frage nach unseren gegenwärtigen Maßstäben und unseren Interessen an der Vergangenheit auf, nach einem kritischen Erinnern. Allerdings ist das nicht mehr allein Expertise der Geschichtswissenschaft, sondern eine Frage des gesellschaftlichen Dialogs. Kritisch wäre an so einer Auffassung einerseits die wissenschaftliche Infragestellung/Dekonstrution der Vergangenheit (das Zerstören im Sinne Nietzsches) und andererseits die selbstkritische Begrenzung der eigenen Expertise und die dialogische Frage: wie wollen wir erinnern?
[1] Die Angaben beziehen sich auf die Reclam-Ausgabe Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil die Historie für das Leben, hg. v. Günter Figal, Stuttgart 2009.
Online-Ausgaben gibt es u.a. bei Zeno.org und Projekt Gutenberg.
Einsortiert unter:Erfahrungen, Erinnerung, Faschismus, Geschichte, Geschichtspolitik, Umweltgeschichte, Vermittlung