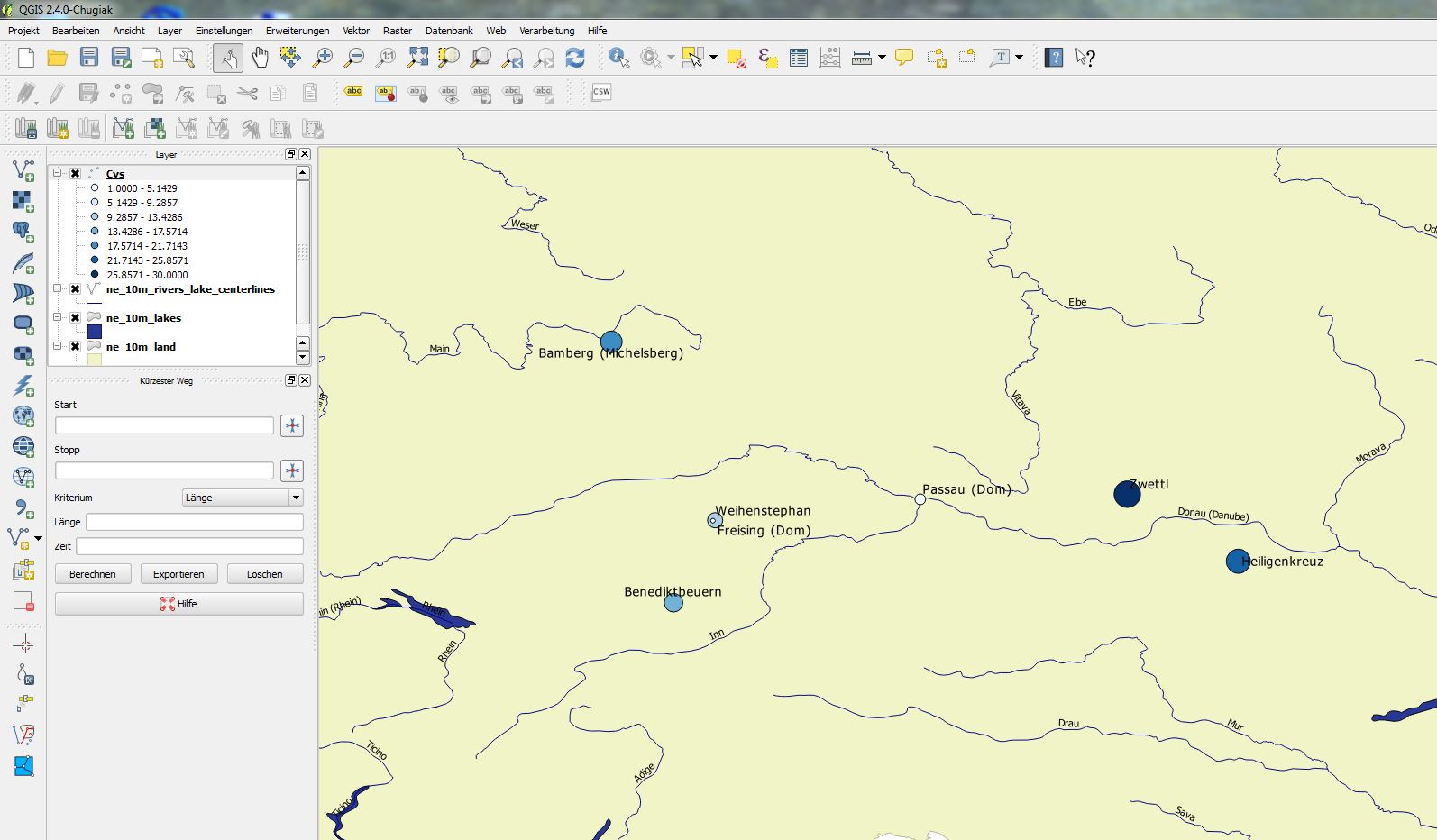There are approximately 1500 Christmas markets in Germany attracting 85 million visitors each year. An increase of 70 percent has been recorded since the year 2000. The sales revenue for 2014 in Germany is estimated …
English
There are approximately 1500 Christmas markets in Germany, attracting 85 million visitors each year. An increase of 70 percent has been recorded since the year 2000.[1] The sales revenue for 2014 in Germany is estimated at 2.4 billion Euros. France, Great Britain, USA, and Austria trail far behind this figure [2]. In addition to “traditionally” promoted Christmas markets, “Medieval Christmas markets” are becoming increasingly popular. Both kinds of markets rely on portraying medieval traditions but operate in entirely different ways. Both represent different aspects of popular historical use.
Local history as a backdrop
From the point of view of historical use and the creation of meaning derived from the historical context, the “traditional” Christmas market is the most common type of market. Here a medieval or seemingly medieval architectural ambience is used to generate settings of solid traditional value: a town square bordered by half-timbered buildings (Fachwerkhäuser) adjacent to a church, a castle, narrow alleys lined by small market stalls, conjuring up the image of simplicity and manageability of a quaint hamlet. The market’s importance, its potential touristic value, as well as its number of visitors increase significantly with the actual or even merely fictional evidence of a continuous local history dating back to medieval times.
“The Medieval Christmas market” – a winter event?
Though medieval markets are an ever-increasing occurrence during summer time, medieval Christmas markets have well secured their niche within the short winter season. Local or regional historical ties are of no relevance. It is again the venue of “medieval Inspiration” that enhances the experience in this type of market as well. “The” Middle Ages as the era of religious authenticity are not being portrayed at these venues, quite to the contrary: Following the global trend of self-dynamic commercialization, Christian symbolism as well as the historical meaning of Christmas are not only being pushed aside but are completely losing their importance in this version of a Christmas market. Musical performances, fire breathing, selling handcrafted products, a pillory, “medieval” food and games are all part of the festivities in summer as well as in winter. Only the hot bath in the tub is a specific seasonal affair. “Market” and “experience” are the missing links between “the” Middle Ages and Christmas. Imaginations of an era of clarity, simplicity, and primitiveness of the pre-industrial ways of life combined with a pleasant feeling of responsible consumer behaviour may for some visitors perfectly combine memories and projections of a Christmas “as it used to be”. They can also merge seamlessly into the world of myths and fairy tales, demonstrated particularly well by the example of the “Medieval Fairy Tale Christmas Market” in Oppenheim. Other guests, by contrast, may prefer the obvious simulation and re-enactment of popular medieval images as a winterly “event” rather than one of staging a continuous preservation of Christmas traditions.
Use of history between continuity and alterity
“Traditional or medieval, we ensure that you are well looked after”.[3] The highly successful “Christmas and Medieval Market” in Esslingen combines the variations and aspects of both forms of “historical” Christmas markets outlined above. In this example, showmen of summer fairgrounds and performers of the “medieval scene” are working side by side. During the Advent season, both groups evoke a picturesque and seemingly medieval “past”, alternating between the mode of continuity and the mode of alterity. At the Christmas markets, most showmen earn the money to finance their modern rides at the summer fairgrounds. Some of them need a greater era-flexibility than their counterparts from the medieval scene: Whereas the creation of the medieval Christmas market-tradition goes back to the 19th century, the staging of historical folk festival traditions is a newly observed trend. Separate historical areas at the Oktoberfest, at the Volksfest in Nuremberg, or in Straubing are defined for those visitors who are appalled by the commercialization and carnivalisation of folk festivals. These “historical areas” are equipped with historic carousels and vintage trucks, and draught beer is served from wooden barrels in earthenware jugs.
In these cases historical images of the long-lasting 19th century turn into the era of reference for a traditional construction of meaning.
____________________
Literature
- Valentin Groebner, ‘Arme Ritter. Moderne Mittelalterbegeisterungen und Selbstbilder der Mediävistik,’ in: Thomas Martin Buck/Nicola Brauch (Ed.): ‘Das Mittelalter zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Probleme, Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis’. (Münster: Waxmann, 2011), pp. 336-345.
- Gunther Hirschfelder, ‘Kultur im Spannungsfeld von Tradition, Ökonomie und Globalisierung: Die Metamorphosen der Weihnachtsmärkte,’ in: Zeitschrift für Volkskunde 110 (2014), pp. 1-32.
- Sven Kommer, ‘Mittelaltermärkte zwischen Kommerz und Historie,’ in: Thomas Martin Buck/Nicola Brauch (Ed.): ‘Das Mittelalter zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Probleme, Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis’. (Münster: Waxmann, 2011), pp. 183-200.
External link
- List of famous Christmas markets in German-speaking Europe: http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de (last accessed 22.12.2014).
____________________
[1] http://www.dsbev.de/fileadmin/user_upload/Marktstudie%20Volksfeste_DSB%202013_Kurzfassung_final.pdf (last accessed 22.12.2014).
[2] http://de.statista.com/statistik/daten/studie/362443/umfrage/anzahl-der-besuche-von-weihnachtsmaerkten-in-europa-und-den-usa-nach-laendern/ (last accessed 22.12.2014).
[3] http://www.esslingen.de/,Lde/start/es_themen/Mittelalter_+und+Weihnachtsmarkt.html (last accessed 22.12.2014).
____________________
Image Credits
© Katja Zapf (Student assistant of history didactics at the University Erlangen-Nuremberg). Stalls at the medieval Christmas market in Erlangen 2014.
Recommended Citation
Bühl-Gramer, Charlotte: “‘Tis the Season?” Staging Christmas markets. In: Public History Weekly 3 (2015) 1, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3228.
Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
Deutsch
85 Millionen Besucher zählen die rund 1500 Weihnachtsmärkte in Deutschland. Seit dem Jahr 2000 verzeichnen sie ein Plus von 70 Prozent.[1] Der für 2014 prognostizierte Umsatz beläuft sich auf 2,4 Milliarden Euro, mit weitem Abstand folgen Frankreich, Großbritannien, die USA und Österreich.[2] Neben den als “traditionell” beworbenen Weihnachtsmärkten boomen vor allem “Mittelalter-Weihnachtsmärkte”. Beide Formen agieren in unterschiedlicher Weise mit Mittelalterbildern. Beide Varianten repräsentieren unterschiedliche Funktionen von populärem Geschichtsgebrauch.
Lokalhistorisches Setting als Kulisse
Unter dem Aspekt von Geschichtsnutzung und historischen Sinnstiftungsangeboten ist der als “traditionell” beworbene Weihnachtsmarkt die häufigste Form. Als Generatoren und Stabilisatoren traditionsbasierter Settings fungieren dabei häufig mittelalterliche bzw. mittelalterlich anmutende bauliche Ensembles: ein von Fachwerkbauten gesäumter städtischer Marktplatz mit angrenzender Kirche, eine Burganlage und der Aufbau enger Budengassen, die Konnotationen dörflicher Überschaubarkeit aufrufen. Bedeutsamkeitszuweisung, touristisches Vermarktungspotenzial und Besucherzahlen steigen signifikant mit dem Nachweis bzw. der Konstruktion oder Fiktion einer bis ins Mittelalter zurückreichenden lokalhistorischen Kontinuität des Marktes.
Ein Winterevent?
Neben einer stark ausgeweiteten Sommersaison für Mittelaltermärkte hat sich mit den Mittelalter-Weihnachtsmärkten eine weitere Kurzsaison im Winter fest etabliert. Lokal- oder regionalgeschichtliche Verortungen haben keine Relevanz. Ein als „mittelalterlich“ konnotierter Veranstaltungsort steigert auch hier das Anmutungserlebnis. “Das” Mittelalter als Epoche religiöser Authentizität wird dabei nicht inszeniert, im Gegenteil: Christliche Symbolik wie auch der historische Anlass des Weihnachtsfestes werden im Zuge des allgemeinen Trends eigendynamischer Kommerzialisierung nicht nur zurückgedrängt. Sie spielen bei dieser Form des Weihnachtsmarktes überhaupt keine Rolle. Musikdarbietungen, Feuerspucken, Verkauf kunsthandwerklicher Produkte, ein Pranger, “mittelalterliche” Speisen und Spiele gehören sommers wie winters zum Programm. Lediglich das heiße Bad im Zuber ist ein spezifisch jahreszeitliches Angebot. “Markt” und “Erlebnis” bilden die Missing Links zwischen “dem” Mittelalter und Weihnachten. Epochenimaginationen von Überschaubarkeit, Einfachheit und Ursprünglichkeit vorindustrieller Lebensweisen und ein damit einhergehendes angenehmes Konsumgefühl mögen dabei für manche Besucher besonders gut mit Erinnerungen und Projektionen von einem Weihnachten, wie es “früher” war, in Einklang zu bringen sein. Sie können auch bruchlos in die Welt der Mythen und Märchen übergehen: Das zeigt das Beispiel des “Mittelalter-Märchenweihnachtsmarkts” in Oppenheim.
Andere Gäste präferieren möglicherweise die offensichtliche Simulation und Reinszenierung populärer Mittelalterbilder als winterlicher “Event” anstelle inszenierter Kontinuität weihnachtlicher Traditionen.
Zwischen Kontinuität und Alterität
“Ob mittelalterlich oder traditionell, für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt.”[3] Der äußerst erfolgreiche “Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt” bedient beide hier skizzierten Formen und Funktionen “historischer” Weihnachtsmärkte. Schausteller und Akteure der „Mittelalter-Szene“ arbeiten hier Seite an Seite. Beide evozieren in der Adventszeit ein mittelalterlich anmutendes pittoreskes “Früher”, einmal im Modus der Kontinuität, einmal im Modus der Alterität.
Die meisten Schausteller verdienen auf den Weihnachtsmärkten das Geld für neue Fahrgeschäfte auf den Volksfesten. Einige von ihnen brauchen eine höhere Epochenflexibilität als ihre Kollegen aus der Mittelalterszene: Während die Traditionskonstruktionen von mittelalterlichen Weihnachtsmärkten bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, ist die seit einigen Jahren zu beobachtende Inszenierung historischer Festtraditionen ein neuer Trend: Mit der “Oiden Wiesn” auf dem Oktoberfest, dem “Nostalgiepark” auf dem Nürnberger Volksfest oder dem historischen Bereich auf dem Straubinger Gäubodenfest werden gesonderte Areale mit historischen Fahrgeschäften, Zugmaschinen und Bierausschank aus Holzfässern in Steinkrügen für Besucher ausgewiesen, die sich von der Kommerzialisierung und Karnevalisierung der Volksfeste abgestoßen fühlen.
Hier werden Geschichtsbilder des langen 19. Jahrhunderts zur Referenzepoche traditionaler historischer Sinnbildung.
____________________
Literatur
- Groebner, Valentin: Arme Ritter. Moderne Mittelalterbegeisterungen und Selbstbilder der Mediävistik. In: Thomas Martin Buck/Nicola Brauch (Hrsg.): Das Mittelalter zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Probleme, Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis. Münster 2011, S. 336-345.
- Hirschfelder, Gunther: Kultur im Spannungsfeld von Tradition, Ökonomie und Globalisierung: Die Metamorphosen der Weihnachtsmärkte. In: Zeitschrift für Volkskunde 110 (2014), S. 1-32.
- Kommer, Sven: Mittelaltermärkte zwischen Kommerz und Historie, in: Thomas Martin Buck/Nicola Brauch (Hrsg.): Das Mittelalter zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Probleme, Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis. Münster 2011, S. 183-200.
Externe Links
- Verzeichnis der bekanntesten Weihnachtsmärkte im deutschsprachigen Raum: http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de (zuletzt am 22.12.2014).
____________________
[1] http://www.dsbev.de/fileadmin/user_upload/Marktstudie%20Volksfeste_DSB%202013_Kurzfassung_final.pdf (zuletzt am 22.12.2014).
[2] http://de.statista.com/statistik/daten/studie/362443/umfrage/anzahl-der-besuche-von-weihnachtsmaerkten-in-europa-und-den-usa-nach-laendern/ (zuletzt am 22.12.2014).
[3] http://www.esslingen.de/,Lde/start/es_themen/Mittelalter_+und+Weihnachtsmarkt.html (zuletzt am 22.12.2014).
____________________
Abbildungsnachweis
© Katja Zapf (Studentische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg). Verkaufsstände auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Erlangen 2014.
Empfohlene Zitierweise
Bühl-Gramer, Charlotte: “Es weihnachtet sehr?” Inszenierte Weihnachtsmärkte. In: Public History Weekly 3 (2015) 1, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-3228.
Copyright (c) 2015 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: julia.schreiner (at) degruyter.com.
The post “`Tis the Season?” Staging Christmas markets appeared first on Public History Weekly.
Quelle: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/3-2015-1/tis-season-staging-christmas-markets/