Jeder Blogger kennt die Massen an Statistiken, die im Backend lauern – Zahlen über Zahlen, Monat für Monat. Bei MusErMeKu begegnen uns diese Zahlen nun seit genau 2 Jahren, denn am 22. April 2013 ging der erste Blogbeitrag online und das bedeutet: Wir haben nun schon unseren 2. Bloggeburtstag gefeiert! Anlässlich unseres 1. Geburtstags haben wir die Gelegenheit genutzt, die Entwicklung des Blogs Revue passieren zu lassen. In diesem Jahr wollen wir nun einen Einblick in unsere Statistiken gewähren und erklären, was dahinter steckt. Aber vorweg: … Zwei Jahre MusErMeKu, Oder: Wie interpretiert man Blog-Statistiken? weiterlesen →
Sowjetische Kriegsgräberstätten in Deutschland
Seit dem 24. April 2015 ist die Datenbank „Sowjetische Kriegsgräberstätten in Deutschland“ online unter http://www.sowjetische-memoriale.de/. Die Dokumentation des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst, gemeinsam mit dem Büro für Kriegsgräberfürsorge und Gedenkarbeit der Russischen Botschaft und mit Unterstützung vieler Menschen erarbeitet, bietet ein bundesweites Verzeichnis der Standorte, an denen Gräber sowjetischer Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs und ihnen gewidmete Denkmale existieren. Auch die Gräberorte der russischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs werden erfasst. Trotz unserer Bemühungen um eine möglichst genaue und vollständige Erfassung aller entsprechenden Standorte können wir keinen … Sowjetische Kriegsgräberstätten in Deutschland weiterlesen →
Der Kampf der Erinnerungen war gestern, oder wie sich Erinnerungskultur gegen den Strich denken lässt
Das englische Adjektiv „multidirectional“ ist ein ziemlich technischer Begriff. Auf gut Deutsch bedeutet er „Mehrrichtungs-“ oder „Mehrwegs-“ und als erstes kommt einem da die Mehrwegflasche in den Sinn. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Rothberg hat „multidirectional“ trotzdem auf Kultur angewandt. „Multidirectional Memory“ ist ein Versuch, Erinnerungskultur in mehrere Richtungen, sozusagen gegen den Strich, zu denken. Damit stellt „Multidirectional Memory“ ein Modell vor, das eine interdisziplinäre und transnationale Untersuchung von Erinnerungskultur stützt.
Erinnerungskultur, oder „memory“ – wie man im Englischen sagt, verarbeitet individuelle Erfahrungen kulturell zu Sinn und macht sie dadurch verständlich und bedeutsam (Kantsteiner 2002:189). Rothberg verwendet „memory” als Begriff für die soziale Praxis des Erinnerns. Es geht ihm um den Prozess des Wachrufens und Verdrängens, des Aktivierens und Blockierens von Erfahrungen.
Heute wird Erinnerungskultur häufig in den Kategorien „Opfer“ und „Täter“ gedacht (Vgl. Buruma 1999; Jureit / Schneider 2010; Schulze Wessel / Franzen 2012). „Opfer“ und „Täter“ sind dabei zu kollektiven und identitätsstiftenden Zuschreibungen geworden.
Rothbergs Ausgangsfrage lautete: Wie lässt sich die Beziehung zwischen verschiedenen Opfergeschichten neu erörtern?
Auf die Gedenkjubiläen im Jahr 2015 bezogen, könnte die Frage lauten: Welche Rolle spielt die Erinnerung an den Holocaust heute für die Erinnerung an den Genozid an den Armeniern? Oder welche Rolle spielt die aktuelle Verfolgung und Vernichtung der Jesiden aus dem Irak für die Erinnerung an den Genozid in Bosnien vor 20 Jahren?
Rothberg hat theoretische und literarische Arbeiten seit den 50er und 60er Jahren analysiert, die sowohl die Vernichtung der europäischen Juden als auch die Verbrechen während der Entkolonialisierung gleichzeitig verhandeln. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Annahme eines Wettbewerbs zwischen verschiedenen Opfergeschichten analytisch wenig gewinnbringend sei: “Against the framework that understands collective memory as competitive memory – as a zero-sum struggle over scarce resources – I suggest that we consider memory as multidirectional: as subject to ongoing negotiation, cross-referencing, and borrowing; as productive and not private.” (Rothberg 2009:3).
Die Annahme also, dass es einen Kampf der Erinnerungen gäbe, die um öffentliche Dominanz ringen, sollte hinterfragt werden. Denn dieser Annahme liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine bestimmte Gruppe eine einzigartige Geschichte, Kultur und Identität habe. Nimmt man jedoch die Parallelen, Bezüge und Ähnlichkeiten zwischen unterschiedlichen kollektiven Opfergeschichten in den Blick, so wird deutlich, dass ein exklusives Verständnis von kultureller Identität schwer haltbar ist. Mit einer derartigen Betonung der Interaktionen zwischen den Erinnerungsprozessen divergierender Gruppen trägt Rothberg dem Denken Rechnung, dass Gedächtnis und Identität keine klar umrissenen Gegebenheiten sind, sondern sich wandelnde, komplexe und immer wieder auch in Frage zu stellende kulturelle Phänomene bedeuten.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Rothberg verneint nicht die Existenz von Opferkonkurrenzen, sondern er weist auf die Notwendigkeit hin diese zu hinterfragen. Dafür entwickelt er ein dem Konkurrenzdenken gegenläufiges Modell: nämlich die Gemeinsamkeiten und Bezugnahmen zwischen verschiedenen kollektiven Opfergeschichten zu untersuchen.
Rothberg schlägt vor, die weltweite Erinnerung an den Holocaust als etwas zu verstehen, das andere Opfergeschichten nicht blockiert, sondern ihrer Artikulation dient. Dabei funktioniere die Bezugnahme der Geschichten jenseits ihrer zeitlichen und räumlichen Verortung – „multidirectional“. Ereignisse, die vor dem Holocaust stattgefunden haben, wie beispielsweise der Genozid an den Armeniern, oder auch danach, wie der Genozid in Bosnien und Herzegowina, werden mit Referenz aufeinander öffentlich erinnert.
Dabei geht es nicht darum, historische Ausmaße, Kontexte und Folgen in ihrer Faktizität zu vergleichen, sondern um den Akt der gegenwärtigen öffentlichen Artikulation. Es geht darum, dass etwas sagbar wird und zwar öffentlich, also kollektiv mitteilbar. Letztlich zielt diese öffentliche Artikulation der Opfergeschichten auf die kollektive Anerkennung des Leidens. Durch die Bezugnahme auf andere Opfergeschichten kann die Artikulation gestärkt werden.
Mit „multidirectional“ meint Rothberg aber auch, die Verbindungen zwischen der Benennung gegenwärtig stattfindender Missetaten und historischer Verbrechen zu reflektieren. Dies veranschaulicht er, indem er die Gleichzeitigkeit der Entkolonialisierung mit dem Aufkommen einer öffentlichen Holocaust-Erinnerung in den Blick nimmt. Während der Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem stattfand und die öffentliche Artikulation der Geschichten von Holocaust-Überlebenden förderte, tobte in Algerien der Unabhängigkeitskrieg mit der französischen Kolonialmacht. Rothberg setzt sich mit verschiedenen Beispielen auseinander, die zu jener Zeit Folter, Staatsterror und Vernichtung in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und während des Algerienkriegs behandeln. Die gerade stattfindende Gewalt und der Rassismus beeinflusste, insbesondere in Frankreich, die aufkommende öffentliche Erinnerung an vergangene extreme Gewalt und Ausgrenzung (Rothberg 2009:192).
Dass bei Rothberg die Entkolonialisierung im Zusammenhang mit der öffentlichen Thematisierung des Holocausts gedeutet wird, muss hier deswegen betont werden, weil etwa Aleida Assmann bereits in ihrer Auseinandersetzung mit Levy / Snayder 2007 vorgeschlagen hatte, die Holocaust-Erinnerung als ein Paradigma zu begreifen, auf welches sich andere Genozide und Traumata beziehen (Assmann 2007:14). Die umgekehrte Denkrichtung jedoch, also dass auch andere Verbrechen die Artikulation des Holocaust beeinflussen können, macht diesen Vorgang erst „multidirectional”.
Eine weitere Dimension der „Mehrseitigkeit“ von Erinnerungsprozessen unterfüttert Rothberg theoretisch, indem er sich auf Sigmund Freuds psychoanalytischen Begriff der „Deckerinnerung“ bezieht (Freud 1907). Freuds „Deckerinnerung“ beschreibt einen Vorgang, bei dem etwas Banales, Alltägliches im Detail erinnert wird und zwar um etwas Singuläres, Schwerwiegendes zu überdecken. Es geht darum, wie Erinnerung auch dazu verwendet werden kann, um etwas anderes zu verdrängen. Erinnern um zu vergessen, könnte man salopp formulieren.
Obwohl Rothberg kritisiert, dass Freuds Erkenntnisse aus der Individualpsychologie schwer auf Kollektive zu übertragen sind, gebraucht er „Deckerinnerung“, um auf die Mehrdeutigkeit von kollektiven Erinnerungsprozessen zu verweisen. Beispielsweise nennt er die weitreichende Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust in den USA eine „Deckerinnerung“, welche die unangenehmen Erinnerungen an die Sklaverei und den Genozid an den eingeborenen Völkern abdämpfe (Rothberg 2009:195). Die englische Übersetzung von „Deckerinnerung“ als „screen memory“ weist aber über das bloße Überdecken und Filtern von Erinnerungen hinaus und schließt ein Projizieren und Raum-Geben mit ein.
Was bringt nun dieser Blick für das Gemeinsame verschiedener kollektiver Opfergeschichten?
Die Untersuchung der Verbindungen zwischen verschiedenen Opferartikulationen zeigt, dass es bei allen um die Erfahrung des Andersseins geht. Zweitens steht das Ringen um öffentliche Anerkennung der Anderen im Mittelpunkt. Drittens beschreibt Rothberg das Zeugnis-Ablegen als die wirkmächtigste Form um Gewalt aufzudecken. Der Umgang mit Differenz und die Beteiligung von marginalisierten Gruppen an dem, was öffentlich über die Vergangenheit eines Gemeinwesens verhandelt wird, sind folglich zwei Aspekte, die bei der Untersuchung von Erinnerungskultur aus transnationaler Perspektive eine wesentliche Rolle spielen.
Dabei besteht die Möglichkeit, dass sich Opfergeschichten und Opfergruppen gegenseitig unterstützen und nicht bekämpfen. So wurde die öffentliche Kundgebung zur Anerkennung des Genozids an den Armeniern am 24. April 2015 in Istanbul von Kurden, Griechen und Assyrern breit unterstützt. Und in Bosnien und Herzegowina hat beispielsweise die Opferorganisation “Izvor” aus Prijedor zum Gedenken an den armenischen Genozid aufgerufen. “If memory is as susceptible as any other human faculty to abuse […] this study seeks to emphasize how memory is at least as often a spur to unexpected acts of empathy and solidarity; indeed multidirectional memory is often the very grounds on which people construct and act upon visions of justice.” (Rothberg 2009:19)
Rothbergs französische Version von „multidirectional memory“ lautet „nœuds de mémoires“ (Rothberg, Sanyal and Silverman 2010). Darin klingen phonetisch Pierre Noras „lieux de mémoires“ an, ins Deutsche übersetzt hieße „nœuds de mémoires“ so viel wie „Erinnerungsknoten“ oder verflochtene Erinnerungen.
Meines Erachtens geht es aber um mehr als um Verflechtungen. Es geht darum, Erinnerungskultur anders zu verstehen. Denkt man europäische Geschichte von ihren Zivilisationsbrüchen aus, so sollte neben dem Holocaust auch dem Kolonialismus Aufmerksamkeit zuteilwerden. Rothbergs „Multidirectional Memory“ veranschaulicht, wie sich dann unser Verständnis von Erinnerungskultur verändert. Durch die Betonung des Zeugnis-Ablegens als wirkmächtigste Form der Artikulation erfahrener Gewalt rückt er ins Zentrum, dass in einem derart komplexen Kontext die individuelle Erinnerung mehr Gewicht erhält. Erst eine öffentliche Artikulation des Zeugnisses jedoch macht es kollektiv wirksam. So erfolgt eine Pluralisierung von Erinnerungskultur und ihre Privatisierung wird verhindert. Das Zusammenfügen der individuellen Geschichten zu einem Narrativ aber ist dann nicht mehr das Ziel, sondern das Ziel wird die Betrachtung ihrer gegenseitigen Bezüge, „multidirectional“ eben.
Literatur
Assmann, Aleida. 2007. “Europe: A Community of Memory?” German Historical Institute Bulletin:11–25.
Buruma, Ian. 1999. The Joys and Perils of Victimhood.
Freud, Sigmund. 1907. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube u. Irrtum, Berlin: Karger.
Jureit, Ulrike, and Christian Schneider, Hgs. 2010. Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart: Klett-Cotta.
Kantsteiner. 2002. “Finding Meaning in Memory. A Methodological Critique of Collective Memory Studies” History and Theory. 41:179–197.
Levy, Daniel and Natan Snayder. 2007. Erinnerung im globalen Zeitalter: der Holocaust. 3870 : Suhrkamp Globalisierung, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Rothberg, Michael. 2009. Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Stanford: Stanford University Press.
Rothberg, Michael, Debarati Sanyal, and Maxim Silverman, Hgs. 2010. Yale French studies, no. 118 & 119, Noeuds de mémoire. Multidirectional memory in postwar French and francophone culture, New Haven, Conn.: Yale University Press.
Schulze Wessel, Martin, and K. E. Franzen, Hgs. 2012. Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 5, Opfernarrative. Konkurrenzen und Deutungskämpfe in Deutschland und im östlichen Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, München, Oldenbourg: Oldenbourg Verlag.
Neues Weblog von Wolfgang Schmale: Mein Europa
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022424840/
Digitale Geschichtswissenschaft ist keine Wahl, sondern Realität
 Im Lektürekurs und im Proseminar beschäftigt uns ein einleitender Aufsatz über digitale Geschichtswissenschaft besonders intensiv: Der Beitrag von Gerben Zaagsma „On digital history“, erschienen 2013 in den BMGN und online hier zugänglich1. Ich halte diesen Beitrag für die derzeit beste Einführung in die Materie auf knappem Raum. Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte der Digital Humanities2, erläutert er die Entwicklung in den Niederlanden sowie exemplarisch zwei Bereiche, in denen sich die Geschichtswissenschaft durch den digital turn besonders gewandelt hat und weiterhin wandelt. Dabei unterstreicht Zaagsma, das derzeit in den Debatten zu sehr auf Werkzeuge und Daten geachtet wird und zu wenig darauf, wie sich „Geschichte machen“ durch den digital turn ändert. Methodologische und epistemologische Überlegungen müssten mit Blick auf die neue digitale Praxis stärker in den Mittelpunkt rücken3.
Im Lektürekurs und im Proseminar beschäftigt uns ein einleitender Aufsatz über digitale Geschichtswissenschaft besonders intensiv: Der Beitrag von Gerben Zaagsma „On digital history“, erschienen 2013 in den BMGN und online hier zugänglich1. Ich halte diesen Beitrag für die derzeit beste Einführung in die Materie auf knappem Raum. Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte der Digital Humanities2, erläutert er die Entwicklung in den Niederlanden sowie exemplarisch zwei Bereiche, in denen sich die Geschichtswissenschaft durch den digital turn besonders gewandelt hat und weiterhin wandelt. Dabei unterstreicht Zaagsma, das derzeit in den Debatten zu sehr auf Werkzeuge und Daten geachtet wird und zu wenig darauf, wie sich „Geschichte machen“ durch den digital turn ändert. Methodologische und epistemologische Überlegungen müssten mit Blick auf die neue digitale Praxis stärker in den Mittelpunkt rücken3.
Hybridity is the new normal
Die Hauptthese von Zaagsma lautet, dass Digitalität in der Geschichtswissenschaft keine Wahl mehr ist, sondern längst Realität: „going digital is not a choice“4. Dies ist so richtig wie auf den ersten Blick unspektakulär, hat aber tatsächlich weitreichende Konsequenzen. Doch zunächst zur Bestandsaufnahme: Die Praktiken der historischen Forschung haben sich längst verändert. Eine hybride Herangehensweise ist unter Historikerinnen und Historikern mittlerweile normal. „Hybridity is the new normal“, formuliert Zaagsma5. Wobei dies, das müsste man aus meiner Sicht einschränkend dazu sagen, in erster Linie auf die Online-Recherche und schon deutlich weniger auf die Verbreitung/Publikation von Forschungsergebnissen zutrifft. Fast gar nicht trifft es auf die Interpretation zu, denn es ist nach wie vor eher ungewöhnlich, wenn Forschende neben einer qualitativ-hermeneutischen Herangehensweise auch Datenmodellierung wie z.B. Textmining, oder Visualisierungstechniken anwenden. In der Verbindung und Integration der beiden Herangehensweisen, z.B. „close und distant reading“-Methoden zur Auswertung von Quellen, liegt die eigentliche Herausforderung für die zukünftige Geschichtswissenschaft6. Für alle, die Französisch können, sei der Blogbeitrag von Frédéric Clavert nahegelegt, der über die parallele Verwendung dieser Methoden in seinem Blog nachgedacht hat7 – für die deutschsprachigen Leserinnen und Leser bleibt der Kommentar von Peter Haber bei histnet, um einen Eindruck zu erhalten.
Folglich plädiert Zaagsma dafür, digitale Geschichte nicht gegen nicht-digitale Geschichte in Stellung zu bringen. Das sehen auch Teile unserer Community so, wie eine Twitterumfrage vor gut einem Jahr an den Tag brachte8. In diesen von Jan Hecker-Stampehl initiierten (Massen-)Interviews sollte man den Satz ergänzen „Digitale Geschichtswissenschaft ist für mich…“. Die lesenswerten Antworten sind in einem Storify gespeichert. Sie spiegeln in unterschiedlichem Maße zwar, aber doch deutlich wider, dass digitale Geschichtswissenschaft nicht von der analogen zu trennen ist.
@digigw nichts anderes als das Nutzen unserer heutigen Mitteln, um Antworten zu finden auf alte & neue Fragen, die Historiker sich stellen”.
— Franziska Heimburger (@FHeimburger) 14. März 2014
Oder noch deutlicher:
@digigw Geschichtswissenschaft. Wir müssen mal von diesen exotischen Diskussionen wegkommen….
— Gudrun Gersmann (@GGersmann) 10. März 2014
Es ist also an der Zeit, die ohnehin zumeist künstliche Dichotomie zwischen quantitativer und qualitativer Geschichte, zwischen analoger und digitaler Geschichte ad acta zu legen (ein frommer Wunsch, ich weiß). Schon jetzt gibt es keine nicht-digitale Geschichtswissenschaft mehr, und damit ist nicht gemeint, dass alle Historikerinnen und Historiker mittlerweile halbwegs autonom Mail- und Textverarbeitungsprogramme anwenden können. Alle arbeiten bereits digital, auch diejenigen, die sich nicht zu den digitalen Vorreitern zählen und digitale Geschichtswissenschaften ablehnen oder für vernachlässigbar halten.
Mangelnde Reflektion als Gefahr
Die eigentliche Gefahr liegt in dieser indifferenten Haltung, unterbleibt doch so die notwendige Auseinandersetzung mit den Konsequenzen des digital turns für die Geschichtswissenschaft. Um in der digitalen Welt zu forschen, werden bestimmte Techniken und Kenntnisse benötigt für die Suche in Katalogen, Datenbanken, Volltextplattformen, Suchmaschinen (oftmals sind nicht mal die Unterschiede bekannt), für die Prozessierung der so gefundenen Information, Literatur und Daten, für ein wissenschaftliches Monitoring wie auch für die Kommunikation über und die Publikation der Forschungsergebnisse, die sich längst nicht mehr auf traditionelle Formen beschränkt. Die meisten Historikerinnen und Historiker tun all dies, d.h. sie recherchieren online, sie verwenden digitale Quellen, wenden digitale Tools an etc., doch ohne dass dies ausreichend reflektiert würde.
Wie man sucht und welche Suchergebnisse man erhält, beispielsweise, wirkt sich aber auf die eigene Forschung aus und ist daher wichtig, wenn nicht zentral9. Wie ist damit umzugehen, dass innerhalb von wenigen Sekunden riesige Datenmengen zur Verfügung stehen? Auch wenn die Ergebnismenge durch dringend zu lernende Suchoptimierung eingeschränkt werden kann: Vollständigkeit kann keine Prämisse der historischen Arbeit mehr sein.
Und damit sind wir bei der Frage, wie sich Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter verändert. Zaagsma macht dies an zwei Beispielen fest: zum einen an der Digitalisierung von Quellen und Archivmaterialien, zum anderen am Umgang und der Interpretation dieser digitalen Ressourcen.
Änderungen der Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter
Zunächst zur Digitalisierung: Zaagsma hebt hervor, dass Digitalisierung immer eine Auswahl beinhaltet und somit eine „Politik der Digitalisierung“ ist. Wenn bestimmte Quellen oder Archivalien digitalisiert werden, bedeutet das gleichzeitig, dass andere nicht digitalisiert werden. Historikerinnen und Historiker sollten sich daher aus seiner Sicht stärker für die Frage interessieren, wieso bestimmte Bestände online zugänglich sind und andere nicht. Digitalisierung wird von staatlichen Institutionen vorangetrieben und ist vielfach eine nationale Angelegenheit. Das schlägt sich auf die Auswahl der digitalisierten Quellen nieder. Als Beispiel nennt er die Digitalisierungsprojekte in Osteuropa, in denen sich “nationaler Stolz und die Unabhängigkeit der post-kommunistischen Ära spiegele”10. Ähnliches ließe sich über Westeuropa auch sagen, man denke nur an Gallica, die Online-Plattform der französischen Nationalbibliothek. Und wie Zaagsma richtig erwähnt, ist auch die Europeana lediglich die Addition der nationalen Digitalisierungsprojekte und kein Projekt mit genuiner europäischer Blickrichtung.
Genauso wenig wie digitale Werkzeuge neutral sind, da sie Vorannahmen und Urteile enthalten, sind Digitalisierungsprojekte neutral. Die derzeitige Digitalisierungspraxis wird die Themen der Historikerinnen und Historiker von morgen vorgeben, da bevorzugt über das geforscht wird, was leicht zugänglich, d.h. online zu finden ist. Derzeit erlebt die nationale Geschichte über die Digitalisierungspraxis der einzelnen Länder ein Comeback, während Marginales weiter marginalisiert wird. Nicht vergessen werden darf darüber hinaus, dass ein Großteil des Archivmaterials nicht digitalisiert ist und auch nie sein wird.
Digitale historische Analyse
Ebenso wichtig ist es aus der Sicht von Zaagsma, dass sich Historikerinnen und Historiker stärker mit der Frage befassen, wie die Arbeit mit digitalisierten Quellen unsere Quellenkritik und Quellenarbeit beeinflusst. Die Arbeit mit Online-Quellen bringt zum einen den Verlust des Kontextes mit sich. So werden in Online-Portalen etwa tausende Zeitungsartikel auf bestimmte Suchwörter durchsucht und die Ergebnisse in einer Liste angezeigt. Die Ansicht der ganzen Seite einer Tageszeitung oder ihrer ganzen Ausgabe geht dabei verloren, wenn man nicht explizit diese erneut aufruft. Zum anderen gehen bestimmte haptische Erfahrungen der Arbeit mit Online-Quellen verloren, und auch deren Materialität (Geruch). Zaagsma plädiert daher für eine neue digitale Quellenkritik, mit der man sich bisher noch zu wenig beschäftigt hat. Wirkliche Antworten, das hatten wir andernorts bereits festgestellt, gibt es darauf noch nicht.
Zentral ist darüber hinaus – das sei abschließend erwähnt – die Ausbildung der Studierenden, die neben wichtigen Online-Kenntnissen wie Recherche, Auswertung und Publikation auch in kritischer Reflexion der digitalen Praktiken geschult werden sollten.
- Zaagsma, Gerben, On Digital History, in: BMGN – Low Countries Historical Review, 128-4 (2013) S. 3-29. URN:NBN:NL:UI:10-1-110020
- Zaagsma gibt übrigens ebenso wie Peter Haber als erste DH-Konferenz das internationale Kolloquium „The Use of Computers in Anthropology“ 1962 in Burg Wartenstein (ibid., S. 7) an, was uns Österreicher freut, aber auch Anlass gibt, dieser Darstellung einmal nachzugehen und zu fragen, ob das die anglo-amerikanischen Digital Humanists ebenfalls so sehen. Das wird in Kürze in einem eigenen Blogbeitrag geschehen.
- Ibid., S. 24.
- Ibid. S. 14.
- Ibid, S. 17.
- Vgl. ibid., S. 24.
- Vgl. Frédéric Clavert, Lecture des sources historiennes à l’ère numérique, in: L’histoire contemporaine à l’ère numérique, 14.11.2012, http://histnum.hypotheses.org/1061. Siehe auch den Kommentar von Peter Haber bei histnet: http://weblog.hist.net/archives/6563.
- Vgl. Jan Hecker Stampehl, Dokumentation der Twitter-Umfrage “Digitale Geschichtswissenschaft ist für mich…”, in: Digitale Geschichtswissenschaft, 5.4.2014, http://digigw.hypotheses.org/697.
- Vgl. ibid., S. 25.
- Vgl. ibid, S. 20.
Quelle: http://dguw.hypotheses.org/161
Einladung zum 9. Berliner DH-Rundgang am 13. Mai 2015
Der Interdisziplinäre Forschungsverbund Digital Humanities in Berlin (ifDHb) lädt zum 9. Berliner DH-Rundgang ein:
Termin: Mittwoch, 13. Mai 2015, 10:00(s.t.)-11:30 Uhr.
Institut: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.
Ort: Oberwallstraße 9, 10117 Berlin, 6. OG.
Zur Anmeldung zum 9. Berliner DH-Rundgang.
via Larissa Wunderlich:
Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft erforscht die dynamische Beziehung von Internet und Gesellschaft aus verschiedenen disziplinären und interdisziplinären Perspektiven. Die Forschungsagenda des Instituts unterstreicht die zunehmende Verflechtung digitaler Infrastrukturen mit dem alltäglichen Leben. Unser gemeinsames Ziel ist es, die fortwährende Veränderung des Internets und seiner Dienste zu betrachten. Den Schwerpunkt setzen wir dabei auf kritische Momente und strukturelle Verschiebungen. Wir verstehen uns als Plattform für Forscher im Bereich Internet und Gesellschaft und fördern die kooperative Entwicklung von Projekten, Anwendungen und Forschungsnetzwerken. Durch unterschiedliche Formate teilen wir unsere wissenschaftliche Arbeit mit der interessierten Öffentlichkeit, einschließlich politischer Akteure, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.
Die Digital Humanities stellen die Verknüpfung geisteswissenschaftlicher Fragestellungen mit Instrumenten aus der Informatik dar. Durch Verfahren wie Textmining, Netzwerkanalyse und Maschinenlernverfahren können klassische Forschungsgegenstände der Geisteswissenschaften auf neue Art und Weise und unter Berücksichtigung großer digitaler Datenmengen systematisch untersucht werden. Digitale Archive und Museen machen Kulturgüter zunehmend mit innovativen Techniken digital zugänglich und eröffnen so neue Möglichkeiten für Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das Internet spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
Durch das Internet ergeben sich neue Möglichkeiten der Interaktionen mit digitalen Kulturgegenständen jeglicher Art (etwa in der sog. “virtual citizen science”), für Wissenschaftler und interessierte Laien gleichermaßen. Zudem erweitert sich aber auch das Verständnis dessen, was digitale Kulturdaten sind, durch das Internet entscheidend. Zu Digitalisaten kommen die Texte, Bilder, Videos und Websites hinzu, die in den sozialen Medien generiert werden und die Aufschluss darüber geben, wie Menschen online kommunizieren, Informationen weitergeben und sich kreativ darstellen. Es ergeben sich methodisch zum Teil starke Konvergenzen mit den Sozialwissenschaften, etwa bei Verfahren wie dem Textmining, welches politische Haltungen in der Gegenwartskommunikation ebenso einfangen kann, wie Themen in historischen Korpora. Medieninhalte, die heute in den sozialen Medien generiert werden, sind für die Digital Humanities ebenso relevant wie digitalisierte Kulturgüter, schon allein deshalb, weil sie Darstellungsformen nutzen, mit denen die Geisteswissenschaften sehr vertraut sind (Sprache, Bilder, Ton).
Folgende Fragen werden uns inhaltlich bei diesem Berliner DH-Rundgang leiten:
- Welche technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen spielen im Umgang mit digitalen Kulturgütern eine Rolle?
- Wie kann das Internet für die Interaktion mit digitalen Kulturgütern in Archiven und Museen eingesetzt werden?
- Welche Bedeutung hat das Internet für die Bürgerwissenschaft (“virtual citizen science”)?
- Wie lassen sich innovative computergestützte Verfahren effektiver in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung einsetzen?
Programm
- 10:00 Uhr: Begrüßung (Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Direktorin des HIIG)
- 10:15 Uhr: Was haben Internet und Gesellschaft mit den Digital Humanities zu tun? (Dr. Cornelius Puschmann)
- 10:35 Uhr: Open Science und die Humanities (Benedikt Fecher)
- 10:45 Uhr: Internet Policy Review (Frédéric Dubois)
- Im Anschluss: Rundgang durch das Haus
Zum Vormerken:
Gastgeber des 10. Berliner DH-Rundgangs am 29. Juni 2015, von 16:30-18:00 Uhr, ist das Institut für Informatik / AG Netzbasierte Informationssysteme an der Freien Universität Berlin.
Sie wollen Ihre Institution bei einem Berliner DH-Rundgang vorstellen? Dann schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail an info@ifdhberlin.de oder nehmen Sie telefonisch Kontakt zu uns auf.
Alle Termine des Berliner DH-Rundgangs finden Sie auf der Website: www.ifdhberlin.de/arbeitsfelder/dh-rundgang.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4987
Einladung zum 9. Berliner DH-Rundgang am 13. Mai 2015
Der Interdisziplinäre Forschungsverbund Digital Humanities in Berlin (ifDHb) lädt zum 9. Berliner DH-Rundgang ein:
Termin: Mittwoch, 13. Mai 2015, 10:00(s.t.)-11:30 Uhr.
Institut: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.
Ort: Oberwallstraße 9, 10117 Berlin, 6. OG.
Zur Anmeldung zum 9. Berliner DH-Rundgang.
via Larissa Wunderlich:
Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft erforscht die dynamische Beziehung von Internet und Gesellschaft aus verschiedenen disziplinären und interdisziplinären Perspektiven. Die Forschungsagenda des Instituts unterstreicht die zunehmende Verflechtung digitaler Infrastrukturen mit dem alltäglichen Leben. Unser gemeinsames Ziel ist es, die fortwährende Veränderung des Internets und seiner Dienste zu betrachten. Den Schwerpunkt setzen wir dabei auf kritische Momente und strukturelle Verschiebungen. Wir verstehen uns als Plattform für Forscher im Bereich Internet und Gesellschaft und fördern die kooperative Entwicklung von Projekten, Anwendungen und Forschungsnetzwerken. Durch unterschiedliche Formate teilen wir unsere wissenschaftliche Arbeit mit der interessierten Öffentlichkeit, einschließlich politischer Akteure, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.
Die Digital Humanities stellen die Verknüpfung geisteswissenschaftlicher Fragestellungen mit Instrumenten aus der Informatik dar. Durch Verfahren wie Textmining, Netzwerkanalyse und Maschinenlernverfahren können klassische Forschungsgegenstände der Geisteswissenschaften auf neue Art und Weise und unter Berücksichtigung großer digitaler Datenmengen systematisch untersucht werden. Digitale Archive und Museen machen Kulturgüter zunehmend mit innovativen Techniken digital zugänglich und eröffnen so neue Möglichkeiten für Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das Internet spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
Durch das Internet ergeben sich neue Möglichkeiten der Interaktionen mit digitalen Kulturgegenständen jeglicher Art (etwa in der sog. “virtual citizen science”), für Wissenschaftler und interessierte Laien gleichermaßen. Zudem erweitert sich aber auch das Verständnis dessen, was digitale Kulturdaten sind, durch das Internet entscheidend. Zu Digitalisaten kommen die Texte, Bilder, Videos und Websites hinzu, die in den sozialen Medien generiert werden und die Aufschluss darüber geben, wie Menschen online kommunizieren, Informationen weitergeben und sich kreativ darstellen. Es ergeben sich methodisch zum Teil starke Konvergenzen mit den Sozialwissenschaften, etwa bei Verfahren wie dem Textmining, welches politische Haltungen in der Gegenwartskommunikation ebenso einfangen kann, wie Themen in historischen Korpora. Medieninhalte, die heute in den sozialen Medien generiert werden, sind für die Digital Humanities ebenso relevant wie digitalisierte Kulturgüter, schon allein deshalb, weil sie Darstellungsformen nutzen, mit denen die Geisteswissenschaften sehr vertraut sind (Sprache, Bilder, Ton).
Folgende Fragen werden uns inhaltlich bei diesem Berliner DH-Rundgang leiten:
- Welche technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen spielen im Umgang mit digitalen Kulturgütern eine Rolle?
- Wie kann das Internet für die Interaktion mit digitalen Kulturgütern in Archiven und Museen eingesetzt werden?
- Welche Bedeutung hat das Internet für die Bürgerwissenschaft (“virtual citizen science”)?
- Wie lassen sich innovative computergestützte Verfahren effektiver in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung einsetzen?
Programm
- 10:00 Uhr: Begrüßung (Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Direktorin des HIIG)
- 10:15 Uhr: Was haben Internet und Gesellschaft mit den Digital Humanities zu tun? (Dr. Cornelius Puschmann)
- 10:35 Uhr: Open Science und die Humanities (Benedikt Fecher)
- 10:45 Uhr: Internet Policy Review (Frédéric Dubois)
- Im Anschluss: Rundgang durch das Haus
Zum Vormerken:
Gastgeber des 10. Berliner DH-Rundgangs am 29. Juni 2015, von 16:30-18:00 Uhr, ist das Institut für Informatik / AG Netzbasierte Informationssysteme an der Freien Universität Berlin.
Sie wollen Ihre Institution bei einem Berliner DH-Rundgang vorstellen? Dann schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail an info@ifdhberlin.de oder nehmen Sie telefonisch Kontakt zu uns auf.
Alle Termine des Berliner DH-Rundgangs finden Sie auf der Website: www.ifdhberlin.de/arbeitsfelder/dh-rundgang.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4987
Lesebuch zu linker Geschichtspolitik und kritischer Wissenschaft erschienen
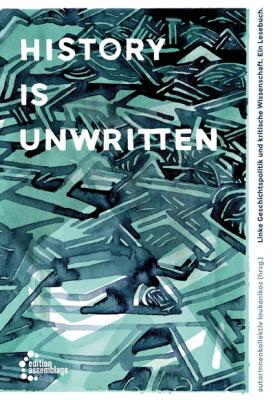 Jetzt ist der formidable Band auch bei mir eingelangt:
Jetzt ist der formidable Band auch bei mir eingelangt:AutorInnenkollektiv Loukanikos (Hg.): History is unwritten. Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft. Ein Lesebuch. Münster: Edition Assemblage, 2015.
Weblog zum Buch: https://historyisunwritten.wordpress.com
Verlags-Info: http://www.edition-assemblage.de/history-is-unwritten/
Mein Beitrag darin (S.224-235) beschäftigt sich mit: "Europa bauen als kritische Geschichtswissenschaft? Zu zwei Büchern von Josep Fontana und Luciano Canfora".
Kurzinfo:
In History is unwritten diskutieren historisch Forschende, Autor*innen, Künstler*innen und politische Initiativen in 25 Wortmeldungen, wie ein emanzipatorischer Umgang mit Geschichte heute aussehen könnte.
Ob Kolonialismus im Kasten oder Tränen in der Wissenschaft, ob Rosa Luxemburg oder Subcomandante Marcos, ob Ausgraben und Erinnern oder Kämpfen und Zweifeln zusammen ergeben die Beiträge einen vielfältigen Eindruck von einer Linken, die sich um die Vergangenheit scheren muss, wenn sie etwas von der Zukunft will.
Die Publikation ist die erweiterte Dokumentation der gleichnamigen Konferenz in Berlin im Dezember 2013.
Inhaltsverzeichnis (PDF)
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022424316/
Minutes of WS “Computer-based analysis of drama” now online
Am 12. und 13. März 2015 hat in München der Workshop Computer-based analysis of drama and its uses for literary criticism and historiography. Die computergestützte Analyse von Dramen ist ein gerade entstehendes Feld, das nur zum Teil an die quantitative Dramenanalyse des 20. Jahrhunderts (Solomon Marcus, Manfred Pfister) anschließt. Digitalisierte Korpora, neue Verfahren des Text Mining und die Verknüpfung von quantitativen Ergebnissen mit Fragen der Literaturgeschichtsschreibung (vgl. Matthew Jockers, Franco Moretti, Stephen Ramsay) haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass neue Forschung zu Dramen entstanden ist, die hier erstmals gebündelt wurde. Lesen Sie den Konferenzbericht in voller Länge hier. Der Blog soll in Zukunft auch eine Bibliographie und eine Liste von Projekten zur computer-gestützten Dramenanalyse bieten. Hinweise sind erwünscht.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4880
Der Hansetag von 1628 – ein Kölner Reisebericht, II
Was den politischen Kontext des Hansetags betrifft, haben wir bereits ausgeführt. Im Folgenden soll es nun um den Bericht der Kölner Gesandten selbst gehen. Auf das Thema Reisen in dieser Epoche sind wir schon einige Male gestoßen und haben die Risiken solcher Unternehmungen herausgestellt, etwa was die Reisen in die Niederlande betraf. Dies war Anfang 1628 nicht anders, und der Bericht atmet durchweg das Bewußtsein für die Gefährlichkeit der Mission. Gleich zu Beginn hält er fest, daß, „weil die Zeiten so gar unselig und gefährlich“, die beiden Gesandten von anderen Herren und Soldaten begleitet wurden. Von einer eigenen (schriftlichen) Salvaguardia ist hier nicht die Rede, doch kann man davon ausgehen, daß die Gesandten vom Kaiserhof, der auf die Kölner Teilnahme am Hansetag gedrängt hatte, auch entsprechende Dokumente erhalten hatten, die man im Falle eines Überfalls hätte vorzeigen können. Doch verließ man sich nicht darauf und brach selbst mit einem Gefolge, das eben auch Bewaffnete umfaßte, auf.
Wie angespannt die Lage war, zeigte sich dann im Münsterland, als die Kölner Reisegruppe zunächst nicht in ein Dorf gelassen wurde – die Bauernschaft schlug die Glocken an, offenbar in der Annahme, es handele sich um einen Trupp Militärs (was potentiell stets Unheil bedeutete). Einige Tage später erhielten die Kölner „ein neue Convoy“, wie es im Bericht hieß: Sie befanden sich nun in der Region, die von Truppen der Katholischen Liga kontrolliert wurde. Entsprechend wurde ihnen hier eine eigene (militärische) Begleitung mitgegeben. Dies verhinderte nicht, daß die Reisegruppe nur zwei Tage später auf „ziemlich trotzige Reiter“ traf. Es blieb aber wohl nur bei einer brenzligen Situation, die ohne Schaden vorüberging. Bei Bremervörde hielten die Reisenden dann an – die begleitenden „Convoyer“ waren übermüdet, und ohne sie trauten sich die Kölner nicht weiter „auch wegen starker Streiferei“ auf den Straßen.
Hier sahen die Reisenden allenthalben auch die Verwüstungen des Kriegs. Diese stellten nicht nur eine bedrückende Erfahrung dar, sondern machte auch das Fortkommen schwierig. Am Ende des Berichts verwiesen Wissius und Lyskirchen auf die Schwierigkeiten, Unterkunft zu finden, „weil fast alles abgebrannt“, sowie auf die „anderen vielen Ungelegenheiten“, mit denen man sich hatte arrangieren müssen.
Immerhin war den Kölnern nichts passiert. Die Gesandtschaft aus Wesel, die 1645 auch an der Nordseeküste unterwegs war, wurde damals von schwedischen Reitern aufgehalten, die Geld erpreßten. Auffällig ist allerdings die unterschiedliche Route: Die Weseler vermieden damals den Landweg nach Norddeutschland und fuhren über niederländisches Gebiet, erst bei Emden kamen sie wieder auf Reichsboden. Die Kölner im Jahr 1628 hielten den direkten Weg offenbar noch für kalkulierbar.
Entsprechend berichteten sie von all ihren Stationen. Dabei ging es nicht allein darum, die Route zu rekonstruieren. Vielmehr hielten die Gesandten genau fest, wie sie an bestimmten Orten aufgenommen wurden. Gleich in Dortmund wurde den Kölnern eine ehrenvolle Aufnahme zuteil: Sie erhielten vom Rat der Stadt Fisch und Wein, der Bürgermeister, der Syndicus und ein Secratarius statteten der Gesandtschaft einen Besuch ab. So gehörte sich das, denn auch Dortmund war Reichsstadt wie Köln, ja Dortmund war auch Mitglied der Hanse, in früheren Zeiten mal ein führendes Mitglied der westfälischen Hansestädte, doch irgendwann hatte Köln alle überrundet. Verbunden waren beide Städte auch durch ihre politische Ausrichtung, denn beide verfolgten einen Neutralitätskurs bei möglichst enger Anlehnung an den Kaiser – was Dortmund als lutherischer Reichsstadt schwerer fiel als Köln. Doch darum ging es hier nicht, wichtig war der diplomatische Umgang mit Gleichgestellten, und hier machte Dortmund alles richtig, wenn die Stadt komplementär zu Lyskirchen und Wissius auch ihren Bürgermeister und ihren Syndicus abordnete. (zu Dortmund ganz knapp die Geschichte der Stadt von 1994,hier S. 130 und S. 190-192)
Es ging in diesem Reisebericht vor allem um genau diese Begegnungen. Die Kölner Gesandten referierten, in welcher Art sie wo aufgenommen wurden – all dies zeigte, welches Prestige Köln im Reich besaß, welche Ehre man den Vertretern dieser Stadt zukommen ließ. Es ging also nicht primär um Serviceleistungen für die Gesandten, sondern die Ehre, die Lyskirchen und Wissius zuteil wurde, widerfuhr der Stadt Köln selbst. Genau deswegen verzeichneten sie auch penibel die Aufnahme in Hamburg – auch eine bedeutende Hansestadt, die politisch aber sicher nicht so kaiserfreundlich einzuschätzen war. Bei der Ankunft gab es „das ordinari Präsent und Congratulation“; später, als Ratsvertreter ihren Besuch machten, kamen noch „besondere(.) Wein Präsente(.)“ dazu. Schon zuvor wurde vermerkt, daß man in Bremen „gleich in vorigen Städten das ordentliche Präsent und Congratulation“ erhalten habe: Es ging also immer auch um Ehre, Reputation, Statuswahrung, auf die zu achten war.
Nicht minder bedeutsam war die Aufnahme bei Tilly, dem Kommandeur über die ligistischen Truppen. Er belagerte in diesen Monaten noch Stade (wovon der Bericht nichts sagt) und hatte deswegen sein Hauptquartier in Buxtehude. Tilly empfing die Kölner Gesandtschaft persönlich und hat sie bei der Tafel „honorifice tractieren lassen“. Dazu erklärte er sein Wohlgefallen, daß die Kölner die Mühen dieser Reihe auf sich genommen hätten. Er, Tilly, wolle „sine dolo solchs an gebührendem Ort aufs Beste rühmen“ – den ligistischen Generalleutnant hatten die Kölner also schon einmal für sich gewonnen, ein erster Erfolg der Reise. Allerdings riet Tilly den Gesandten auch stark dazu, „man sollte mit Eifer dasjenige befördern, was zu der Römischen Kaiserlichen Majestät Dienst und anderem allgemeinerem Nutzen vortraglichen sein könnte“. Dies war eine recht deutliche Mahnung an die Stadt Köln, den (aus kaiserlicher Sicht) Schlingerkurs der Neutralität aufzugeben. Hier zeigte sich dann doch, wie problematisch die Mission zum Hansetag immer noch war – und dies lag nicht allein an der Unsicherheit der Straßen.
Quelle: http://dkblog.hypotheses.org/649