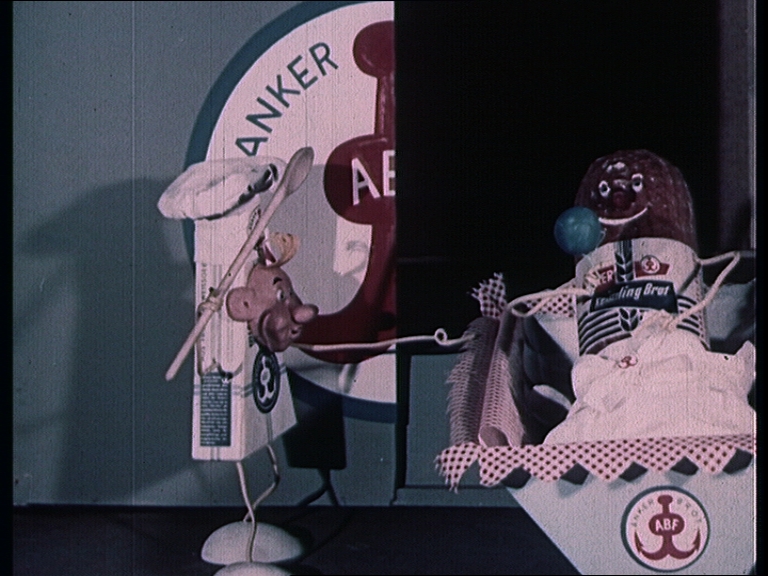Das von Hinnerk Onken bearbeitete und von der DFG geförderte Projekt zu den „ambivalenten Bildern“ aus und von Südamerika im Deutschen Reich zwischen 1880 und 1930 geht der Frage nach, welche Vorstellungen sich die Menschen im Deutschen Reich anhand von Fotos und Bildpostkarten von dem fremden Kontinent gemacht haben. Die Bildmedien zeigten einerseits Eisenbahnen und Bahnhöfe, Stadtansichten, Parlamente, Regierungspaläste, Banken und andere (öffentliche) Gebäude, Häfen, Zoos und Fabriken. Ein ganz anderes Bild zeichneten dagegen Ansichten von Indigenen und Ruinen.

gemeinfrei
Bildpostkarte: Buenos Aires – Congreso Nacional, Fotograf und Herausgeber unbekannt, wahrscheinlich Buenos Aires 1914, gemeinfrei
Insgesamt scheinen diese Quellen, die mit bestehenden Vor- und Einstellungen sowie mit Projektionen von Fantasien und Sehnsüchten zusammenwirkten, eine bekannte Dichotomie aus Tradition und Moderne zu bestätigen. Die genauere Untersuchung aber ergibt, dass die Motive besser mit dem Begriff der Ambivalenz zu erfassen sind. Es gab hybride (Re-)Präsentationen – manche Abbildungen „oszillierten“ zwischen verschiedenen Bedeutungen. Methodisch ist dies mit Ansätzen zum Kulturkontakt, zu transferts culturels und zu Transkulturation sowie wissen(schaft)sgeschichtlichen Überlegungen, unter anderem zur Popularisierung von Wissen, zu analysieren. Denn es waren in erster Linie Forscher, die den Menschen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik Südamerika mit Fotos „vor Augen führten“.
[...]
Quelle: https://www.visual-history.de/2015/07/27/ambivalente-bilder-fotografien-und-bildpostkarten-aus-suedamerika-im-deutschen-reich/