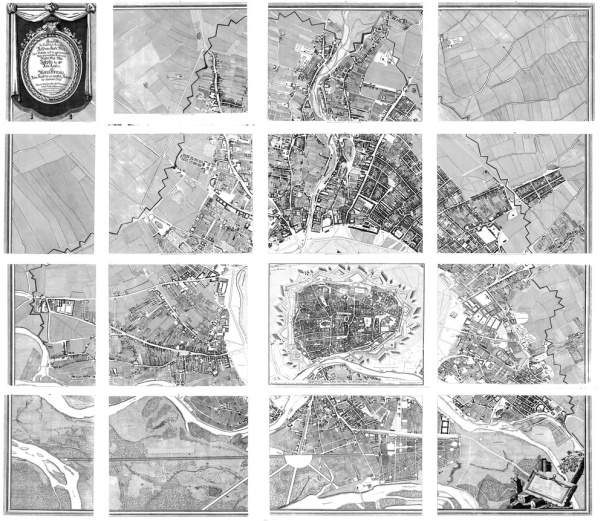Der Medienwissenschafter Christian Fuchs ist Professor für Social Media an der University of Westminster und hat in den letzten Jahren einige Publikationen zum Internet auf englisch vorgelegt, darunter
Social media: A critical introduction (Sage 2014) sowie
OccupyMedia! The Occupy movement and social media in crisis capitalism (Zero Books 2014).
Wer nun auf Deutsch mal kurz reinlesen möchte, was Fuchs zu schreiben hat, ist mit seinem in der Zeitschrift Luxemburg (1/2015, S. 24-29) erschienenen Beitrag
Krise, Kommunikation, Kapitalismus. Zur politischen Ökonomie sozialer Medien (auch als
PDF verfügbar) gut bedient:
Auf sechs Seiten fasst er konzise seine Überlegungen zusammen: So analysiert er unter anderem unsere Nutzung von Google, Facebook, Twitter & Co. als digitale Arbeit, die an Werbetreibende zu verkaufende NutzerInnendaten (
Datenware) produziert und thematisiert den Widerspruch, im dem Protestbewegungen agieren müssen, indem sie zur Herstellung einer politischen Öffentlichkeit soziale Medien nutzen (müssen), während letztere durch die in ihnen waltende Kontrolle von Staat und Kapital ebendiese Öffentlichkeit
feudalisieren, limitieren und kolonialisieren. Dabei bleibt Fuchs nicht nur bei Kritik, sondern benennt auch Alternativen, die eines durch gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffenenen alternativen You Tube etwa, das von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern oder öffentlichen Universitäten betrieben werden könnte, weiters die Ausweitung des Rundfunkbeitrags zu einem Medienbeitrag, der auch von Unternehmen zu zahlen wäre, schließlich eine Politik der Gemeingüter. Sein Schluss:
Ein demokratischer Kommunismus des 21. Jahrhunderts ist möglich, digitaler Kommunismus muss als ein integraler Bestandteil gedacht werden.
Quelle: http://adresscomptoir.twoday.net/stories/1022459046/