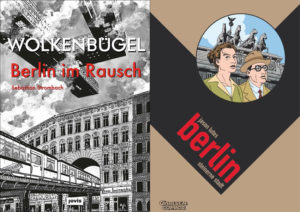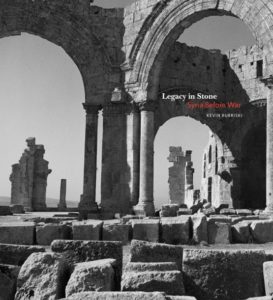Über 25 Jahre nach dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin ist die Gestalt des ehemaligen Bonner Parlaments- und Regierungsviertels – inzwischen oder immer noch – offenbar nur wenig vertraut. Wie sonst ist es zu erklären, dass außerhalb Bonns gelegentlich angenommen wird, dort seien 1999 „die Lichter ausgegangen“, während doch viele Bundeseinrichtungen weiterhin in Bonn präsent sind und in dem Stadtteil seitdem durch Unternehmen und internationale Organisationen Tausende neue Arbeitsplätze entstanden sind? Auch wissenschaftliche Literatur zur Entwicklung des zweifellos historisch bedeutsamen Stadtteils existiert nur vergleichsweise wenige. Die Publikationen aus den 1980er und 1990er Jahren blieben – von heute betrachtet – allzusehr einer zeitgebundenen Architekturkritik verpflichtet. Seit 2010 entstanden dann ein kleiner Katalog zu einem studentischen Ausstellungsprojekt[1], eine Überblicksarbeit zur Bautätigkeit des Bundes in den Nachkriegsjahrzehnten von Elisabeth Plessen[2], die allerdings nicht auf Bonn fokussiert ist, und innovative Einzelstudien wie die von Merle Ziegler über den Neubau für das Bundeskanzleramt in Bonn[3].
Über 25 Jahre nach dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin ist die Gestalt des ehemaligen Bonner Parlaments- und Regierungsviertels – inzwischen oder immer noch – offenbar nur wenig vertraut. Wie sonst ist es zu erklären, dass außerhalb Bonns gelegentlich angenommen wird, dort seien 1999 „die Lichter ausgegangen“, während doch viele Bundeseinrichtungen weiterhin in Bonn präsent sind und in dem Stadtteil seitdem durch Unternehmen und internationale Organisationen Tausende neue Arbeitsplätze entstanden sind? Auch wissenschaftliche Literatur zur Entwicklung des zweifellos historisch bedeutsamen Stadtteils existiert nur vergleichsweise wenige. Die Publikationen aus den 1980er und 1990er Jahren blieben – von heute betrachtet – allzusehr einer zeitgebundenen Architekturkritik verpflichtet. Seit 2010 entstanden dann ein kleiner Katalog zu einem studentischen Ausstellungsprojekt[1], eine Überblicksarbeit zur Bautätigkeit des Bundes in den Nachkriegsjahrzehnten von Elisabeth Plessen[2], die allerdings nicht auf Bonn fokussiert ist, und innovative Einzelstudien wie die von Merle Ziegler über den Neubau für das Bundeskanzleramt in Bonn[3].
Somit wäre in den Bibliotheken noch Platz für ein Standardwerk, das den Baubestand umfassend beschreibt und dessen historische Entwicklung darstellt und deutet. Angelika Schyma und Elke Janßen-Schnabel, die beide langjährige leitende Mitarbeiterinnen des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland waren, haben nun eine umfangreiche Denkmaltopografie zum Bonner Parlaments- und Regierungsviertel vorgelegt, die gleichwohl bescheiden als „Arbeitsheft“ auftritt. Wie im Vorwort zu erfahren ist, hat das Denkmalpflege-Fachamt den dortigen Baubestand bereits seit den 1980er Jahren analysiert. Im Jahr 1998, also dem erwartbaren Veränderungsdruck wegen des Regierungsumzuges noch zuvorkommend, lag sogar bereits ein Gutachten für einen rechtskräftigen Denkmalbereich Bonner Parlaments- und Regierungsviertel vor, der allerdings bislang nicht umgesetzt worden ist.
[...]