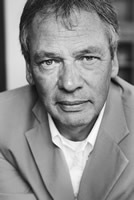“Materielle Mediationen/Médiations matérielles”: Eine deutsch-französische Tagung zu Materialitäten in Künsten, Literaturen und Kulturen. (Bild: Andrea von Hülsen-Esch und Alain Schnapp / © Miriam Leopold)
1985 sorgte der französische Poststrukturalist Jean-François Lyotard mit der Ausstellung „Les Immatériaux“ im Centre Pompidou für ein Diskursereignis, das das Verständnis von Materialität grundlegend verändern sollte. Lyotards Ausstellung führte wortwörtlich vor, wie mit der Immaterialisierung der Wirklichkeit durch numerische Technologien zugleich die materielle Präsenz der Kommunikation gesteigert wird. Damit eröffnet sich aber zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen ein dynamischer Raum für verschiedenste Mediationen.
An das mediale Ereignis “Les Immatériaux” schloss die internationale Tagung “Materielle Mediationen im deutsch-französischen Dialog/Médiations matérielles et dialogues franco-allémands”, die das GRK1678 in Zusammenarbeit mit Alain Schnapp organisierte, in zweifacher Weise an: Erstens fand die Tagung exakt dreißig Jahre nach Lyotards Ausstellung statt. Zweitens ist Lyotards Materialitätskonzept ein wichtiger Referenzpunkt für das GRK1678, wie Andrea von Hülsen-Esch und Vittoria Borsò in ihren einleitenden Vorträgen ausführten.
Andrea von Hülsen-Esch/Vittoria Borsò (Düsseldorf): Einleitung

Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch
© Miriam Leopold
Die Interdependenz zwischen Materiellem und Immateriellem bricht mit dem Primat des Geistes und setzt die unmittelbare Erfahrung ins Recht, konstatierte Andrea von Hülsen-Esch in ihrem Teil der Einleitung. Von den angelsächsisch geprägten “material studies” unterscheide die französische und deutsche Philosophie, Kunst- und Literaturwissenschaft ihre Orientierung an der Prozessualität der materiellen Meditationen, die sich explizit auch der Agentialität der Dinge und ihrer Wirkung auf den Betrachter zuwende. Die Weichen für diesen methodischen Zugang zur Materialität stellt nach von Hülsen-Esch aber nicht erst Lyotard, sondern dieses Konzept von Materialität besitzt eine verzweigte Genealogie, die auf beide Seiten des Rheins führt. Vorreiter für die deutsche Kunstwissenschaft sei Aby Warburg, der mit seinem Mnemosyne-Atlas und der “Pathosformel” die Agentialität der Bilder fokussierte. Weiter zu nennen wären auch Philippe Dubois’ Konzept “image-act” sowie Horst Bredekamps energetische Bildakttheorie.

Prof. Dr. Vittoria Borsò
© Miriam Leopold
Aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet Vittoria Borsò Lyotards These. Materielles und Immaterielles bedingen sich nicht nur gegenseitig, so Borsò. Vielmehr gehören beide zum gleichen Produktionsprozess von Wirklichkeit. Diese dynamische Ontologie habe bereits Lyotards Ausstellung performativ umgesetzt, da sich dort die Materialität als Emergenz einer komplexen Interaktion zwischen Technik und Benutzer immer wieder neu einstellte. Für die Literaturwissenschaft schlägt dagegen die Romanistin den Begriff der écriture vor, der einen durchlässigen, multimedialen Raum der Sinngebung definiert. In dieser écriture offenbart sich nach Borsò immer auch das Fremde im Eigenen, ja das Fremde wird als eine Konstituente der Materialität sichtbar – so wie es auch Roland Barthes in L’empire des signes und Gilles Déleuze in Critique et clinique vorgeführt haben. Insofern verlangen die materiellen Meditationen eine ständige Kreuzung der Aspekte, ein Changieren zwischen Epistemologie und Ontologie und nicht zuletzt einen interkulturellen Austausch. (Autor: Sergej Rickenbacher)
Alain Schnapp (Paris): Monument/Mahnmal/Merkmal – Quelques aspects de la mémoire entre France et Allemagne

Prof. Alain Schnapp
© Miriam Leopold
Einen interkulturellen Dialog setzte der Pariser Archäologe Alain Schnapp in seinem Vortrag in Szene. Ausgehend von den Etymologien und Übersetzungen zentraler Begriffe historischer Wissenschaften reflektierte Schnapp über die Semantiken und Funktionen von Ruinen, Monumenten, Denk- und Mahnmälern in verschiedenen Kulturen zu wechselnden Zeiten. Als zentrale Konzepte der europäischen Erinnerungskultur definierte er trace und empreinte. Während trace die Richtung vorgebe und somit Orientierung schaffe, gebe empreinte als Abdruck dem Erinnerten eine Form. Letzteres könnte auf einer Erinnerungskultur bezogen werden, wie sie Denis Diderot lebte. Die Ruine habe für Diderot die Vergangenheit verkörpert, die durch Kontemplation vor Ort wieder zugänglich wurde. Eher dem Konzept der trace müsste Alois Riegls Funktionalisierung des Denkmals in Der moderne Denkmalkultus zugeordnet werden. Das Denkmal ist nach Riegl der Ort des ritualisierten Umgangs mit der Vergangenheit. Insofern besitzen nach Schnapp die deutschen Begriffe ‘Denkmal’, ‘Mahnmal’ und ‘Merkmal’ gegenüber dem französischen ‘monument’ einen entscheidenden Vorteil: Sie drängen die Frage nach den zukünftigen Funktionen der materialisierten Vergangenheiten auf. (Autor: Sergej Rickenbacher)
Section I: Critique génétique
Daniel Ferrer (Paris): Le matériel et le virtuel dans la critique génétique

Dr. Daniel Ferrer
© Miriam Leopold
Ungeschriebene Bücher hinterlassen Spuren. Zu Unrecht interessierten die Critique génétique diese virtuellen Werke aber nur am Rande, wie der Joyce-Spezialist Daniel Ferrer vom ITEM bemängelte. Zwar sind diese Bücher nicht als Werke vorhanden, aber sie sind auch nicht vollständig verschwunden. Diese virtuellen Bücher sind als Korrekturen, Anmerkungen oder Flecken im Manuskript präsent, was auch wichtige Rückschlüsse auf den Schreibprozesse zulasse. Wie sich diese Virtualität am Material manifestiert, veranschaulichte Ferrer an Manu- und Typoskripten von Voltaire, Gustave Flaubert, Wladimir Nabokov oder James Joyce. Besonders bei Joyce wurde deutlich, dass die gemeinte Virtualität sich nicht nur in der Schrift konkretisiert. Vielmehr wird sie auch in der Materialität der Vorlage oder in Kontexten wie der Autorenbibliothek greifbar. Im Anschluss an den Vortrag wurde besonders Ferrers Begriff der ‘Virtualität’ kritisch diskutiert, da er große Überschneidungen mit der ‘Potentialität’ besitzt. (Autor: Sergej Rickenbacher)
Dirk van Hulle (Antwerpen): The Materiality of Textual Gaps – Beckett’s Blanks for when Words gone

Prof. Dr. Dirk van der Hulle
© Miriam Leopold
Unter dem Motto “Mind the Gap” besprach Dirk van Hulle die Rolle der Leerstelle in den Werken Samuel Becketts. Besonders ging es ihm dabei um das Verhältnis, dass die in den Manuskripten und Entwürfen zu findenden Leerstellen zu den in den Werken thematisierten Leerstellen haben. Aufbauend auf Modellen der kognitiven Narratologie zur Funktionsweise des menschlichen “minds” plädierte van Hulle dafür, diese nicht nur für die Ebenen der Erzählung und der Rezeption, sondern auch für die textgenetische Ebene fruchtbar zu machen. Manuskripte, Entwürfe und Überarbeitungen sollen als essentielle Bestandteile des Schreibprozesses betrachtet werden. Unter dieser Perspektive ließen sich die einzelnen Texte dann als Extensionen des “minds” von Autorinnen und Autoren sehen, die in ihrer spezifischen Materialität den Schreibprozess beeinflussen.
Anhand von drei Werken Becketts – “Malone Dies Alone”, “Rough for Radio II” und “Cascando” – stellte er auch die Verbindung zwischen den Leerstellen in den einzelnen Textvarianten und der Thematisierung von Gedächtnis und Schreibprozess vor. Becketts Werke, so die Argumentation van Hulles, liefen auf die Konstruktion des “Unerzählbaren” hinaus. Abschließend präsentierte van Hulle das von ihm mit-geleitete Beckett Digital Manuscript Project (BDMP) in dem die Schriften Becketts digital aufbereitet werden. (Autor: Gero Brümmer)
Roger Lüdeke (Düsseldorf): The Material Art of Abstraction in Virginia Woolf’s To The Lighthouse
Roger Lüdeke eröffnete seine Präsentation mit dem Hinweis, dass diese „rachsüchtig“ und “ungerecht” sein werde. Ein Ziel dieser Rache zeigte sich, als er aus Leslie Stephens “What is Materialism?” (1886) das darin enthaltene Plädoyer für eine Hinwendung zum Materialismus zitierte. Diese Einstellung kontrastierte er mit einem Text, der als Replik auf Stephens’ Text verstanden werden kann, geschrieben von Stephens’ Tochter, Virginia Woolf (“Modern Fiction”, 1919).

Prof. Dr. Roger Lüdeke
© Miriam Leopold
Das Anliegen des Vortrags war es, für einen Eigensinn der Materialität von Literatur zu plädieren. Hierzu widmete Lüdeke sich einem close reading von Virgina Woolfs To the Lighthouse (1927). Indem er den Schreib- und Überarbeitungsprozess des Romans nachzeichnete, demonstrierte er, wie Woolfs Schreibweise als eine Art materieller Abstraktion verstanden werden kann, die eine besondere Form der Beschäftigung mit dem Text und der Schreibsituation Woolfs erlaubt. Hauptaugenmerk lag dabei auf dem zweiten Kapitel, “Time Passes”, das sich sowohl im Umfang als auch in der Ausrichtung immer weiter von der ursprünglich geplanten Form entfernte und weiter entwickelte. So machte Lüdeke deutlich, wie im Laufe des Romans die Thematisierung des künstlerischen Arbeits- und des Rezeptionsprozesses dafür sorgt, dass sich die Materialität der Welt, ihre Zeitlichkeit und ihre Bewegung in eine eigene Richtung entwickeln. Nach und nach entzieht sich der Text einer menschlichen Perspektive und die Welt gewinnt so ihren materiellen Eigensinn.
Er schloss den Vortrag mit einigen Anmerkungen zur Bedeutung dieser Abstraktion und der Berücksichtigung eines solchen materiellen Eigensinns, der, so Lüdeke, eine eigene ethische Haltung der Literatur evoziere. (Autor: Gero Brümmer)
Section II: Materialité et écriture
Ricarda Bauschke-Hartung (Düsseldorf): Die Materialisierung von Textsinn im Spannungsfeld handschriftlicher Varianz – Mehrfachüberlieferungen mittelhochdeutscher Lyrik.

Prof. Dr. Ricarda Bauschke-Hartung © Miriam Leopold
Handschriftliche Varianzen bringen selten Klarheit für das Verständnis von Texten. Oftmals verschleiern und vervielfachen weitere Handschriften durch Unterschiede, Schreibfehler, Lücken, Angleichungen und Anpassungen das Material mit dem sich Literaturwissenschaftler beschäftigen: Texte und Fiktion. In ihrem Vortrag behandelte Ricarda Bauschke-Hartung den Umgang mit dieser Vielheit. Dabei bezog sie eine Position zwischen Old Philology und New Philology und verwies darauf, dass beide konkurrierende Strömungen problematisch für ein adäquates Textverstehen sind. Während die erste eine Urtextform zu (re)konstruieren versuche, forciere die zweite den Pluralismus der Texte und begründe dies mit der Auftrittssituation im Mittelalter. Am Beispiel von Heinrich von Morungens Des Minnesangs Frühling wies Bauschke-Hartung darauf hin, wie komplex eine Textgenese ist und wie missverständlich die Pluralität der Texte sein kann. Dabei lautet ihr Vorschlag, die Vielheit bei gleichzeitiger Hierarchisierung historischer, sprachlicher und kultureller Fakten beizubehalten. Gerade der material turn diene dabei als produktiver Ausgangspunkt. Die Hinwendung zum Textmaterial zeige, wie immer schon Autorenbilder konstruiert, Textzuschreibungen inszeniert und die Potentialität des Textes poetisiert wird. In der Diskussion wurde kritisch beleuchtet, welchen Weg die Philologie zwischen den Ideologien von Urtext und Autor sowie von Vielheit und Gleichwertigkeit gehen kann. (Autor: Martin Bartelmus)
Martin Stingelin (Dortmund): Im Höhlenlabyrinth der Materialität von Christoph Martin Wieland und Friedrich Dürrenmatt

Prof. Dr. Martin Stingelin
© Miriam Leopold
Literatur befindet sich immer schon im Spannungsfeld zwischen dem Schreiben mit seinen Akteuren – wie Tinte, Schreiber, Stift, Maschine, Papier und Sekretärin – und der Fiktion –also all dem, was geschrieben, erzählt, inszeniert und produziert wird. Martin Stingelin verband in seiner Analyse die Materialität mit der Fiktionalität von Schreibszenen. Ausgangspunkt bildete Christoph Martin Wielands Sokrates Mainomemos, in dem Diogenes über das Schreiben reflektiert und gleichzeitig schreibt. Wie körperlich und materiell Schreiben sein kann, zeigte eine handschriftliche Notiz von Georg Christoph Lichtenberg, in der er mit Kaffee schreibt, und schreibt, dass er mit Blut schreiben würde, hätte er keinen Kaffee als Tintenersatz. Sichtbar wird, auf welch radikale Körperlichkeit der Akt des Schreibens immer schon verweist. Auch bei Friedrich Dürrenmatts Winterkrieg in Tibet zeichnet sich die ganze Bandbreite der Verschränkungen von Fiktion und Materialität ab. An Dürrenmatts Manu- und Typoskripten machte Stingelin deutlich, wie sich materiell-semiotische Knoten bilden – im Text sowie auf dem Blatt Papier. Die Fiktion kenne nicht nur eine Vielheit an menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren im Schreibprozess. Vielmehr zeige sich auch bei Dürrenmatt und Robert Walser, dessen Bleistifthandschriften auch ins Spiel gebracht wurden, dass nie nur der Autor die Fiktion entwirft, sondern das Schreiben ein Kollektiv versammelt: aus Schriftart, Bleistifte, Schreibmaschinen etc. Das Schreiben ist nicht nur eine Praxis zur Herstellung literarischer Texte, sondern auch eine Praxis des Zusammenbringens von Akteuren, mithin ein Spiel zwischen Mikropolitik und Ökonomie des Schreibens.(Autor: Martin Bartelmus)
Section III: Materialité et médialité
Reinhold Görling (Düsseldorf): Material und Abstraktion

Prof. Dr. Reinhold Görling
© Miriam Leopold
Anhand der Audiovertonung von James Joyce’ Anna Livia Plurabelle und der Video-Installation The Woolworth Choir 1979 von Elizabeth Price erkundete Reinhold Görling das Verhältnis von Abstraktion und Material.
Die 1929 entstandene Vertonung von Anna Livia Plurabelle, dem wohl bekanntesten Kapitel aus dem als unübersetzbar geltenden Finnegans Wake, beschrieb Görling als vielstimmigen Text über Zeit und Verben, Begehren und Körper. Hierin spiegele sich das Verhältnis von Materialität und Produktion, so man Produktion (als eine Tätigkeit der Formwandlung) als zeitliche Ausbreitung und Material als räumliche Ausbreitung fasse. Die an Musik grenzende Sprache arbeite gegen den Sinn im Text an, da der Text ständig selber Rhythmen und Gesten übersetze und somit mit Benjamin eine ‚reine Sprache’ genannt werden könnte. Görling schlug dagegen vor, mit Whitehead und Déleuze/Guattari Anna Livia Plurabelle und The Woolworth Choir 1979 anstatt als Produktionen als Abstraktionen verstehen, die zugleich Konkretionen sind. Sie gehen als Relationen den Relata voraus und gebärden sich ereignishaft, ohne jedoch in eine Zeitstruktur eingebunden zu sein. Das beschriebene Material entspräche in dieser methodischen Perspektive eher Bewegungen oder Rhythmen denn Substanzen. (Autorin: Maike Vollmer)
Beate Ochsner (Konstanz): Das Cochlea Implantat zwischen epistemischem und technischem Ding

Prof. Dr. Beate Ochsner
© Miriam Leopold
Beate Ochsner reflektiert in ihrem Vortrag das Cochlea Implantat (CI) zwischen epistemischem und technischem Ding. Das CI ist eine chirurgisch zu implantierende Neuroprothese, die gehörlosen und schwerhörigen Menschen eine Darstellung der Umgebungsgeräusche vermitteln kann und somit die Teilhabe an der hörenden Welt ermöglicht. Ochsner analysierte audiovisuelle Repräsentationsräume, die aus (Noch-)Nicht-Teilhabenden Teilhabende machen. Die Ereignishaftigkeit der Mediation (des Hörend-Werdens) könne selbst nur medial verständlich gemacht werden.
Ochsner zeigte, dass in sogenannten “First-Time-Activation”-Videos, die vorgeben, den Augenblick der ersten Aktivierung der Prothese festzuhalten, mit standardisierten Blickzurichtungen und akustischen Aufmerksamkeitsspots operiert wird, die das epistemische in ein technisches Ding verwandeln und gleichzeitig die Selbstreferentialität des Hörenden medial erzeugen. Die Konstruktion der Selbstreferentialität entspreche der Logik des Supplements und habe die Nicht-Wahrnehmung und Auslöschung einer gehörlosen Möglichkeit der Identität zur Folge. (Autorin: Maike Vollmer)
Conference du soir
Bernard Stiegler (Paris): L’appareillage noétique
Pour comprendre les Immatériaux, il faut penser au delà de J-F. Lyotard !
Ainsi commence la conférence de Bernard Stiegler sur l’appareillage noétique définissant le cerveau comme « appareil de production du savoir ».
Pour penser contre l’automatisation du savoir dans le web, et pour un usage noétique du numérique Stiegler se réfère au concept qu’il baptise rétention tertiaire, un concept à partir des deux types de rétentions forgés par Husserl.

Prof. Bernard Stiegler
© Miriam Leopold
Stiegler prend l’exemple du discours. Un discours écrit est une rétention tertiaire. Quand le public l’écoute pour la première fois, il se produit des rétentions primaires. Si l’on avait la possibilité de fixer le discours par un procédé audio et de le réécouter, il se produirait des rétentions secondaires et de nouvelles rétentions primaires, les anciennes rétentions primaires étant par la réécoute transformées en rétentions secondaires. La prise de note participe de ce même processus, transformant le support transindividuel en « enrichisssement du texte » par l’attention individuelle à tel ou tel aspect du discours. Ces notes peuvent être le chemin d’une nouvelle transindiviuation.
La rétention tertiaire numérique, le web, ouvre de nouvelles possibilités herméneutiques ; le numérique comme objet spatiotemporel favorise un régime de la transindividuation ou autrement dit, un social networking. Les groupes qui consolident des rétentions secondaires collectives, définies par l’interprétation et la production des processus de catégorisation contribuent aux matériaux de savoir.
Le web comme ardoise magique collective ( nouveau wunderblock freudien) devient ainsi un circuit de transindividuation à travers des bifurcations qui se créent pendant le dialogue des groupes sur le web. (Auteur: Aleksandra Lendzinska)
Section IV: Materialité et l’histoire d’art
Jean-Claude Schmitt (Paris): Les deux corps de la vierge

Prof. Jean-Claude Schmitt
© Miriam Leopold
Die letzte Sektion der Tagung eröffnete der französische Mediävist und Vertreter der anthropologie historique Jean-Claude Schmitt. Seinen Vortrag widmete Schmitt der Produktion von Sakralität in der Marien-Prozession Círio de Nazaré in Belem, die aktuell als eines der größten religiösen Feste weltweit gilt. Während der zweitägigen Prozession wird eine Marienstatue mit verschiedenen Transportmitteln bzw. –formen von der Nachbarstadt Ananindeua zur Basilika Sanctuário de Nazaré in Belém transportiert. Entscheidend seien die verschiedenen Vervielfachungen des Marienkörpers, die erst die Produktion von Sakralität in der Menschenmasse erlauben. Seit 1966 begeht die Prozession eine Kopie der originalen Statue, die während den Festlichkeiten in der Basilika bleibt. Diese Verdoppelung des Körpers bleibt nach Schmitt jedoch nicht die einzige Multiplikation. Vor der Prozession schenken sich Privatpersonen, Geschäfte und Firmen gegenseitig kleine Marienstatuen, ebenso wie digitale Fotos überzeitliche Nähe produzieren. (Autor: Sergej Rickenbacher)
Philipe Cordez (München): Esclaves d’ébène – À propos du mobilier du Andrea Brustolon pour Pietro Venier (Venise 1706)

Dr. Philippe Cordez
© Miriam Leopold
Der Frage, woher die Verbindung der Assoziation von schwarzer Haut und dem Material Ebenholz stammt, widmete sich Philipe Cordez in einer Betrachtung des Mobiliars Andrea Brustolons für Pietro Venier (Venedig, 1706). Basierend auf einem materialsemantischen Ausgangspunkt zeigte er in seinem auf Deutsch gehaltenen Vortrag, dass der materialisierenden Identifizierung des afrikanischen Körpers mit dem kostbaren Ebenholz und den Darstellungsmodi der Afrikaner im Mobiliar kulturell bedingte Handlungsmuster zugrunde liegen, indem er die komplexen semantischen Assoziationen des französischen Wortes “guéridon” sowie der Begriffe “Bois d’ébéne” und “ebony” über die Sprache historisch zurückverfolgte. (Autorin: Sabrina Pompe)
Hans Körner (Düsseldorf): Die Mauer – Zur Materialität der Erinnerung im französischen Denkmal des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts

Prof. Dr. Hans Körner
© Miriam Leopold
Reflektierte Alain Schnapp im Eröffnungsvortrag die kulturelle Produktion von Erinnerung mittels Denkmälern, so wendete sich der Düsseldorfer Kunsthistoriker Hans Körner ihrem entgegengesetzten Pol zu: ihrer Materialität. Körner bezog verschiedene Medien und historische Ereignisse um 1900 aufeinander und zeigte, dass die Mauer in den Denkmälern dieser Zeit bei weitem nicht nur Staffage ist. Vielmehr bildet sie nach Körner die Leerstelle der Denkmäler, in der sich die Ephemerität der Vergangenheit, die Imagination des Betrachters und die Materialität des Kunstwerks begegnen. Als Beispiele dienten u.a. das Ölbild “Der Tod des Marschalls Ney” (1867) sowie das erste Denkmalprojekt zu Neys Hinrichtung von François Rude (1848) und Paul Moreau-Vauthiers “Aux victimes des révolutions” (1907), das den letzten hingerichteten Pariser Kommunarden gewidmet ist. Körner führte eindrücklich vor, wie gerade an diesen Mauern die Spannung zwischen Absenz und Aktualisierung manifest wird. (Autor: Sergej Rickenbacher)
Quelle: http://grk1678.hypotheses.org/473