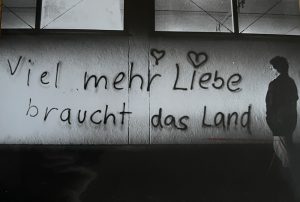Ein Jahr, bevor Wolfsburg im Zuge der kommunalen Gebietsreform praktisch über Nacht zur Großstadt werden sollte, schuf Heinrich Heidersberger an einem klaren Novembermorgen des Jahres 1971 mit Kraftwerk der Volkswagen AG die wohl beeindruckendste und zugleich auf eigentümliche Weise auch unwirklichste Fotografie aus seiner Stadt: Sie zeigt mit Blick über das Hafenbecken in totaler Frontalität das Kraftwerk als die zentrale Energieversorgungseinheit des Volkswagen-Konzerns, dessen Gründung die Stadt ihre Existenz verdankt. Aufgrund der langen Belichtungszeit manifestiert sich in der Fotografie der aufsteigende Rauch des Kraftwerks zu undurchdringlichen Schwaden, hinter denen Teile der Kraftwerksarchitektur verschwinden und der an den Schloten zu abstrakten weißen Schlieren gerinnt (Abb. 1)
Abb. 1: Heinrich Heidersberger, Kraftwerk der Volkswagen AG, Wolfsburg 1971; © Institut Heidersberger, #04148_5
Das Wasser des Stichkanals wirkt wie zugefroren. Die in die Tiefe des Bildes fluchtende Versorgungsbrücke, die „über“ den Köpfen der Betrachterinnen und Betrachter beginnt, scheint den Real- und Bildraum miteinander zu verbinden, wodurch eine immersive, in das Bildgeschehen hineinziehende Wirkung entfaltet wird. Das quer zur Bildebene liegende Binnenschiff, dessen stark angeschnittener leerer Frachtraum die Fotografie nach unten hin begrenzt, verankert die Perspektive zugleich örtlich: Der ebenfalls stark angeschnittene Steuerstand verbindet visuell die Betrachterseite des Stichhafens mit der Architektur des Kraftwerks auf der gegenüberliegenden Seite. Durch diese visuelle Kopplung der verschiedenen Bereiche findet das den Wirtschaftszyklus bedingende Zusammenspiel von Ressourcen (Kohle), Transportmedium (Wasser) und Verbraucher (Kraftwerk) in der Fotografie eine adäquate Entsprechung.
[...]
Quelle: https://visual-history.de/2021/11/24/energie-und-aesthetik/