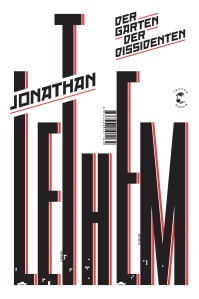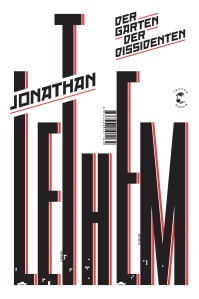Der ehemalige Leiter des Augsburger Gesundheitsamtes Johannes Georg Gostomzyk hat im Historischen Lexikon Bayerns Ende vergangenen Jahres eine Dokumentation der AIDS-Politik des Freistaates Bayern veröffentlicht, die besonders wegen ihrer klaren, kurzen und sachlichen Darstellung hochinformativ und lesenswert ist.

Die historische Katastrophenforschung argumentiert, dass an Katastrophen Mentalitäten wie unter einem Brennglas sichtbar werden und sich gesellschaftliche Tendenzen (etwa der Sozialdisziplinierung) kurzfristig bündeln und verstärken, was z.T. zur Entstehung obrigkeitlicher, staatlicher und manchmal autoritärer Strukturen führt. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist zu ergänzen, dass es vor allem auf die in einer Gesellschaft hegemonialen Deutungsangebote ankommt, ob ein natürliches, technisches oder gesellschaftliches Ereignis auch zu einer Katastrophe mit weitreichenden sozialen Folgen wird.
Ein Beispiel aus der unmittelbaren Zeitgeschichte ist das Auftreten von HIV-AIDS. Zuerst 1981 in Kalifornien diagnostiziert löste und löst die Krankheit weitreichende gesellschaftliche und kulturelle Reaktionen aus. Die medizinische Erfolge, die die Krankheit am Ausbruch hindern bzw. die Symptome unterdrücken helfen, und die Wirkung von Aufklärungskampagnen führten in den letzten Jahren zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse vieler HIV-Infizierter. Die Krankheit wurde dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem Problem des globalen Südens und wird in die gängige Erzählung von dessen Rückständigkeit intergriert.
Wie Gostomzyk zeigt, verfolgte die bayerische Staatsregierung (verantwortliche Staatssekretäre ab 1986 Peter Gauweiler; ab 1989 Günter Beckstein) ab Mitte der 1980er Jahre einen Sonderweg innerhalb der BRD.
Sie setzte den Beschlüssen der Gesundheitsministerkonferenz und deren Betonung von Beratung und Betroffenenschutz eine Politik der Zwangsvorführung und der Zwangstests von sogenannten „Ausscheidern“ und „Ansteckungsverdächtigen“ entgegen. Zudem wurden 1987 (bis 1995) Beamtenanwärter zu AIDS-Tests verpflichtet. Eine zunächst vom Sozialministerium eingerichtete „Zentralen Informationsstelle AIDS“ musste 1990 die Arbeit nach dem Wegfall staatlicher Förderung einstellen. Günter Beckstein erklärte öffentlich, „es gebe bisher keine nachhaltigen Beweise dafür, dass die Aufklärungskampagne AIDS zu einer Änderung des Sexualverhaltens der Bevölkerung geführt habe“ (Gostomzyk). Die Beratungsarbeit blieb zivilgesellschaftliche Initiativen und einzelnen Magistraten überlassen. Trotz massiver Proteste – im April 1987 kam es zu einer Großdemonstration in München und der Bundesverband der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst kritisierte die Maßnahmen scharf – blieb die bayerische Staatsregierung fast ein Jahrzehnt bei ihrer Ausgrenzungs- und Zwangspolitik. Erst ab 1996 trat eine gewisse Normalisierung ein, indem verstärkt Beratungsprogramme an die Stelle von Zwangsmaßnahmen rückten.
Die Dokumentation ist zu finden unter:
Johannes Georg Gostomzyk, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45855 (veröffentlicht: 25.11.2013)
Einsortiert unter:Ereignis, Erinnerung, Geschichte, Sozialgeschichte
Quelle: https://kritischegeschichte.wordpress.com/2014/03/19/2589/