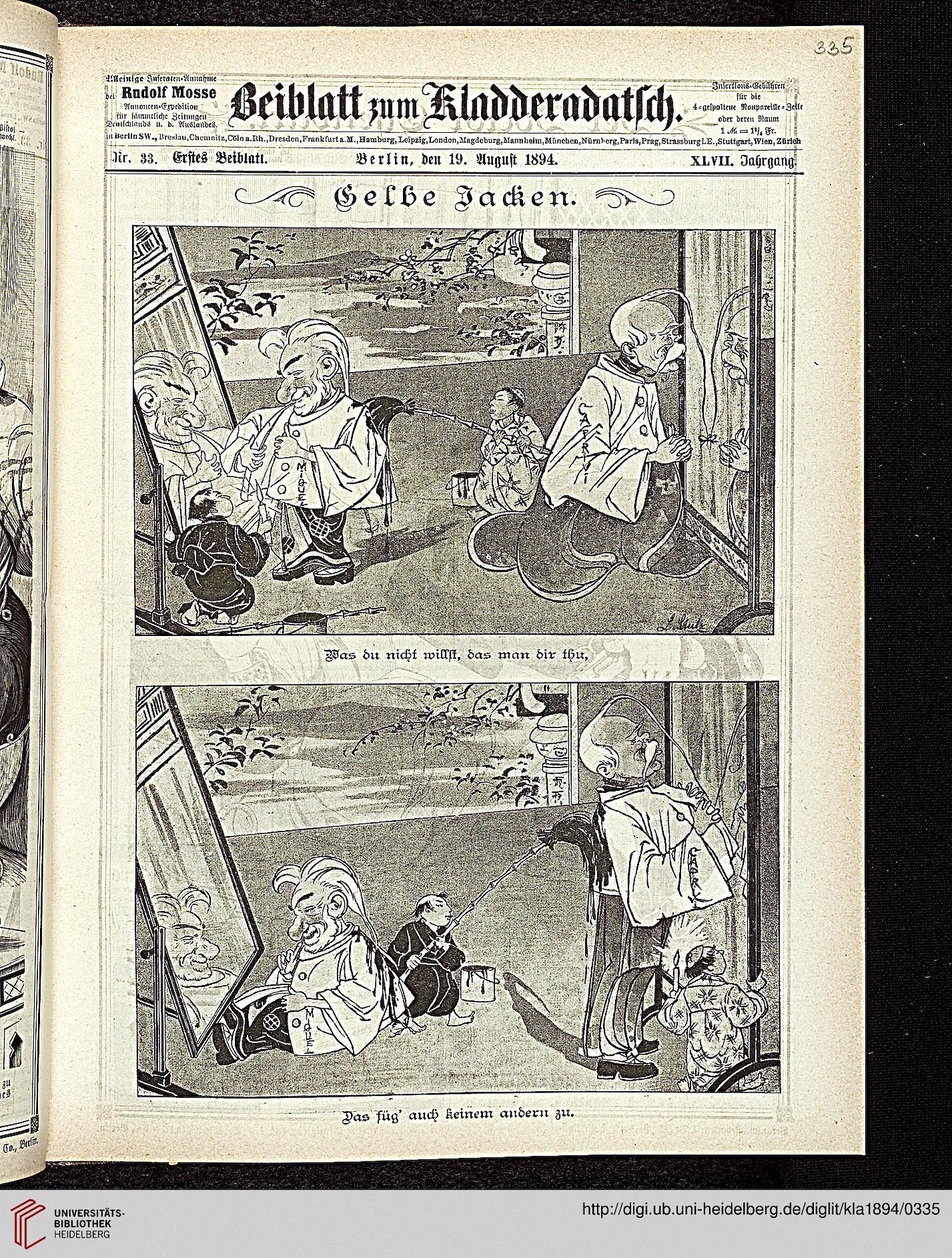Abstract.
„Beamtenministerpräsidenten“ – unter diesem Begriff werden die Ministerpräsidenten Gustav von Kahr, Hugo Graf Lerchenfeld und Eugen von Knilling zusammengefasst, die in den Jahren von 1920 bis 1924 in relativ zügigem Wechsel der bayerischen Regierung vorstanden. Der „Beamte“ wurde von den Zeitgenossen bewusst betont. Dies sollte in einer Zeit, in der weite Teile der Bevölkerung und der Eliten der jungen parlamentarischen Demokratie skeptisch gegenüberstanden, suggerieren, dass der Ministerpräsident über dem Streit der Parteien schwebe. Vor allem deshalb entschied sich die dominierende BVP nicht einen ihrer bekannten Parteigänger an die Spitze des Staates zu stellen, sondern „unpolitische“ Männer zu bevorzugen, deren Hintergrund eine hervorgehobene Beamtenkarriere im alten Königreich war. Doch kann ein Ministerpräsident in einem parlamentarischen System, in dem er sich auf eine Koalition von Parteien stützen muss, überhaupt „unpolitisch“ sein? Kann er ganz alleine für sich über den Dingen schweben und zum Wohle der Allgemeinheit handeln? Die Arbeit stellt sich daher die Frage, wie diese Ministerpräsidenten im politischen Spektrum Bayerns positioniert und geprägt waren und, darauf aufbauend, inwiefern ihnen durch diese Positionierung eine Mitverantwortung an der Radikalisierung Bayerns bis hin zum Hitlerputsch zuzuschreiben ist.
Die Gliederung erfolgt grob nach den Amtszeiten der Personen. Diese Amtszeiten, nicht komplette Lebensgeschichten, sind Betrachtungsgegenstand. Gustav von Kahr (1862-1934) übernahm im März 1920 das Amt des Ministerpräsidenten. In den Wirren um den Kapp-Putsch folgte der Regierungspräsident von Oberbayern er auf den Sozialdemokraten Johannes Hoffmann. Kahr hatte sich bereits vor Amtsantritt in ein enges Bündnis mit den bayerischen Einwohnerwehren begeben, in denen er einige Popularität genoss. Diese Popularität wollte sich die BVP zu Nutze machen. Doch schon bald verlor sie den Einfluss auf Kahr, der den vaterländischen Verbänden und Eliten deutlich näher stand, als der Fraktion im Landtag. Im September 1921 trennte sie sich daher vom ihn. Die Fraktion stand damals vor den Fragen, die sich noch heute stellen: Inwiefern war Kahrs Politik selbstbestimmt, inwiefern konnte die Koalition im Landtag noch Einfluss nehmen, inwiefern war er am Ende zum Spielball außerparlamentarischer, rechter Zirkel geworden?
Kahr hatte in den eineinhalb Jahren seiner Amtszeit durch anhaltendes Kompetenzgerangel mit der Reichsregierung für gehörige Verstimmung zwischen Berlin und München gesorgt. Auf der Suche nach einem diplomatisch gesonnenen Nachfolger stieß die BVP-Fraktion auf den Grafen Hugo von und zu Lerchenfeld (1871-1944). Im Gegensatz zu Kahr war Lerchenfeld Mitglied der Partei. Er hatte angesichts der Revolution in Bayern in den Dienst der Reichsregierung, zuletzt als Gesandter in Darmstadt, gewechselt. Somit schien er unbelastet von der bayerischen Tagespolitik. Lerchenfeld bemühte sich zunächst um Besonnenheit. Er strebte eine Verlagerung hin zu sachlicher Wirtschaftspolitik an. Doch schon bald isolierte er sich damit. Die Kräfte rechts der BVP liefen Sturm gegen ihn und auch in der eigenen Partei war der Wunsch nach Ausgleich rasch wieder vergessen. Lerchenfeld, mehr und mehr desillusioniert, folgte dieser Entwicklung in seiner Politik. Im Sommer 1922 beging er im Streit mit Berlin sogar einen klaren Bruch der Reichsverfassung. Trotzdem: Dauerhaften Rückhalt konnte der Graf in so gut wie keinem politischen Lager gewinnen. Mit dieser Einsicht gab er im November 1922 sein Amt auf.
Wieder befand sich die BVP auf der Suche nach einem „Beamtenministerpräsidenten“ – doch sie tat sich nun immer schwerer mit der Suche. Freilich hatte Eugen von Knilling (1865-1927) während der Monarchie eine glänzende Beamtenkarriere im Staat durchlaufen, brachte es sogar zum Kultusminister. Aber seit 1920 war er nicht mehr Beamter, sondern Parlamentarier für die BVP. Und als solcher wurde er zumindest innerhalb der BVP Landtagsfraktion auch empfunden. Angesichts der angespannten Lage im Land wollten die Mitglieder der BVP-Fraktion „ihren Kollegen“ eigentlich noch nicht vor solch große Herausforderungen stellen. Sie befürchteten, dass er dabei scheitern müsse – und sie sollten Recht behalten. Eugen von Knilling bemühte sich durch seine ganze Amtszeit um eine Annäherung an die rechten Kreise in Bayern. Er wollte eine ähnlich zentrale Stellung erreichen, wie Ministerpräsident Kahr sie einst hatte. Es blieb jedoch beim Wunschdenken. Dauerhafte Autorität konnte er nie gewinnen. Das zeigte sich spätestens, als er am Abend des Putsches im Bürgerbräu von den Nationalsozialisten ohne weiteres gefangen genommen wurde.
Knillings mangelnde Erfolge bewirkten auch die Rückkehr des ersten „Beamtenministerpräsidenten“, Kahr, auf die politische Bühne. Im September sah es die Regierung Knilling für notwendig an, ihn als „Generalstaatskommissar“ neben sich zu stellen. Sie verband dies mit der vergeblichen Hoffnung, dass die einstige Identifikationsfigur der politischen Rechten die Anhänger Hitlers beruhigen könnte. Doch die Regierung musste sehr bald feststellen, dass Kahr zum einen ebenfalls über keine Autorität gegenüber Hitlers Deutschem Kampfbund verfügte, zum anderen als Generalstaatskommissar von Anfang an seine eigene Politik betrieb, die alles andere als zur Beruhigung der politischen Lage beitrug. Vielmehr ist die Frage zu stellen, inwiefern Kahrs und sein enges Umfeld die Putschstimmung noch zusätzlich befeuerten. Das Generalstaatskommissariat wird daher in dieser Arbeit in einem eigenen großen Kapitel behandelt, das aus dem sonst angewandten Konzept ausbricht.
Die Kapitel zu den jeweiligen Ministerpräsidentschaften sind zunächst von dem Versuch geprägt, den jeweilige Amtsinhaber fundiert politisch einzuordnen. Nach einer kurzen Betrachtung der jeweiligen bisherigen Karriere, werden in diesem Sinne folgende Fragestellungen abgehandelt: Dank welcher Unterstützer kam der Ministerpräsident ins Amt? Wo lagen Charakteristiken, Schwerpunkte und Entwicklungen seiner Politik, vor allem im Hinblick auf seine Haltung zu den geltenden Verfassungen in Bayern und Reich? Und wie nahm er die zunehmende Radikalisierung Bayerns wahr? Lässt sich der Ministerpräsident in seiner Amtsführung durch Nähe oder Ferne zu den einzelnen Parteien einordnen? Und wie gestaltete sich das Verhältnis zu den rechten Kräften außerhalb des Parlaments? Einem Blick auf das Ende der Amtszeit folgt dann das jeweilige Zwischenfazit.
Eine Sonderrolle wird das Generalstaatskommissariat Kahrs spielen. Es kann in dieser Arbeit schon aufgrund des zentralen Ereignisses „Hitlerputsch“ nicht ignoriert werden. Hierbei wird der Blickwinkel Kahrs eingenommen. Im Focus stehen dabei seine Legitimation im Staat, seine innerbayerischen Ziele als Generalstaatskommissar, die Frage nach dem Grad seiner eigenen Planungen für einen Systemwechsel im Reich und seine Rolle im Hitlerputsch. Kurz gefasst gilt die Frage: Wollte Kahr Hitler in die Schranken weisen, oder wollte er ihn kopieren?
Die Arbeit basiert, was die Primärquellen angeht, auf den jeweiligen Nachlässen der jeweiligen Ministerpräsidenten (bei Kahr umfangreich, bei Lerchenfeld und Knilling sehr überschaubar) inklusive Kahrs ausführlichen Lebenserinnerungen sowie auf den Ministerratsprotokollen im Zeitraum. Hinzu kommen die Fraktionsprotokolle der BVP, diverse Personennachlässen (z.B. Heim, Held, Hamm, Escherich, Kanzler) und Erinnerungen (z.B. Schmelzle, Löwenfeld, Sommer), Protokolle des Landtags, des Hitlerprozesses und des Landtags-Untersuchungsausschusses zum Hitlerputsch von 1928. Ferner wurde ein umfangreicher Pressespiegel der Zeit herangezogen (z.B. Münchner Neueste Nachrichten, München Augsburger Abendzeitung, Miesbacher Anzeiger, BVP-Korrespondenz, Bayerischer Kurier, Münchner Post). Aufgrund der Nähe der damaligen Presse zu einer politischen Richtung erlaubt das jeweilige Presseorgan Rückschlüsse auf die jeweilige Popularität eines Ministerpräsidenten in der entsprechenden Richtung.
Hinsichtlich der immer wieder geführten Diskussionen über den Sinn und Zweck historischer Biographien möchte sich diese Arbeit bewusst in kein schwarz-weiß Denken begeben. Sie geht weder in einem altmodischen Sinn davon aus, dass diese Männer allein für den Verlauf der bayerischen Geschichte verantwortlich zu machen sind, sondern natürlich nur in einem Umfeld (bzw. Netzwerk) aus Staatsspitze, Parteien, Presse, Bevölkerung, radikalen Kräften und weiteren Faktoren wirken konnten. Andererseits kann das nicht bedeuten, dass diese drei Persönlichkeiten nicht durch ihr selbstbestimmtes Handeln sehr wohl Einfluss auf den Lauf der Dinge hatten. Wie wäre es sonst – überspitzt gesagt – zu erklären, dass sich für die drei Amtszeiten auch deutliche Unterschiede ausmachen lassen? Das Wirken jedes einzelnen der drei „Beamtenministerpräsidenten“ lässt sich nur aus einer Kombination von Persönlichkeit und politisch wirkendem Umfeld heraus verstehen. Kahr, das zeigt sich offenkundig, wurde wissend oder unwissend von Militärs, Paramilitärs und anderen Kräften beeinflusst. Sein Ideenreichtum ist weitaus geringer, als er in seinen Lebenserinnerungen zu vermitteln versucht. Doch hätten diese Kräfte in Bayern nie so erblühen können, wenn er sein Organisationstalent und sein Ansehen nicht in deren Dienst gestellt hätte. Umfeld und Person benötigten sich hier gegenseitig. Lerchenfeld wiederum wollte einen eigenen Weg der Vernunft gehen – gegen sein Umfeld. Das politische Umfeld blockierte hier den Willen der Person, um ihn erst zu verändern und am Ende zu brechen. Und Knilling stellt unter Beweis, dass auch die Schwäche einer Führungsperson ihre Wirkung auf das Umfeld zeigt. Nicht nur der Druck des Umfelds, sondern auch persönlich unterlassenes Handeln prägen das Fazit seiner Amtszeit. Dass das Verhältnis von Umfeld und historischer Person auch einem schnellen Wandel unterzogen sein kann, belegt Kahrs Generalstaatskommissariat. Einerseits bewirkt Kahrs Person ohne Zweifel eine zeitweilige Eindämmung Hitlers. Durch seine Autorität wurden nun auch Maßnahmen auf den Weg gebracht, die zuvor von anderen lange diskutiert, doch nie umgesetzt wurden. Andererseits konnte er sich die Stellung als gemeinsamer Nenner des vaterländischen Lagers, die er noch als Ministerpräsident inne hatte, nicht mehr zurückerobern. Vier Kapitel, die eines zeigen: Weder das Umfeld, noch die historische Person funktionieren alleine.
Zurück zum Themenbereich Personengeschichte
Quelle: http://histbav.hypotheses.org/1597