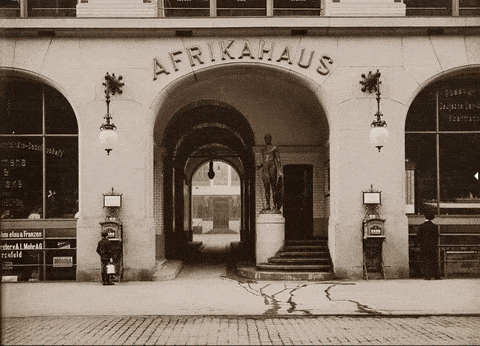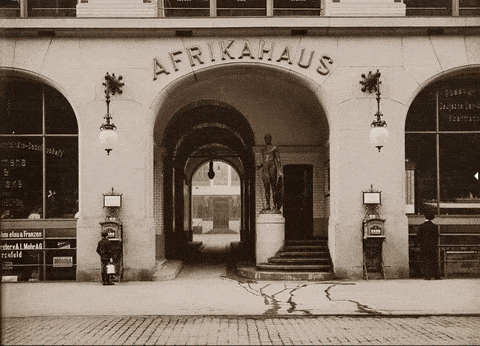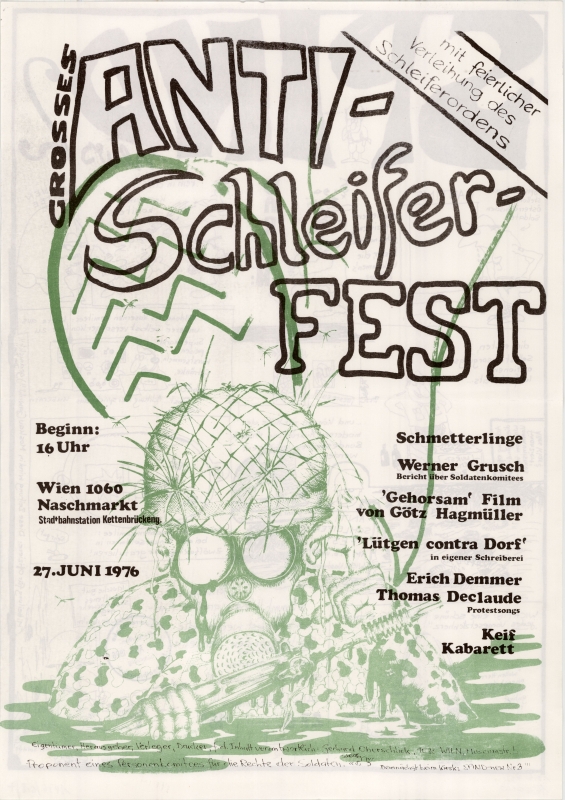Sein Musiktheater bevölkern Protagonistinnen und Protagonisten ganz unterschiedlicher Charaktere und die Sujets entstammen ganz unterschiedlichen Epochen und kulturellen Kontexten. So gehört sich das auch für einen richtigen Opernkomponisten, und Siegfried Matthus, 1934 im damals ostpreußischen Mallenuppen (heute: russ. Sadoroshnye) geboren, ist ein richtiger Opernkomponist. Da gibt es in „Omphale“ (1976), deren Libretto ursprünglich für Henze bestimmt war, einen Herakles in Frauenkleidern und als verweichlichten Sklaven, ergeben der Königin von Mäonien, die ihm Trillinge gebären wird. Da gibt es die biblische Judith in der gleichnamigen zweiaktigen Hebbel-Bearbeitung für die Komische Oper Berlin (1985), eine hochdramatische Charakterfigur vom Schlage der Strauss’schen Salome. Da gibt es den tragisch tief verstrickten Fähnrich Christoph Rilke, mit dessen Schicksal sich Matthus in einem ausgesprochen persönlichen musikalischen Bildnis zur Wiedereröffnung der Semper-Oper 1985 befasste. Es gibt den Grafen Mirabeau aus den Zeiten der Französischen Revolution, dessen private, gesellschaftliche und politische Hintergründe Matthus für eine Oper in Berlin im Jahr des Mauerfalls ausgeleuchtet hat; eine Desdemona, die in einem kammeroperistischen Monolog 1992 in Schwetzingen Worte der Hetäre Megara aus Aristophanes‘ „Lysistrata“ zitierte, aber auch frauenfeindliche Invektiven aus dem Alten Testament, Gedanken der Desdemona Shakespeares und der in Stuttgart-Stammheim durch Selbstmord geendeten Pfarrerstochter und Rote Armee-Terroristin Gudrun Ensslin. Da gibt es in „Farinelli oder die Macht des Gesangs“ (1998) den hochberühmten Kastratensänger als Opernheld, es gibt den Kronprinzen Friedrich, der ob seiner „effeminierten Neigungen“ und Beziehungen von seinem Vater, Friedrich Wilhelm I. hingerichtet wird.
[...]
Quelle: http://musicaroma.hypotheses.org/980